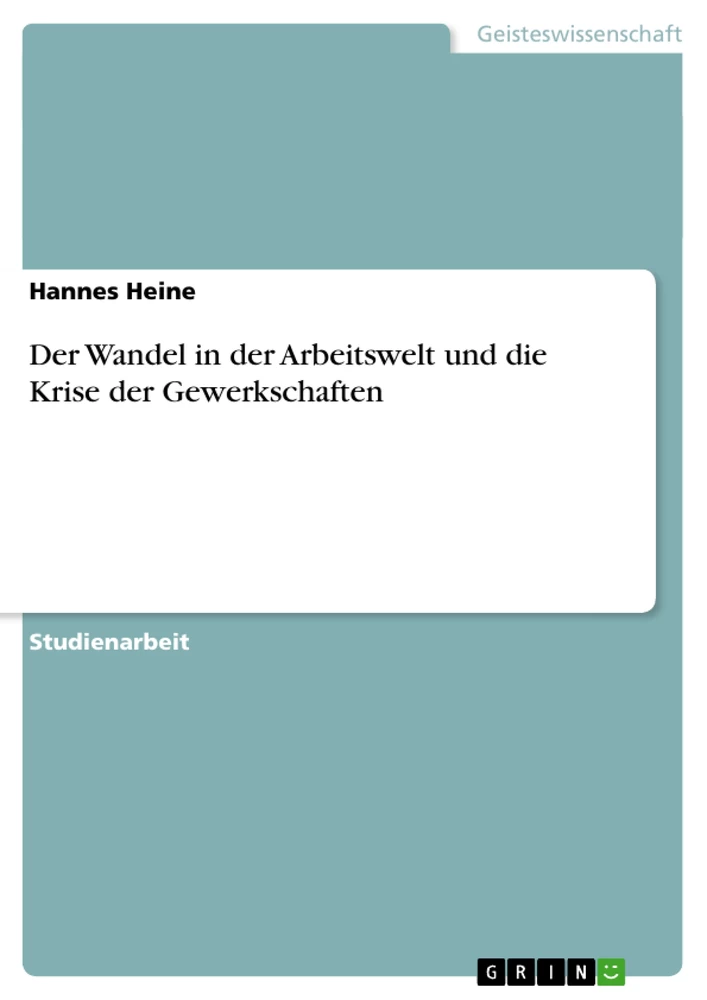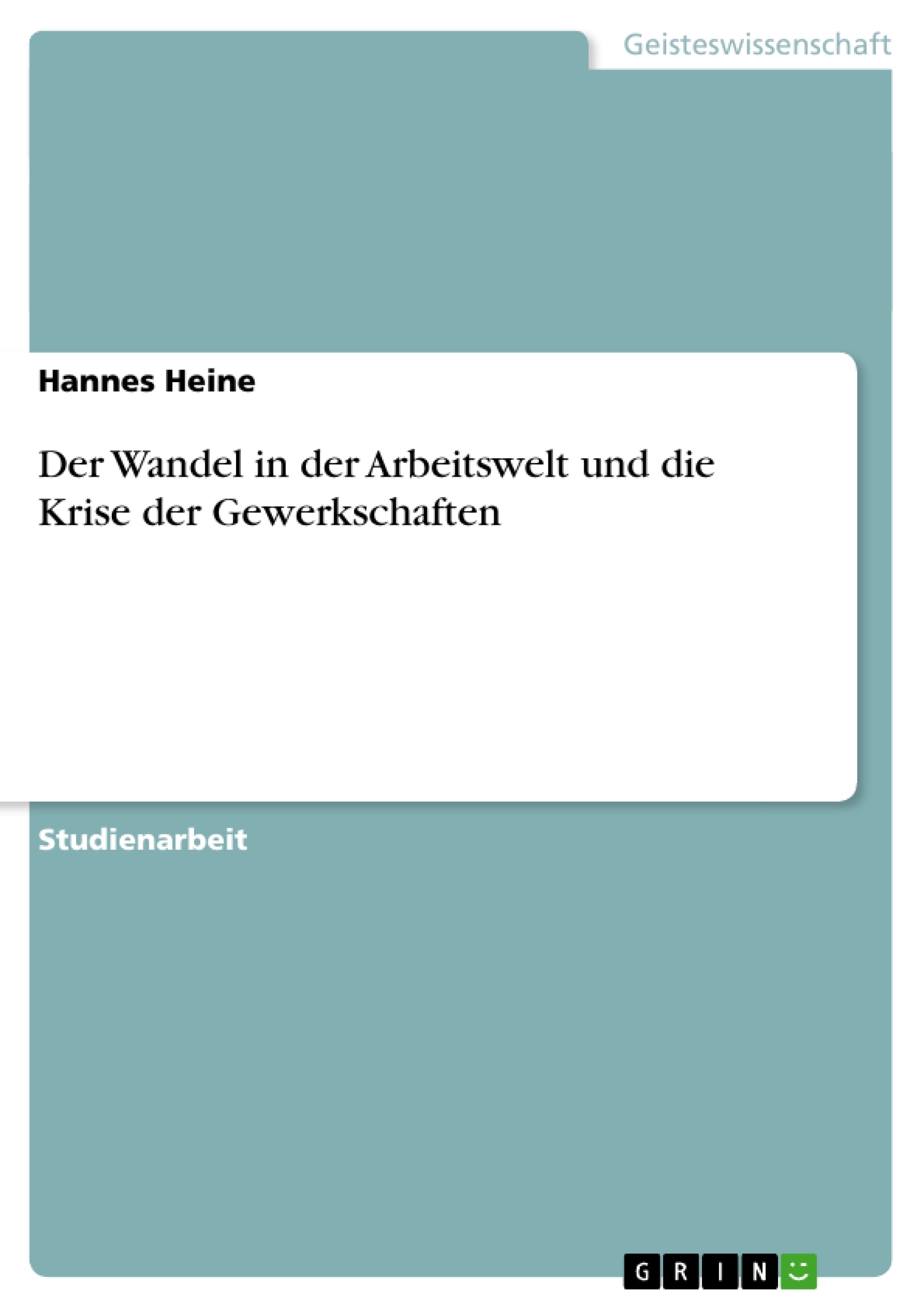Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Während Subjektivierung, Entgrenzung und Vermarktlichung den Charakter der Arbeit schrittweise ändern, haben die daraus resultierenden neuen Rahmenbedingungen auch Einfluß auf die Organisationen der Arbeitnehmer: die Gewerkschaften. In dieser Arbeit wird zunächst Produktionsweise der vergangenen Jahrzehnte dargelegt, dann auf die traditionelle Politik der bundesdeutschen Gewerkschaften eingegangen, um anschließend die Folgen der Veränderungen in der Arbeitswelt für die Gewerkschaften darzustellen. Die aus Sicht des Autors verschärften Bedingungen für Arbeitnehmer setzen die Frage nach einer wirklichen Humanisierung der Arbeit (wieder) auf die Tagesordnung. Deshalb habe ich dem Kapital „Folgen für die Gewerkschaften“ einen Beitrag „Humanisierung der Arbeit“ nachgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenlage und Definitionen
- Fordismus und Taylorismus
- Die bundesdeutschen Gewerkschaften
- Nach dem Krieg bewusst als Einheitsgewerkschaften gegründet
- Als Beispiel für eine kritische und weniger konfliktscheue Gewerkschaft galt lange die Industriegewerkschaft Medien
- In der Öffentlichkeit gelten die Arbeitnehmerorganisationen als "Fossile" der untergegangenen Industriegesellschaft.
- Veränderte Rahmenbedingungen
- Die mediale Öffentlichkeit, Teile der Gewerkschaften, die Wirtschaftsverbände und die Industriesoziologie verkünden seit einigen Jahren, dass die Arbeitswelt in den entwickelteren kapitalistischen Staaten einem grundlegenden Wandel unterworfen ist.
- Industrielle Arbeitsplätze haben ihren eigenen Charakter zwar nicht verloren, aber die heutigen Tätigkeitszuschnitte und Organisationsstrukturen unterscheiden sich signifikant von denen zu Zeiten des „rohen“ Taylorismus.
- Die Unternehmensführungen haben die Subjektivität der Individuen als Produktionsfaktor wieder neu entdeckt.
- Die Gewerkschaften und ihre Mitglieder scheinen nach der drei Jahrzehnte währenden fordistischen, durch Sozialpartnerschaft geprägten Periode, dem heutigen Out-sourcing und Deregulieren auf der einen und der Betriebspolitik, mit den Anforderungen an den „systemregulierenden“, selbstständigeren Arbeiter auf der anderen Seite kaum gewachsen zu sein.
- Während in den gewerkschaftlich gut organisierten Bereichen Arbeitsplätze abgebaut wurden, erfolgte ein Beschäftigungsaufbau vor allem genau dort, wo Gewerkschaften bisher wenig interveniert hatten.
- Ein wesentliches Moment gesamtgesellschaftlichen Wandels seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist der historische Rückgang der industriellen Großproduktion.
- Folgen für die Gewerkschaften
- Der Wandel, das Ende des Kapitalismus des 19. und 20. Jahrhunderts, und die Manifestierung einer entgrenzteren kapitalistischen Produktion bedingt tatsächlich eine Krise, die offensichtlich mehr ist als ein Stimmungstief in der Demokratie westlicher Prägung.
- Die Flächentarifverträge sind kaum noch zu erhalten.
- Zunehmend wird der Einzelne durch den Unternehmer und seine Personalabteilungen angesprochen.
- Ein wesentlicher Aspekt der Folgen makroökonomischer und betrieblicher Veränderungen und ihrer Auswirkungen auf die Sozialstruktur der BRD – deren Betrachtung nur eine gesonderte Arbeit gerecht werden könnte – ist das Auseinandertreten der Interessen und Lebenslagen von Arbeitsplatzinhabern und Arbeitslosen.
- Auch Organisationsform und innere Struktur der Gewerkschaften stehen zunehmend im Widerspruch zu einer erfolgreichen Behauptung der Gewerkschaftsbewegung.
- Neben Fragen der Organisationsform und der Organisationspflege, die Gewerkschaften und andere Verbände grundsätzlich zu jeder Zeit und überall betreffen, sind in den letzten Jahren die drängenden Fragen des sozioökonomischen Wandels hinzugekommen.
- Dabei ist die Überalterung der Mitgliedschaft ein zentrales Problem.
- Organisationsbedingt ist der Charakter eines hierarchischen Spitzenverbandes mit den Problemen einer fehlenden Flexibilität behaftet, der dem kapitalistischen Produktionsgeschehen zwangsläufig hinterher hinken muss.
- Humanisierung der Arbeit
- Der Wandel der Arbeitswelt vom Fordismus zum Postfordismus
- Die Krise der deutschen Gewerkschaften im Kontext der Globalisierung und Flexibilisierung der Arbeitswelt
- Die Bedeutung der Humanisierung der Arbeit in der heutigen Zeit
- Die Herausforderungen für die Gewerkschaften im Hinblick auf ihre Organisation und ihre Rolle als Interessenvertreter der Arbeitnehmer
- Die Frage, ob die Gewerkschaften in der Lage sind, sich an die neuen Bedingungen der Arbeitswelt anzupassen
- Einleitung: Die Arbeit stellt die zentralen Fragen zum Wandel der Arbeitswelt und den Herausforderungen für die Gewerkschaften in den Vordergrund.
- Quellenlage und Definitionen: Die Arbeit erläutert die Quellenbasis und definiert die in der Hausarbeit verwendeten Begriffe.
- Fordismus und Taylorismus: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung und die Auswirkungen des Fordismus und Taylorismus auf die Arbeitswelt.
- Die bundesdeutschen Gewerkschaften: Dieser Abschnitt behandelt die Geschichte und Entwicklung der deutschen Gewerkschaften, insbesondere des DGB, und ihre Rolle im Kontext des deutschen Wirtschaftswunders.
- Veränderte Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel beschreibt die neuen Herausforderungen für die Arbeitswelt, wie die Globalisierung und Flexibilisierung, und deren Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation und die Unternehmenskultur.
- Folgen für die Gewerkschaften: Dieser Teil analysiert die Folgen der veränderten Rahmenbedingungen für die deutschen Gewerkschaften, insbesondere die Herausforderungen der Mitgliederschwund, die Überalterung der Mitgliedschaft und die Schwierigkeiten, sich als Machtfaktor in einer individualisierten Arbeitswelt zu behaupten.
- Humanisierung der Arbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit einer humanistischen Gestaltung der Arbeit, angesichts der technischen und ökonomischen Entwicklungen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert den Wandel der Arbeitswelt und seine Auswirkungen auf die deutschen Gewerkschaften. Sie untersucht die Entwicklung des Fordismus und Taylorismus, die Rolle der deutschen Gewerkschaften im Kontext des Wirtschaftswunders und die Auswirkungen der veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf die Gewerkschaften.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe der Hausarbeit sind der Wandel der Arbeitswelt, der Fordismus, der Taylorismus, die Globalisierung, die Flexibilisierung, die deutsche Gewerkschaftsbewegung, der DGB, die Humanisierung der Arbeit, die Organisationskrise der Gewerkschaften, die Mitgliederwerbung, die transnationalen Gewerkschaftsstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Warum stecken deutsche Gewerkschaften in einer Krise?
Gründe sind der Strukturwandel (weniger Industrie), die Überalterung der Mitglieder, die Flexibilisierung der Arbeit und Schwierigkeiten bei der Organisation neuer Beschäftigungsfelder.
Was ist der Unterschied zwischen Fordismus und Postfordismus?
Der Fordismus war durch Massenproduktion und klare Hierarchien geprägt. Der Postfordismus setzt auf Flexibilität, Outsourcing und die Subjektivität des Arbeiters als Produktionsfaktor.
Was bedeutet "Humanisierung der Arbeit" heute?
Es geht um die Gestaltung von Arbeitsbedingungen, die den Menschen nicht nur als Rädchen im Getriebe sehen, sondern seine Gesundheit und Selbstbestimmung fördern.
Was versteht man unter der "Entgrenzung" von Arbeit?
Entgrenzung bedeutet das Verschwimmen der Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit sowie zwischen Betrieb und Privatleben.
Wie hat sich die Mitgliederstruktur der Gewerkschaften verändert?
Es gibt einen historischen Rückgang in der industriellen Großproduktion, während in Dienstleistungsbereichen die gewerkschaftliche Organisation oft schwächer ausgeprägt ist.
- Arbeit zitieren
- Hannes Heine (Autor:in), 2002, Der Wandel in der Arbeitswelt und die Krise der Gewerkschaften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72592