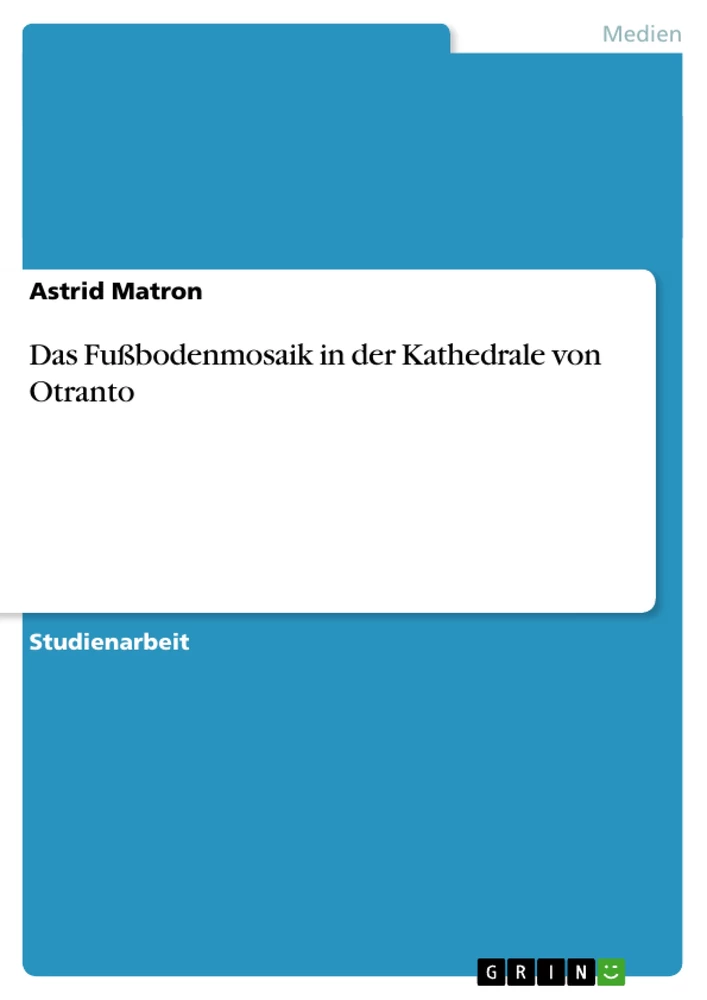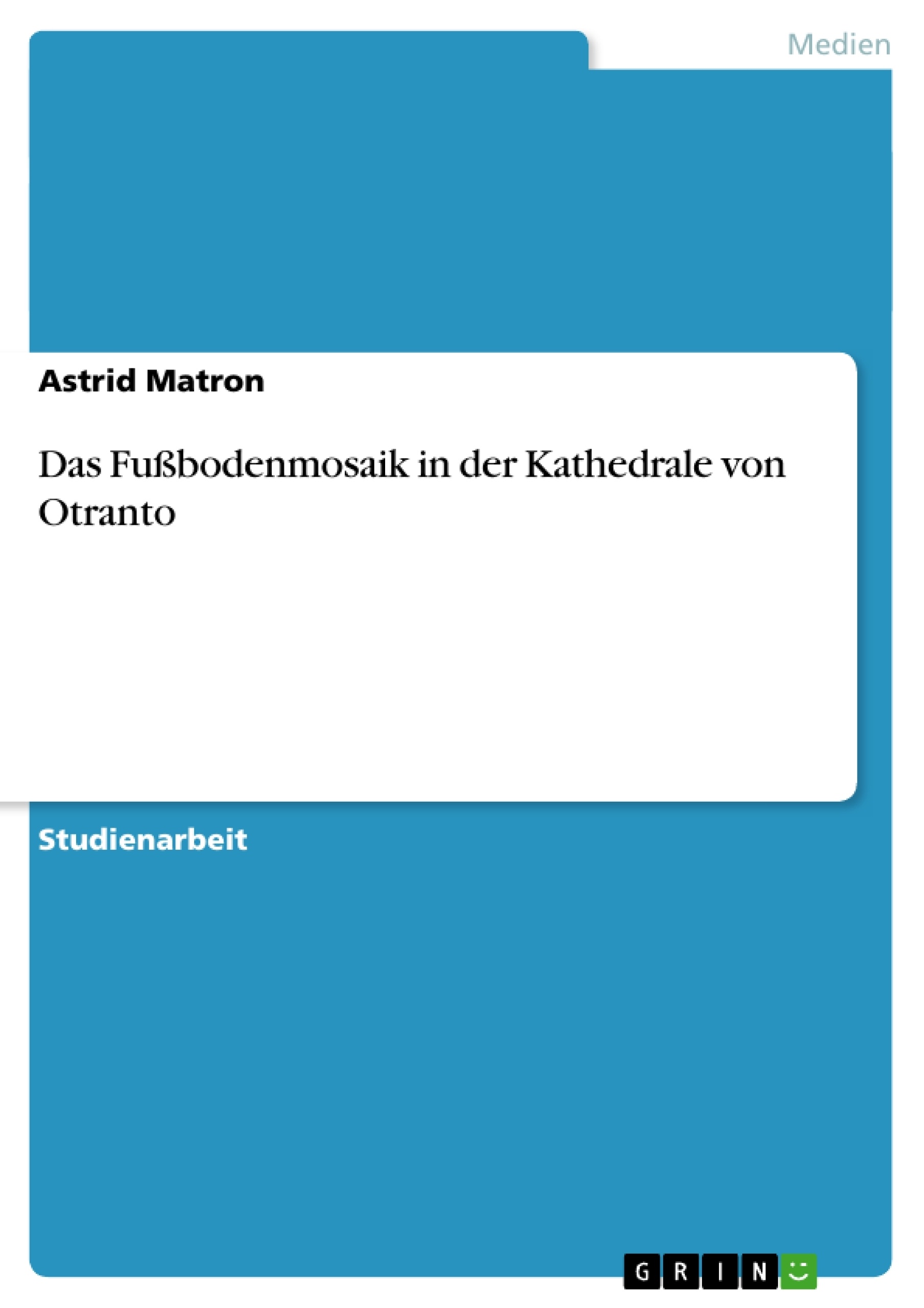„Betreten und Sehen – Bilder am Boden“ lautete der Titel des Seminars, auf das sich diese Arbeit bezieht. Wenn man davon ausgeht, dass das zu Sehende auf dem Boden liegt, den man betritt, stellt sich als erstes die Frage, wie viel man dabei überhaupt sehen kann. Eine Frage, die bei dem Fußbodenmosaik in der Kathedrale von Otranto besonders beschäftigt, da wir es hier mit einer ungewöhnlichen Bilderfülle zu tun bekommen, die den Betrachter schlicht überfordern muss – und vielleicht bewusst überfordern will. Wie der Betrachter mit dieser Überforderung umgehen kann und welche möglichen Rückschlüsse sich auf die Intention der Auftraggeber/ Künstler des Mosaiks ziehen lassen, soll einen wichtigen Punkt dieser Arbeit einnehmen.
Das wissenschaftliche Interesse an dem Mosaikfußboden in Otranto beginnt mit dem 19. Jahrhundert, allerdings findet man ihn hier zunächst nur in Überblickswerken zur gesamten Kunst Unteritaliens erwähnt, während es erst im 20. Jahrhundert einzelne Veröffentlichungen speziell zu Otranto gibt. Die zugängliche Literatur hat sich eingehend mit der Identifizierung und Ikonographie der einzelnen Elemente des Mosaiks beschäftigt, doch haben sich zumindest in der deutschsprachigen Forschung seit Anfang der achtziger Jahre keine neuen Erkenntnisse oder Herangehensweisen entwickelt. Christine Ungruhs Aufsatz über die Apokalypsedarstellungen in der Apsis bildet die einzige Ausnahme; auf ihre These zu den Darstellungen des Apsismosaiks wird in Kapitel 4.1 noch näher eingegangen.
Auch die italienische Forschung bietet mit Maria Coppolas jüngster Veröffentlichung keine wirklich neuen Ansätze, sondern vielmehr eine Bestandsaufnahme und einen Vergleich der bis dato erschienen Literatur, wobei auch sie ihr Hauptaugenmerk auf ikonographische Vorbilder und Interpretationen legt.
Aufgrund dieser Forschungslage ist es umso interessanter, sich nach einer Bestandsaufnahme und Strukturierung des Mosaiks der Frage nach den Rezeptionsmöglichkeiten zu stellen, die dieses Werk bietet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung der Kathedrale und des Mosaiks
- Beschreibung des Mosaiks
- Einzelne Motive und ihre Verortung
- Strukturen und Strukturbrüche
- Deutung
- Einzelelemente und Zyklen
- Gesamtzusammenhang
- Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Fußbodenmosaik in der Kathedrale von Otranto. Ziel ist es, die Rezeptionsmöglichkeiten dieses außergewöhnlichen Werks zu untersuchen. Dabei werden die einzelnen Elemente des Mosaiks betrachtet, strukturelle Besonderheiten analysiert und verschiedene Deutungsmöglichkeiten erörtert.
- Die Entstehung und historische Einordnung des Mosaiks
- Die Ikonographie und Anordnung der einzelnen Motive
- Die Bedeutung des Mosaiks im Kontext der mittelalterlichen Kunst
- Mögliche Interpretationen und Rezeptionsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Mosaiks in Otranto im Kontext der Forschungslandschaft dar und erläutert die aktuelle Forschungslage. Kapitel 2 behandelt die Entstehung der Kathedrale von Otranto und des Mosaiks im historischen Kontext. Kapitel 3 bietet eine detaillierte Beschreibung des Mosaiks, einschließlich der einzelnen Motive und ihrer Anordnung sowie der strukturellen Besonderheiten. Das vierte Kapitel widmet sich der Deutung des Mosaiks, indem es die einzelnen Elemente und ihre möglichen Bedeutungen sowie den Gesamtzusammenhang analysiert.
Schlüsselwörter
Fußbodenmosaik, Kathedrale von Otranto, mittelalterliche Kunst, Ikonographie, Rezeption, Deutung, Geschichte der Architektur, normannische Kunst, byzantinische Kunst.
- Quote paper
- Astrid Matron (Author), 2006, Das Fußbodenmosaik in der Kathedrale von Otranto, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72669