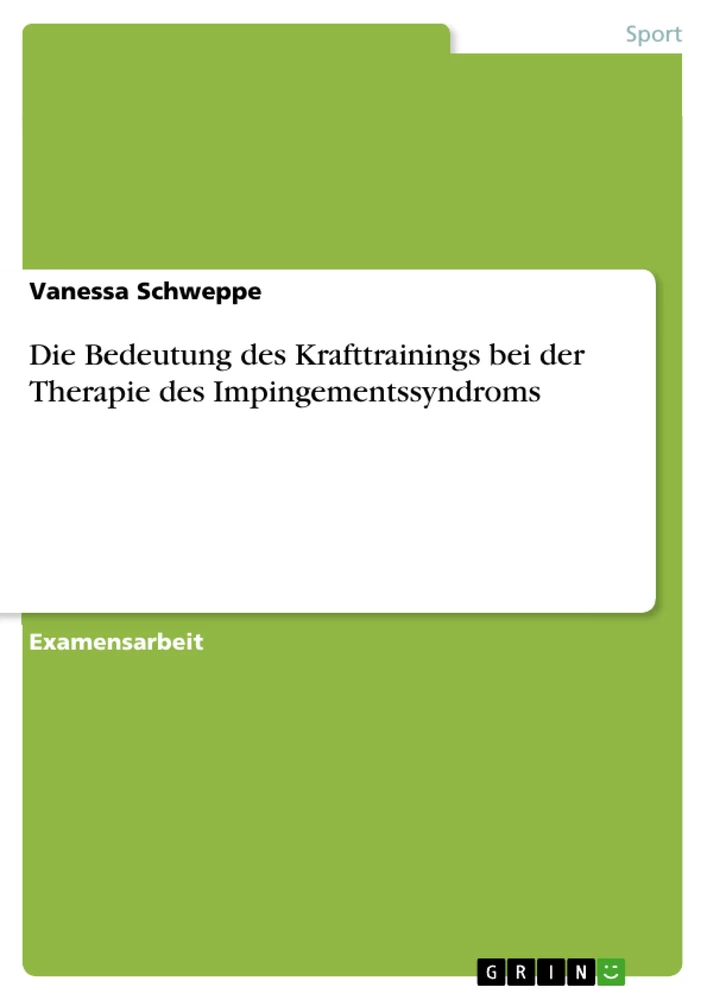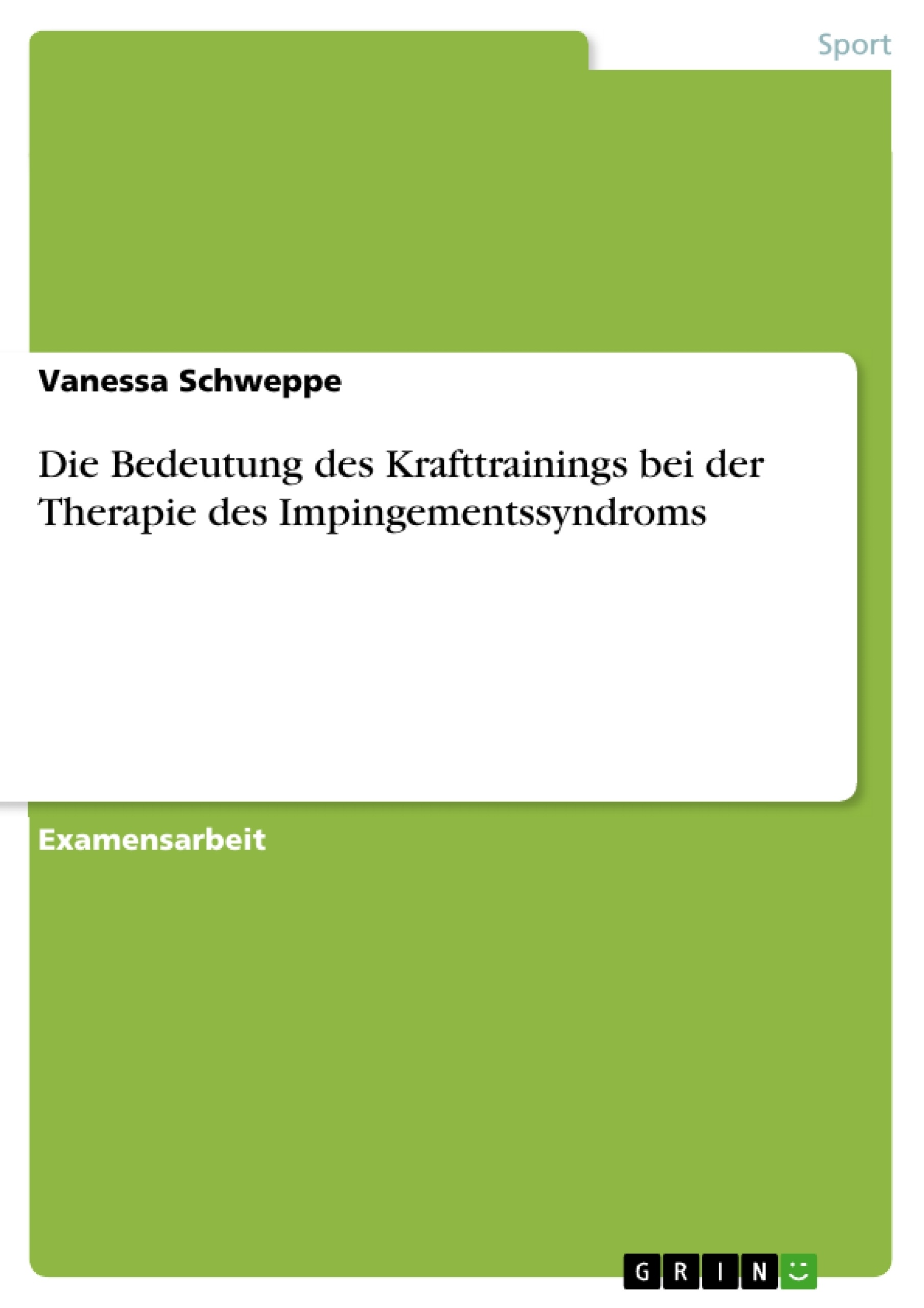Die volle Funktionsfähigkeit des Schultergelenks ist untrennbar mit der Gebrauchsfähigkeit des Armes verbunden. Nahezu jede Bewegung des Armes wird auch im Schultergelenk vollzogen.
Eine Schädigung des Schultergelenks hat deshalb sowohl kurzfristige als auch langfristige Auswirkungen auf den gesamten Arm. So kann es beim Impingementsyndrom zu erheblichen Einschränkungen für den Alltag und das Berufsleben kommen. Umso wichtiger ist das frühzeitige Erkennen und die richtige Behandlung der Ursachen dieses Krankheitsbildes.
Das Impingementsyndrom gehört zu einem der häufigsten orthopädischen Krankheitsbilder der Schulter überhaupt. Allerdings wird ein Schulterschmerz häufig allzu schnell als ein Impingementsyndrom klas-sifiziert, so dass es aus diesem Grund schwierig ist, die Häufigkeit des Syndroms genau zu beziffern.
In der Diagnostik ist es wesentlich, herauszuarbeiten, welche Struktur für den Schmerz verantwortlich ist, damit dann in der Therapie diese Struktur angegangen werden kann. Bei der Diagnose des Impinge-mentsyndroms sind besonders die bildgebenden Verfahren von Bedeutung. Hinzu kommen spezielle Provokationstests, mit denen das Impingement von anderen Schulterschmerzen differenziert werden kann.
Die Pathogenese des subakromialen Schmerzsyndroms ist multifaktoriell. Sie hat viele teils sehr verschiedene Ursachen und es ist schwer möglich, eine adäquate Therapie zu bestimmen, ohne die genauen Ursachen der Entstehung des Krankheitsbildes zu kennen. Je nachdem ob die Ursachen mechanischer oder funktioneller Natur sind, muss zwischen einer konservativen und einer operativen Therapie entschieden werden. Nicht bei jedem Impingementsyndrom hilft eine konservative Therapie.
Da aber gerade beim Sportler die funktionellen Ursachen überwiegen, soll in dieser Arbeit ausschließlich die konservative Therapie behandelt werden, deren wichtigstes Element das Krafttraining ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Anatomie der Schulter
- 2.1 Gelenke
- 2.1.1 Das Glenohumeralgelenk
- 2.1.2 Die Schulternebengelenke
- 2.2 Die Muskulatur
- 2.3 Die Gelenkräume
- 3 Die Verletzungsanfälligkeit des Schultergelenks
- 3.1 Akute Sportverletzung
- 3.2 Chronische Überlastungsschäden
- 3.3 Schulterinstabilität
- 4 Das Impingementsyndrom
- 4.1 Erscheinung
- 4.1.1 Subakromiales Impingement
- 4.1.2 Subkorakoidales Impingement
- 4.2 Symptome
- 4.3 Ursachen
- 4.3.1 Extrinsische Faktoren
- 4.3.1.1 Primäres Impingement
- 4.3.1.2 Sekundäres Impingement
- 4.3.2 Intrinsische Faktoren
- 5 Diagnostik des Impingementsyndroms
- 5.1 Klinische Diagnostik
- 5.1.1 Inspektion
- 5.1.2 Palpation
- 5.1.3 Impingement-Tests
- 5.1.3.1 Painful Arc
- 5.1.3.2 Impingement-Test nach Neer
- 5.1.3.3 Impingement-Test nach Hawkins
- 5.1.3.4 Jobe-Test
- 5.1.4 Funktionstests bei Überkopfsportlern
- 5.1.4.1 Werfertest
- 5.1.4.2 Relokationstest
- 5.1.4.3 Apprehension-Test
- 5.2 Bildgebende Diagnostik
- 5.2.1 Röntgen
- 5.2.2 Sonographie
- 5.2.3 Magnetresonanztomographie (MRT)
- 5.2.4 Computertomographie (CT)
- 6 Therapie des Impingementsyndroms
- 6.1 Konservative Therapie
- 6.1.1 Medikamentöse Behandlung
- 6.1.2 Therapeutische Lokalanästhesie
- 6.1.3 Physikalische Schmerztherapie
- 6.1.3.1 Thermotherapie
- 6.1.3.1.1 Kryotherapie
- 6.1.3.1.2 Wärmeapplikation
- 6.1.3.2 Elektrotherapie
- 6.1.3.3 Ultraschall
- 6.1.4 Krankengymnastik
- 6.1.4.1 Methode nach Cyriax
- 6.1.4.2 Brügger-Konzept
- 6.1.4.3 PNF
- 6.1.4.3.1 PNF-Methode
- 6.1.4.3.2 PNF-Techniken
- 6.1.4.3.2.1 Grundtechniken
- 6.1.4.3.2.1 Arbeitstechniken
- 6.1.4.4.3 Bewegungsmuster der oberen Extremität
- 6.2 Operative Therapie
- 6.2.1 Subakromiale Dekompression
- 6.2.2 Refixationen
- 7 Krafttraining
- 7.1 Definition der motorischen Fähigkeit Kraft
- 7.2 Struktur der Kraftfähigkeiten
- 7.3 Dimensionen der Kraft
- 7.4 Belastungsnormative
- 7.4.1 Belastungsintensität
- 7.4.2 Belastungsdauer
- 7.4.3 Belastungsumfang
- 7.4.4 Belastungsdichte
- 7.4.5 Trainingshäufigkeit
- 7.5 Methoden des Krafttrainings
- 7.6 Ziele des Krafttrainings
- 8 Krafttraining in der Rehabilitation und Therapie
- 8.1 Grundsätze des Aufbautrainings
- 8.2 Ziele des rehabilitativen Krafttrainings
- 8.3 Aufbau des rehabilitativen Trainings
- 8.3.1 Koordinationstraining
- 8.3.2 Kraftausdauertraining
- 8.4 Rehabilitatives Krafttraining als Kompensation von Instabilität
- 8.5 Trainingsmittel
- 9 Schulterrehabilitation
- 9.1 Die Rolle der Skapula
- 9.2 Skapulasetting
- 9.3 Ziele der Schulterrehabilitation
- 9.4 Phasen der konservativen Therapie beim Impingementsyndrom
- 9.4.1 Schmerzbehandlung
- 9.4.2 Mobilisation
- 9.4.3 Kräftigung
- 9.5 Prävention eines erneuten Impingements
- 10 Die Impingement-Symptomatik des Sportlers
- 10.1 Das Modell der erworbenen Instabilität
- 10.2 Sportartspezifische Verletzungsmuster
- 10.2.1 Werferschulter
- 10.2.2 Schwimmerschulter
- 10.3 Diagnostik
- 10.4 Therapie
- 11 Gezielte Kräftigungsübungen für die Schultermuskulatur
- 11.1 Innen- und Außenrotatoren
- 11.2 Schulterblattfixatoren und -rotatoren
- 11.3 Bizeps
- 11.4 Stabilisation
- 12 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung des Krafttrainings bei der Therapie des Impingementsyndroms. Die Arbeit beleuchtet die anatomischen Besonderheiten der Schulter, die Verletzungsanfälligkeit des Schultergelenks sowie die Entstehung und Symptome des Impingementsyndroms. Die Arbeit beleuchtet außerdem verschiedene Diagnosemethoden und Therapieoptionen, insbesondere die Rolle des Krafttrainings in der Rehabilitation und Therapie des Impingementsyndroms.
- Anatomie und Funktionsweise der Schulter
- Verletzungsmechanismen und Pathogenese des Impingementsyndroms
- Diagnostik des Impingementsyndroms
- Konservative und operative Therapieoptionen
- Bedeutung des Krafttrainings in der Rehabilitation und Therapie des Impingementsyndroms
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Einführung in die Thematik des Impingementsyndroms und die Bedeutung des Krafttrainings in der Therapie.
- Kapitel 2: Anatomie der Schulter - Beschreibung der relevanten Gelenke, Muskulatur und Gelenkräume der Schulter.
- Kapitel 3: Die Verletzungsanfälligkeit des Schultergelenks - Erläuterung verschiedener Verletzungstypen, insbesondere der akuten Sportverletzungen, chronischen Überlastungsschäden und Schulterinstabilität.
- Kapitel 4: Das Impingementsyndrom - Definition, Erscheinungsformen, Symptome und Ursachen des Impingementsyndroms, inklusive intrinsischer und extrinsischer Faktoren.
- Kapitel 5: Diagnostik des Impingementsyndroms - Überblick über klinische und bildgebende Verfahren zur Diagnostik des Impingementsyndroms.
- Kapitel 6: Therapie des Impingementsyndroms - Beschreibung der konservativen und operativen Therapieoptionen für das Impingementsyndrom.
- Kapitel 7: Krafttraining - Definition und Bedeutung der motorischen Fähigkeit Kraft, sowie die relevanten Dimensionen und Belastungsnormative.
- Kapitel 8: Krafttraining in der Rehabilitation und Therapie - Grundprinzipien des Aufbautrainings und die Rolle des Krafttrainings in der Rehabilitation.
- Kapitel 9: Schulterrehabilitation - Die Rolle der Skapula, Skapulasetting und die verschiedenen Phasen der konservativen Therapie bei Impingementsyndrom.
- Kapitel 10: Die Impingement-Symptomatik des Sportlers - Erörterung der erworbenen Instabilität und sportartspezifische Verletzungsmuster, wie Werferschulter und Schwimmerschulter.
- Kapitel 11: Gezielte Kräftigungsübungen für die Schultermuskulatur - Beschreibung von Übungen zur Kräftigung der Innen- und Außenrotatoren, Schulterblattfixatoren und -rotatoren, sowie des Bizeps.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Impingementsyndrom der Schulter, einer häufigen Erkrankung, die vor allem Sportler betrifft. Die Arbeit behandelt die Anatomie der Schulter, die Entstehung des Impingementsyndroms, verschiedene Diagnosemethoden und Therapieformen, wobei der Fokus auf dem Einsatz von Krafttraining in der Rehabilitation liegt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Impingementsyndrom der Schulter?
Es handelt sich um ein subakromiales Schmerzsyndrom, bei dem Gewebe in der Schulter (z. B. Sehnen oder Schleimbeutel) eingeklemmt wird, was die Beweglichkeit des Arms stark einschränkt.
Warum ist Krafttraining bei der Therapie so wichtig?
Gezieltes Krafttraining stabilisiert das Schultergelenk, gleicht muskuläre Dysbalancen aus und ist das wichtigste Element der konservativen Therapie, besonders bei Sportlern.
Welche Diagnosemethoden werden beim Impingement angewandt?
Neben klinischen Tests wie dem Neer- oder Hawkins-Test kommen bildgebende Verfahren wie Ultraschall, Röntgen und MRT zum Einsatz.
Welche Rolle spielt das Schulterblatt (Skapula) in der Rehabilitation?
Die korrekte Stellung und Kräftigung der Schulterblattfixatoren (Skapulasetting) ist entscheidend für eine schmerzfreie Funktion des gesamten Schultergelenks.
Was sind typische Übungen zur Kräftigung der Schulter?
Gezielte Übungen für die Innen- und Außenrotatoren sowie die Stabilisation der Rotatorenmanschette sind zentrale Bestandteile des Trainingsplans.
- Arbeit zitieren
- Vanessa Schweppe (Autor:in), 2005, Die Bedeutung des Krafttrainings bei der Therapie des Impingementssyndroms, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72769