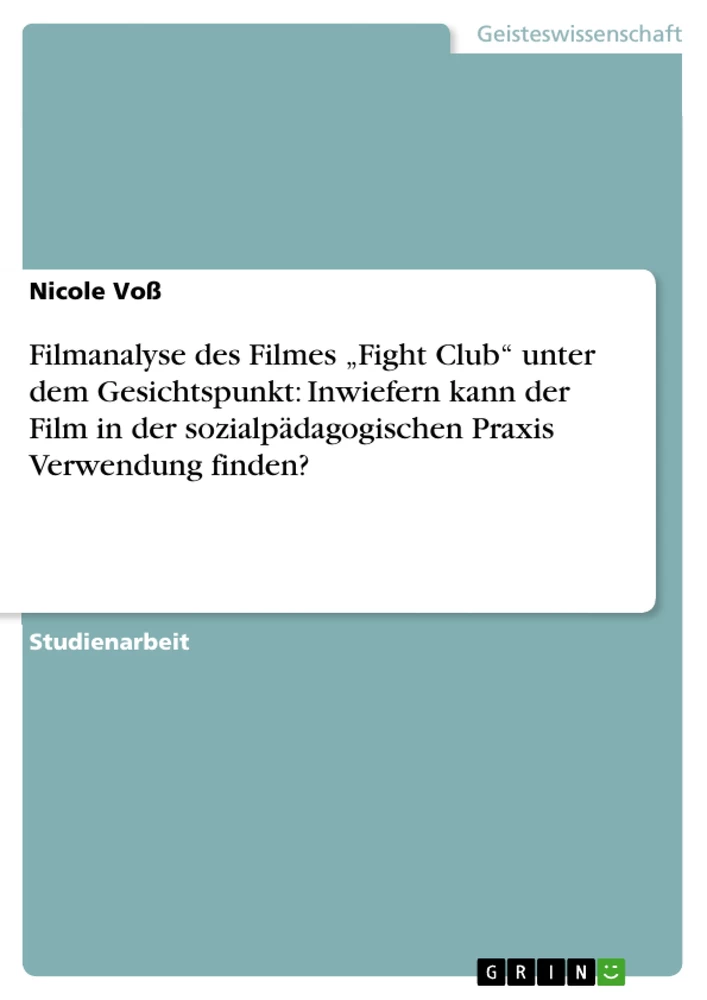Eine Interpretation des Filmes "Fight Club" bezogen auf die verschiedenen im Film auftretenden Charaktere und ihre Doppeldeutigkeit. Insbesondere wird hier das Augenmerk auf die Hauptperson Tyler Durdon gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Formales
- Inhaltliches
- Verschiedene Ebenen
- Gesellschaftskritik
- Selbstfindung
- Der ,,Fight Club“ oder „Tyler Durden“
- Beziehungen der Figuren zum Erzähler- Was passiert mit dem Erzähler?
- Verschiedene Ebenen
- Sozialpädagogische Einsetzbarkeit des Filmes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Film ,,Fight Club“ dient als Grundlage für die Analyse des Sozialpädagogischen Kino- und Fernsehfilms unter der Frage, inwieweit er in der sozialpädagogischen Praxis Verwendung finden kann. Der Film untersucht die gesellschaftlichen und psychologischen Aspekte eines Mannes, der sich im kapitalistischen System gefangen fühlt und nach einem Ausweg aus seiner existenziellen Krise sucht.
- Gesellschaftskritik: Der Film kritisiert den aktuellen moralischen Zustand der Gesellschaft und die kapitalistische Haltung mit ihren Folgen für den Einzelnen.
- Selbstfindung: Der Film stellt die Suche des Protagonisten nach Identität und Selbstfindung in einer dehumanisierenden Gesellschaft dar.
- Gewalt und Aggression: Der Film thematisiert Gewalt als Ausdruck der Frustration und Entfremdung des modernen Menschen, der sich im Hamsterrad des Konsums befindet.
- Männlichkeit: Der Film reflektiert die Konstruktionen von Männlichkeit und die Problematik traditioneller Rollenbilder im modernen Kontext.
- Subkultur: Der Film beleuchtet die Entstehung und den Charakter einer Subkultur als Reaktion auf die gesellschaftlichen Verhältnisse.
Zusammenfassung der Kapitel
Formales
Der Kinofilm ,,Fight Club“ wurde 1999 unter der Regie von David Fischer in den USA veröffentlicht. Das Drehbuch stammt von Jim Uhls, die Romanvorlage von Chuck Palahniuk. In den Hauptrollen spielen Brad Pitt als Tyler Durden, Edward Norton als Erzähler, Helena Bonham Carter als Marla Singer und Meat Loaf Aday als Robert Paulsen. Der Film ist von „,Linson Films/New Regency Productions\" produziert worden und hat eine Länge von 139 Minuten. ,,Fight Club“ ist ab 18 Jahren freigegeben und hatte seine Deutschlandpremiere am 11.11.1999 in Bremen. Der Film wurde von 1.055.000 Kinobesuchern in Deutschland gesehen und spielte in den USA 38 Mio Dollar ein.
Inhaltliches
Verschiedene Ebenen
Der Film präsentiert ein gesellschaftskritisches psychologisches Persönlichkeitskonstrukt, welches die Ausgangsperson, den namenlosen Erzähler, die Symbolik der wichtigsten Charaktere sowie die Bedeutung der Gewalt beleuchtet.
Gesellschaftskritik
,,Fight Club\" kritisiert den aktuellen moralischen Zustand der Gesellschaft und die kapitalistische Haltung. Die Gewinnmaximierung und das Streben nach einem perfekten repräsentativen Schein nach außen werden aufgezeigt. Die Hauptfigur, der namenlose Erzähler, fühlt sich in seiner beruflichen Aufgabe, für eine Automobilfirma Produktmängel zu beurteilen, gefangen. Er muss Menschenleben gegen Profit abwägen und wird im zwischenmenschlichen Klima am Arbeitsplatz mit harter Konkurrenz konfrontiert. Der Erzähler fühlt sich gezwungen, nach außen eine Fassade aufzubauen und keine Schwächen zuzulassen, was sich auch auf seinen Privat- und Freizeitbereich auswirkt. Er findet keinen Platz für Persönliches und alles verläuft in normierten Bahnen. Die Werbung vermittelt stereotype Bedürfnisse und liefert die Wege zu deren Erfüllung. Der Erzähler bezeichnet sich selbst als „Sklave des Ikea Nestbautriebs“ und strebt nach einem künstlichen Ideal, um sein Scheinbild zu perfektionieren. Dieser ausgeprägte Materialismus erdrückt seine Persönlichkeit und er reagiert lediglich auf seine Umwelt, ohne diese in der frühen Phase des Films beeinflussen zu können. Er pendelt zwischen den von der Gesellschaft suggerierten Bedürfnissen und dem Zwang zur Geldbeschaffung.
Selbstfindung
,,Fight Club\" kann als Geschichte einer Selbstfindung gesehen werden. Verschiedene Figuren, die dem Erzähler begegnen, repräsentieren seine einzelnen Entwicklungsphasen. Anfänglich erleben wir den Erzähler als eine neurotisch angepasste Persönlichkeit mit ausgeprägten Lebensängsten, die jede Möglichkeit zur Beeinflussung der Welt abhanden gekommen ist. Er hat weder Zugang zur Welt noch zum weiblichen Geschlecht. Nachdem er durch Schlafstörungen getrieben, an verschiedensten Selbsthilfegruppen teilnimmt, vollzieht sich ein erster Entwicklungsschritt: Er lernt Gefühle zuzulassen. Er bemerkt, dass er sich durch das Leid anderer Menschen gut fühlt und in ihrer Gegenwart seinen Emotionen freien Lauf lassen kann. Diese Tatsache löst jedoch eine neue Unsicherheit in seinem männlichen Selbstverständnis aus. Bob, der Hodenkrebspatient mit den Riesenbrüsten, verkörpert diesen Widerspruch. Als ehemaliger Bodybuilder durch den Hodenkrebs seiner „,Manneskraft“ beraubt und verweichlicht, taucht er später erneut im Fight Club auf, um seinen Aggressionen freien Lauf zu lassen, unter dem Motto „Wir sind immer noch Männer!\" Durch die Selbsthilfegruppen von der anfänglichen totalen Blockade ein Stück weit gelöst, geraten die Ereignisse erst recht ins „gleiten“. Der Erzähler begegnet Marla Singer, die vom einem Tag zum anderen lebt und die Dinge wie sie kommen nimmt. Marla pfeift auf Status und Repräsentation, da sie davon ausgeht, jeden Moment sterben zu können. Sie sieht dem „Nullpunkt\" permanent ins Auge. Während einer Meditationsübung sieht der Erzähler in Marla Singer sein „Krafttier“, so kann sie auch als seine weibliche, empfängliche Seite gesehen werden: Sie lässt die Welt einfach vorbehaltlos auf sich wirken. Diese Begegnung mit der Figur Marla Singer erschüttert das männliche Selbstbild des Erzählers endgültig. Genau zu diesem Zeitpunkt tritt Tyler Durden in sein Leben. In ihm materialisiert sich das männliche Ich-Ideal des Erzählers und damit dessen Abwehr des Weiblichen. Dies findet sich auch im Umgang der Beiden mit Marla wieder: Tyler behandelt sie ausschließlich als Sexobjekt, der Erzähler weist jede Annährung auf einer persönlich emotionalen Ebene zurück. Tyler und Marla haben aber auch etwas gemeinsam: Sie ähneln sich in ihren Bemühungen zum „Nullpunkt“ zu gelangen, das heißt einen Ort jenseits der beengenden Normen zu finden. Während Marla allerdings durch den Verzicht auf Selbstbestimmung und eine passive Hingabe ans Leben dorthin gelangen will, strebt Tyler die totale Selbstbestimmung an. Er möchte sich von allen Beschränkungen und Fesseln des Körpers befreien. In seinem Idealbild dürfen Leiden und Schmerz nicht länger Schranken darstellen, so dass für ihn das eigene sowie das fremde Leben zu einer gleichgültigen Angelegenheit wird.
Der ,,Fight Club“ oder „,Tyler Durden”
Dem Erzähler entgegengesetzt, träumt Durden von einem naturnahen Leben außerhalb der Hamsterkäfige, einem Leben, in dem jeder noch „seinen Mann stehen kann“. Ihn fasziniert die Vorstellung, sich in Grenzsituationen beweisen zu müssen und das am liebsten, wenn Gewalt im Spiel ist. Beim Versuch permanent an die Grenzen zu gehen, bricht Tyler nicht nur mit dem System, sondern stellt auch die eigene körperliche Existenz in Frage. Sein Ziel besteht letztendlich darin, gar nichts mehr an sich herankommen zu lassen. In diesem Zuge reduziert er das Thema Sexualität auf „Sportficken“ und seinen Körper bezeichnet er schlicht und einfach als „verwesende Biomasse“. Tylers Idee von einer absoluten Freiheit gipfelt im Traum, einem höheren Ziel geopfert zu werden. Aus diesem Grund gründet er seine Untergrundarmee, um die herrschende Ordnung zu zerstören. Hier kann eine Parallele zum Verhalten der Menschen im Faschismus gesehen werden. Tyler unterliegt den gleichen Mechanismen. Der absolute Kampf soll die Menschen von der Kompliziertheit der heutigen Gesellschaft erlösen. Wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, dass der Film aber nicht als neofaschistische Gewaltverherrlichung zu sehen ist, sondern Tyler mit seinem „Projekt Chaos“ zwar als „Versucher“ auftritt, sich aber der Erzähler am Ende seinem Einfluss entziehen kann. Die teilweise brutalen Kampfszenen sind somit als Visualisierung der auf ein animalisches Minimum an Zivilisiertheit reduzierten Menschheit zu deuten. Durch die kapitalistisch- materielle Gesellschaft in ein emotionales und definitionsloses Nichts gestoßen, finden sie im „Fight Club\" einen Ort bzw. ein Ventil, durch das sie die im Alltag angestauten Aggressionen und Blockaden ablassen können. Die Gesellschaft wird somit als Ursache der vorhandenen Gewaltbereitschaft verantwortlich gemacht.
Beziehungen der Figuren zum Erzähler- Was passiert mit dem Erzähler?
Der namenlose Erzähler als konsumistisch angepasster Yuppie, trifft auf zwei Menschen. Der erste von ihnen ist ein verweichlichter, kranker Mann mit dem …
Schlüsselwörter
Der Film ,,Fight Club“ behandelt Themen wie Gesellschaftskritik, Selbstfindung, Gewalt, Männlichkeit, Konsumkritik, Kapitalismus, Subkultur, und die Suche nach Identität in einer dehumanisierenden Gesellschaft. Der Film zeigt die Folgen von übermäßigem Konsum, dem Streben nach einem perfekten Scheinbild und den Auswirkungen einer kapitalistischen Lebensweise auf das Individuum. Wichtige Konzepte sind die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich, die Suche nach Sinn und Zugehörigkeit sowie die Kritik an gesellschaftlichen Normen und Konventionen.
- Quote paper
- Nicole Voß (Author), 2004, Filmanalyse des Filmes „Fight Club“ unter dem Gesichtspunkt: Inwiefern kann der Film in der sozialpädagogischen Praxis Verwendung finden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72790