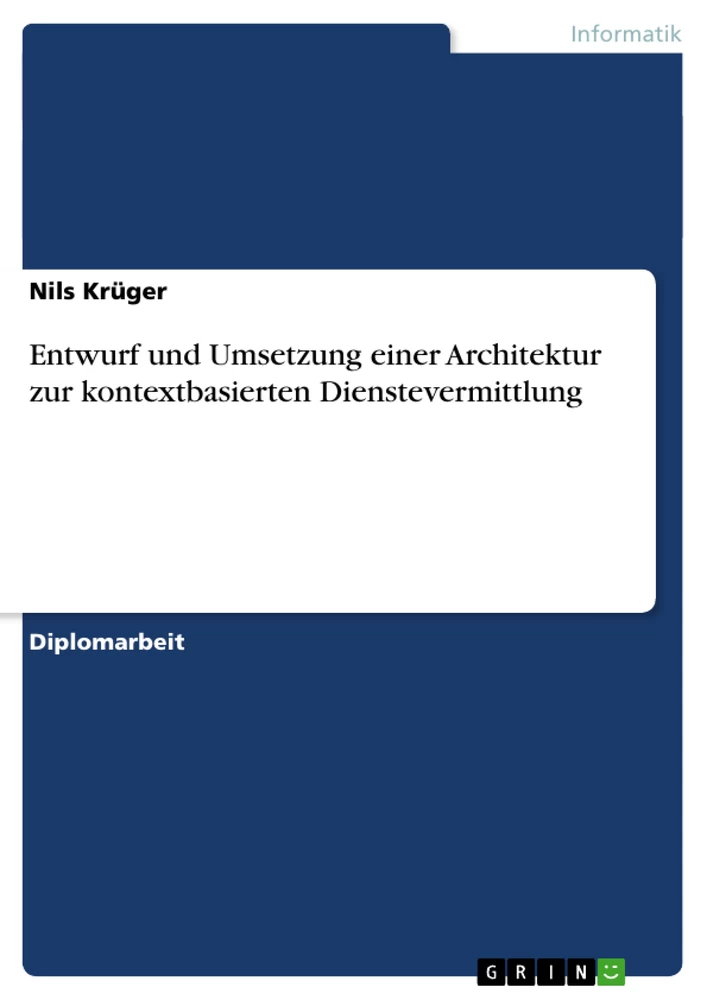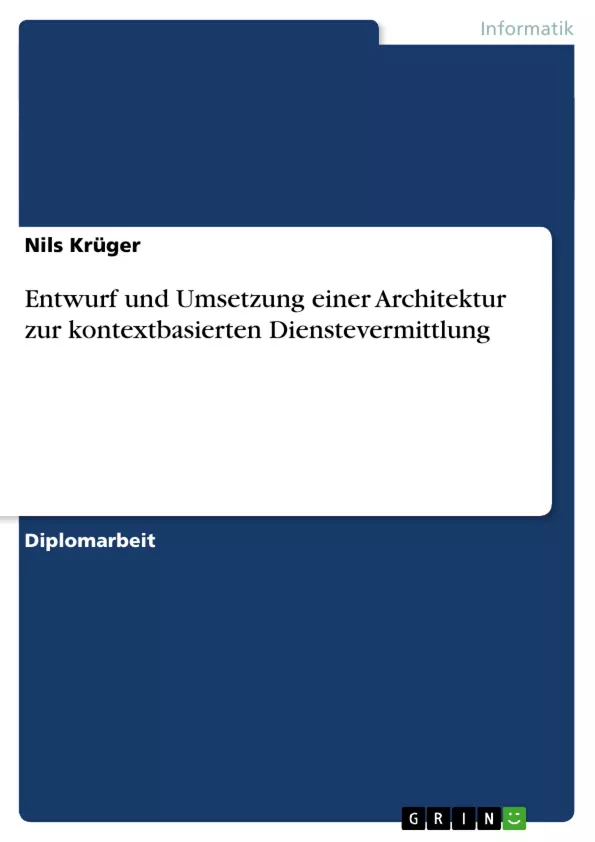Angetrieben durch die rasche Entwicklung in der Computerindustrie gibt es immer mehr Zukunftsvisionen, die schon bald realisierbar sein könnten. Bereits 1991 beschrieb Mark Weiser seine Vision des Ubiquitous Computing, in der Computer allgegenwärtig sind, und sie nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen werden. Die Bedienung muss so intuitiv und einfach sein, dass jeder, auch ohne Vorkenntnisse, die Möglichkeit hat, die Vorteile, die die elektronische Datenverarbeitung bietet, zu nutzen. Dabei werden nicht mehr PCs mit ihren vielfältigen Anwendungsbereichen eingesetzt, sondern kleine, hoch spezialisierte Geräte, die intelligent vernetzt sind. Das erhöht die Flexibilität und maximiert die Leistungsfähigkeit an dem Ort, an dem sie gebraucht wird. Grundsätzlich lässt sich der Entwicklungsprozess zum Ubiquitous Computing in drei Phasen einteilen. Am Anfang der Computernutzung gab es noch zentrale, leistungsfähige Mainframes, die ihre Ressourcen einer Vielzahl von Benutzern über individuelle Terminals zur Verfügung stellten (Mainframe-Ära).
Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, inwieweit ein Auffinden von Diensten (Service Discovery) in Abhängigkeit der Situation und der Absichten des Nutzers, also eines gewissen Kontextes, möglich ist. Wenn dieser Prozess maßgeblich vereinfacht und das Ergebnis verbessert werden kann, ist eine gute Grundlage für
die Unterstützung des Benutzers geschaffen. Heutzutage ist es nämlich nicht mehr die Leistungsfähigkeit des Computers, der den Engpass bei der Entwicklung von Systemen darstellt, sondern die des Menschen. Eine zu entwickelnde Architektur und dessen Umsetzung in einer Beispielimplementierung sollen die Möglichkeiten aufzeigen, und den Benutzer in die Lage versetzen, sein Ziel idealerweise mit einem Klick zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Vorbemerkung
- 1.2. Motivation
- 1.3. Zielsetzung
- 1.4. Struktur
- 2. Grundlagen
- 2.1. Ubiquitous Computing
- 2.2. Service Discovery
- 2.3. Kontextbegriff
- 2.3.1. Was ist Kontext?
- 2.3.2. Kontext in der Informatik
- 2.3.3. Arten von Kontext
- 2.3.4. Context-Awareness
- 2.3.5. Kontextmodellierung
- 3. Existierende Ansätze und Architekturen
- 3.1. Beschreibung existierender Ansätze und Architekturen
- 3.1.1. Service Discovery
- 3.1.1.1. Traditionelle Service Discovery
- 3.1.1.2. Context-Aware Service Discovery
- 3.1.1.3. Ontology-Based Service Discovery
- 3.1.2. Kontextmodellierung
- 3.1.2.1. Key-Value Modelle
- 3.1.2.2. Markup Schema Modelle
- 3.1.2.3. Grafische Modelle
- 3.1.2.4. Objektorientierte Modelle
- 3.1.2.5. Logikbasierte Modelle
- 3.1.2.6. Ontologiebasierte Modelle
- 3.1.3. Context-Awareness
- 3.1.3.1. Frameworks
- 3.1.3.2. Anwendungen
- 3.2. Bewertung relevanter Architekturen
- 4. Realisierung
- 4.1. Gewählter Ansatz
- 4.2. Die Architektur - CASPAR
- 4.3. Beispielimplementierung
- 4.3.1. Kontextmodell
- 4.3.2. Service Discovery Protokoll
- 4.3.3. CASPAR Directory Service
- 4.3.4. CASPAR Web Service
- 4.3.5. CASPAR Client Applikation
- 4.4. Interaktion der Komponenten
- 5. Fazit
- 5.1. Ergebnisse
- 5.2. Ausblick
- Ubiquitous Computing und seine Auswirkungen auf die Dienstevermittlung
- Kontextbegriff und seine Bedeutung für die Entwicklung kontextbasierter Systeme
- Existierende Ansätze zur Kontextmodellierung und Service Discovery
- Entwicklung einer eigenen Architektur für die kontextbasierte Dienstevermittlung
- Bewertung der Architektur und deren Implementierung
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel stellt das Thema der Diplomarbeit vor und erläutert die Motivation und Zielsetzung. Außerdem wird die Struktur der Arbeit dargelegt.
- Kapitel 2: Grundlagen: In diesem Kapitel werden die Grundlagen des Ubiquitous Computing, der Service Discovery und des Kontextbegriffs behandelt. Es werden verschiedene Arten von Kontext, Context-Awareness und Kontextmodellierung erläutert.
- Kapitel 3: Existierende Ansätze und Architekturen: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Ansätzen und Architekturen, die im Bereich der Service Discovery, Kontextmodellierung und Context-Awareness existieren. Es werden verschiedene Modelle und Frameworks vorgestellt und bewertet.
- Kapitel 4: Realisierung: Dieses Kapitel beschreibt die Realisierung einer Architektur für die kontextbasierte Dienstevermittlung. Es wird der gewählte Ansatz vorgestellt, die Architektur CASPAR erläutert und eine Beispielimplementierung diskutiert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Entwurf und der Umsetzung einer Architektur zur kontextbasierten Dienstevermittlung. Ziel ist es, eine Architektur zu entwickeln, die es ermöglicht, Dienste basierend auf dem Kontext des Benutzers und seiner Umgebung zu finden und bereitzustellen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Ubiquitous Computing, Service Discovery, Kontext, Context-Awareness, Kontextmodellierung, Architektur, CASPAR, Dienstevermittlung, Beispielimplementierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Ubiquitous Computing?
Es beschreibt die Vision einer Welt, in der Computer allgegenwärtig sind, aber nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen werden, sondern intelligent und unsichtbar vernetzt sind.
Was bedeutet "Context-Awareness" in der Informatik?
Context-Awareness bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, Informationen über seine Umgebung und die Situation des Nutzers zu erfassen und sein Verhalten daran anzupassen.
Was ist das Ziel der CASPAR-Architektur?
CASPAR ist eine Architektur zur kontextbasierten Dienstevermittlung, die es dem Nutzer ermöglichen soll, relevante Dienste situationsabhängig idealerweise mit nur einem Klick zu finden.
Welche Arten von Kontextmodellen gibt es?
Es gibt verschiedene Ansätze wie Key-Value-Modelle, Markup-Schema-Modelle, objektorientierte Modelle und ontologiebasierte Modelle.
Warum ist Service Discovery im Ubiquitous Computing wichtig?
Da Geräte hochspezialisiert und mobil sind, müssen Dienste automatisch und ohne manuellen Aufwand des Nutzers gefunden werden, um die Leistungsfähigkeit zu maximieren.
- Quote paper
- Nils Krüger (Author), 2006, Entwurf und Umsetzung einer Architektur zur kontextbasierten Dienstevermittlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72823