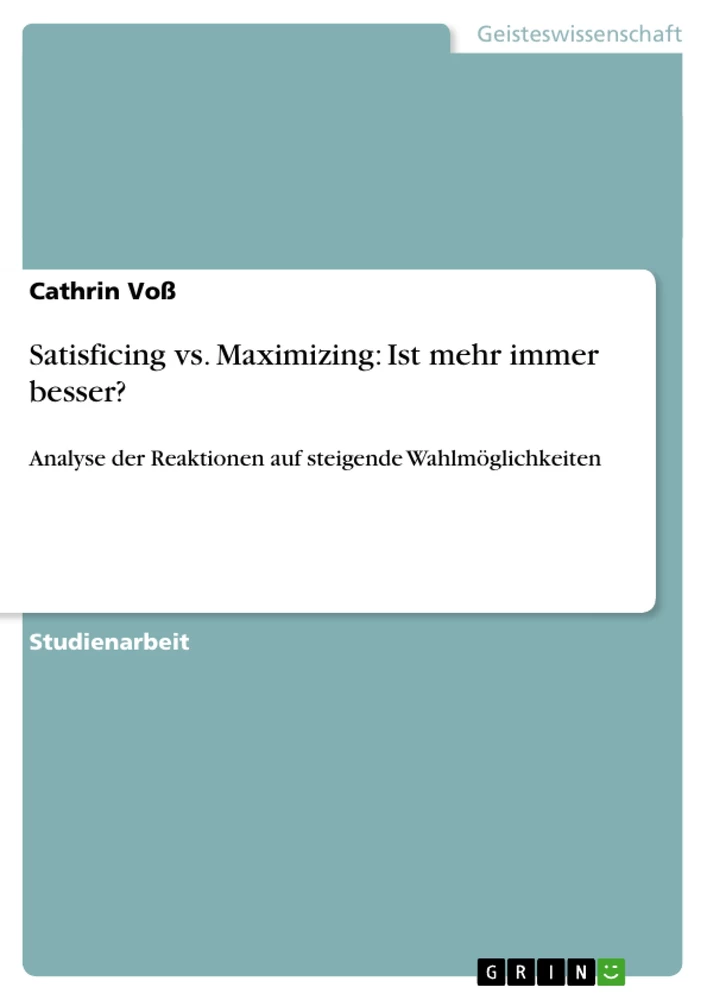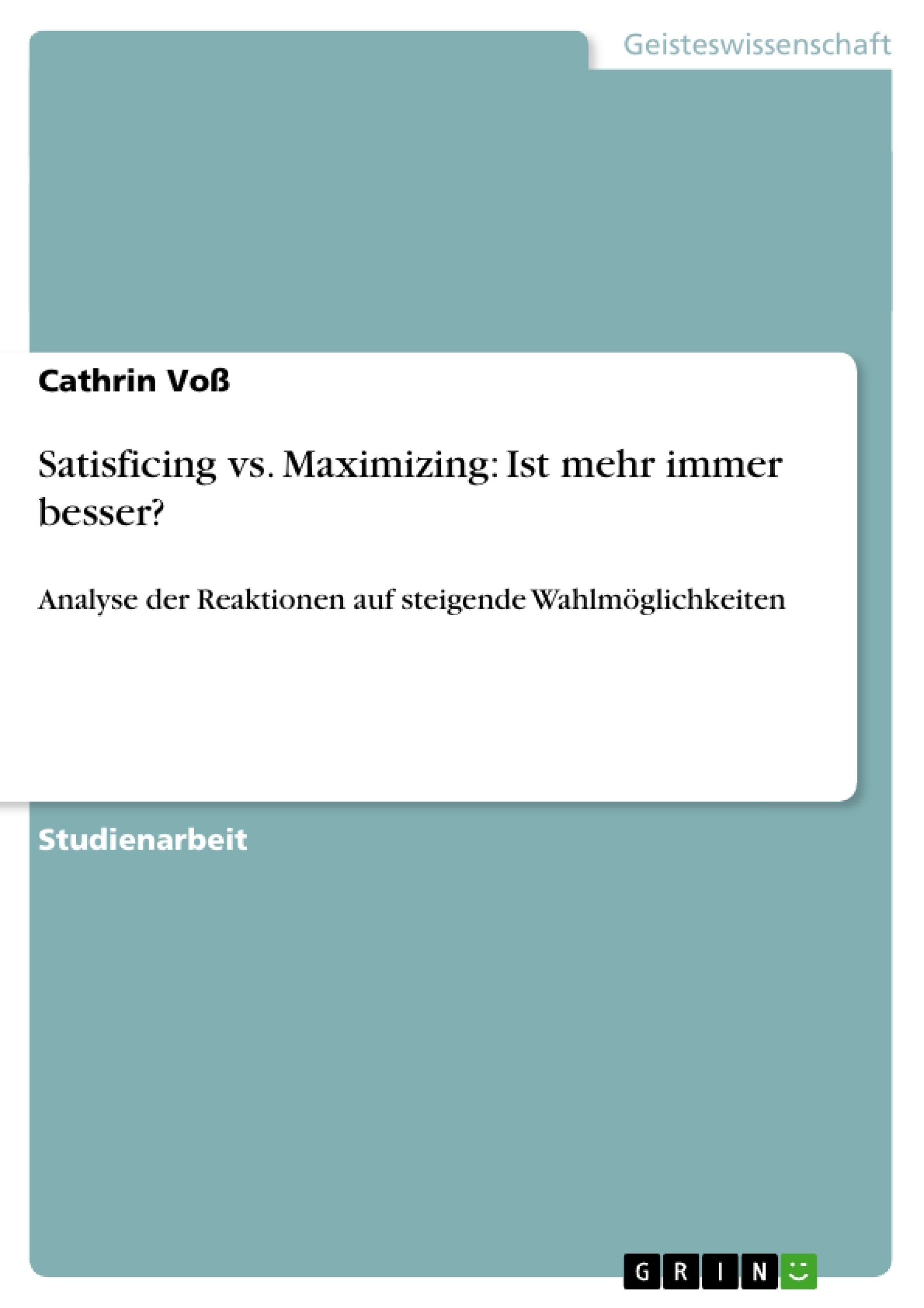Unser tägliches Leben besteht aus hunderten von Entscheidungen.
Diese reichen von der morgendlichen Kleiderwahl über verschiedene Menüs in der Kantine bis zum abendlichen Fernsehprogramm. Auswahlstress steht an der Tagesordnung.
Der durchschnittliche deutsche Supermarkt bot seinen Kunden bereits im Jahr 2003 eine Auswahl aus rund 12.000 Artikeln an – etwa 1,6-mal mehr als noch zehn Jahre zuvor - Tendenz steigend. Trotzdem scheinen die Umsätze mit dem stetig wachsenden Angebot zu sinken. Discounter wie Aldi oder Lidl, die weit weniger umfassende Sortimente anbieten, verzeichnen dagegen Rekordumsätze (Kliger, Messner & Niemeier, 2003).
Auch in anderen Lebensbereichen scheint die Optionsvielfalt die Menschen langsam aber sicher zu überfordern. Bücher, in denen das Sprichwort „weniger ist mehr“ als Lebensmaxime gepriesen wird, sind aus den Bestsellerlisten nicht mehr wegzudenken.
Eigentlich verwunderlich, denn insbesondere in westlichen Kulturen, in denen das Streben nach (Wahl-) Freiheit als Grundbedürfnis angesehen wird, ist die Auffassung weit verbreitet, dass mehr auch automatisch besser sein muss (z.B. Iyengar & Lepper, 1999).
Kann es also wirklich sein, dass mit zunehmender Optionsvielfalt die Unzufriedenheit steigt? Oder brauchen wir bei unserem täglichen Einkauf tatsächlich die Auswahl aus 100 Sorten Kaffee und 30 Sorten Toilettenpapier, damit wir glücklich sind?
Dieser Fragestellung soll im Verlauf der vorliegenden Seminararbeit auf den Grund gegangen werden. Dazu werden zunächst zwei Entscheidungstypen definiert, die sich hinsichtlich der Zielsetzung ihrer Entscheidung und ihrer Reaktion auf steigende Wahlmöglichkeiten unterscheiden. Anschließend wird anhand verschiedener aktueller Studien gezeigt, dass mehr Auswahl auch negative Folgen haben kann und worin die Gründe hierfür liegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundpositionen der Entscheidungsforschung
- 2.1. Der homo oeconomicus
- 2.2. Die bounded rationality nach Simon
- 2.3. Die Maximization Scale nach Schwartz et al.
- 3. Auswirkungen ansteigender Wahloptionen
- 3.1. Ist mehr immer besser?
- 3.2. Konsequenzen für den Satisficer
- 3.3. Konsequenzen für den Maximizer
- 4. Zusammenhang zwischen Maximierungstendenz und anderen psychologischen Konstrukten
- 4.1. Bedauern
- 4.2. Informations- und Opportunitätskosten
- 4.3. Soziale Vergleiche
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Auswirkungen steigender Wahlmöglichkeiten auf die Zufriedenheit von Individuen. Sie vergleicht zwei Entscheidungstypen – Maximierer und Satisficer – und analysiert deren unterschiedliche Reaktionen auf eine wachsende Auswahl an Optionen. Die Arbeit beleuchtet den Widerspruch zwischen dem in westlichen Kulturen verbreiteten Glauben, dass „mehr immer besser“ ist, und der empirischen Beobachtung, dass Überangebot zu Unzufriedenheit führen kann.
- Der Vergleich von Maximierungs- und Satisficing-Strategien
- Die Auswirkungen einer zunehmenden Anzahl von Wahlmöglichkeiten auf die Entscheidungsfindung
- Die Rolle von Informationskosten und Opportunitätskosten bei der Entscheidungsfindung
- Der Einfluss sozialer Vergleiche auf die Zufriedenheit mit getroffenen Entscheidungen
- Die kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept des „homo oeconomicus“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Auswirkungen steigender Wahlmöglichkeiten auf die Zufriedenheit. Sie veranschaulicht anhand des Beispiels deutscher Supermärkte, wie ein wachsendes Angebot nicht zwangsläufig zu höheren Umsätzen führt, und beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Wahlfreiheit und der Überforderung durch eine zu große Auswahl. Die Arbeit kündigt die Definition von zwei Entscheidungstypen – Maximierer und Satisficer – an und beschreibt den weiteren Aufbau der Arbeit.
2. Grundpositionen der Entscheidungsforschung: Dieses Kapitel präsentiert zwei gegensätzliche Ansätze der Entscheidungsforschung: das Modell des „homo oeconomicus“, das von perfekter Rationalität und Nutzenmaximierung ausgeht, und Simons Konzept der „bounded rationality“, welches die begrenzte Informationsverarbeitungskapazität des Menschen berücksichtigt und das Satisficing als Entscheidungsstrategie einführt. Der „homo oeconomicus“ strebt stets nach der optimalen Lösung, während der Satisficer sich mit einer befriedigenden Lösung zufrieden gibt. Der Unterschied dieser beiden Modelle bildet die Grundlage für die weitere Analyse der Auswirkungen ansteigender Wahloptionen.
Schlüsselwörter
Satisficing, Maximierung, Entscheidungsfindung, bounded rationality, homo oeconomicus, Wahlmöglichkeiten, Optionsvielfalt, Zufriedenheit, Informationskosten, Opportunitätskosten, soziale Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Auswirkungen steigender Wahlmöglichkeiten auf die Zufriedenheit
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Auswirkungen einer zunehmenden Anzahl von Wahlmöglichkeiten auf die Zufriedenheit von Individuen. Im Fokus steht der Vergleich zwischen zwei Entscheidungstypen – Maximierer und Satisficer – und deren unterschiedliche Reaktionen auf ein wachsendes Angebot an Optionen.
Welche Entscheidungstypen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht Maximierer, die stets nach der optimalen Lösung streben, mit Satisficern, die sich mit einer befriedigenden Lösung zufrieden geben. Dieser Vergleich bildet die Grundlage für die Analyse der Auswirkungen steigender Wahlmöglichkeiten.
Welche Modelle der Entscheidungsforschung werden betrachtet?
Die Arbeit diskutiert das Modell des „homo oeconomicus“, das von vollkommener Rationalität und Nutzenmaximierung ausgeht, und Simons Konzept der „bounded rationality“, welches die begrenzten kognitiven Fähigkeiten des Menschen berücksichtigt und das Satisficing als Entscheidungsstrategie einführt.
Welche Aspekte beeinflussen die Zufriedenheit mit Entscheidungen?
Die Zufriedenheit mit Entscheidungen wird in der Arbeit im Kontext von steigenden Wahlmöglichkeiten untersucht. Dabei werden die Rolle von Informationskosten, Opportunitätskosten und sozialen Vergleichen berücksichtigt. Die Arbeit hinterfragt auch den in westlichen Kulturen verbreiteten Glauben, dass „mehr immer besser“ ist.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundpositionen der Entscheidungsforschung (homo oeconomicus vs. bounded rationality), ein Kapitel zu den Auswirkungen ansteigender Wahloptionen auf Maximierer und Satisficer, ein Kapitel zum Zusammenhang zwischen Maximierungstendenz und anderen psychologischen Konstrukten (Bedauern, Informations- und Opportunitätskosten, soziale Vergleiche) und ein Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Satisficing, Maximierung, Entscheidungsfindung, bounded rationality, homo oeconomicus, Wahlmöglichkeiten, Optionsvielfalt, Zufriedenheit, Informationskosten, Opportunitätskosten und soziale Vergleiche.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie beeinflussen steigende Wahlmöglichkeiten die Zufriedenheit von Individuen, und wie unterscheiden sich Maximierer und Satisficer in ihren Reaktionen auf ein wachsendes Angebot an Optionen?
Wie wird der scheinbare Widerspruch zwischen Wahlfreiheit und Überforderung durch zu große Auswahl behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Widerspruch zwischen dem in westlichen Kulturen verbreiteten Glauben, dass „mehr immer besser“ ist, und der empirischen Beobachtung, dass Überangebot zu Unzufriedenheit führen kann. Dieser Widerspruch wird anhand von Beispielen (z.B. deutsche Supermärkte) veranschaulicht und analysiert.
- Quote paper
- Cathrin Voß (Author), 2007, Satisficing vs. Maximizing: Ist mehr immer besser?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72916