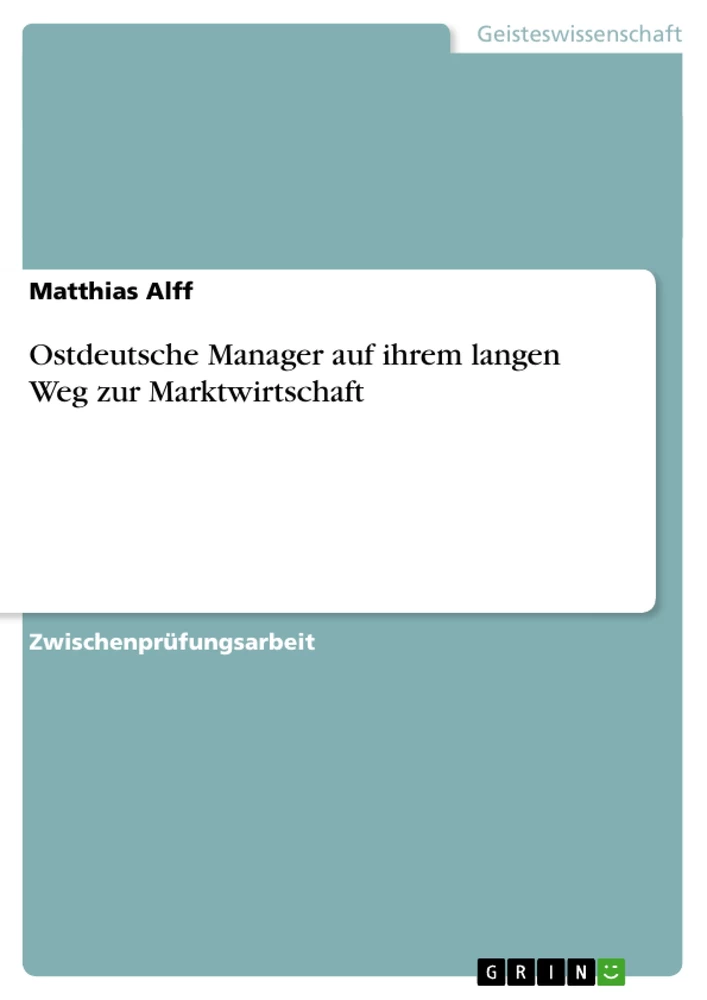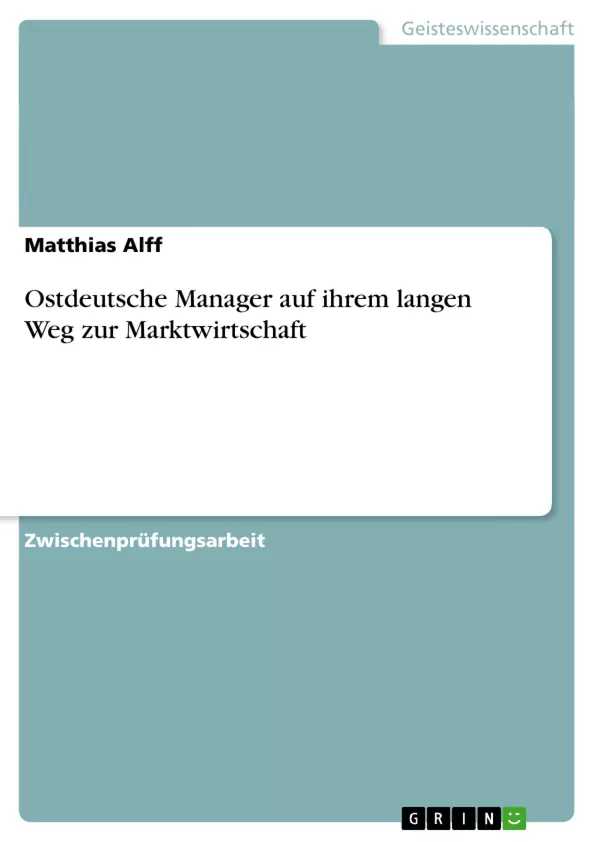Im Laufe des Transformationsprozesses entstanden bekanntermaßen ökonomische und soziale Probleme, die bis heute niemand zu lösen vermochte. Im Gegenteil, sie weiteten sich aus von den neuen Bundesländern (NBL) auf die gesamte Bundesrepublik.
Es gelang nicht nur nicht im Osten eine solide wirtschaftliche Basis zu schaffen, nebenher wächst auch die aus der stetig größer werdenden Arbeitslosigkeit resultierende Existenzangst der Bürger. Was für nunmehr 4,346 Mio. Arbeitslose im vierzehnten Jahr nach der Wiedervereinigung immer noch keine positive Wendung genommen hat, ist für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ein reiner Glücksfall, man befindet sich inmitten eines sozialen Großexperiments: Zwei theoretisch konträre Wirtschaftsformen verschmelzen durch die Expansion der Marktwirtschaft. Nicht nur die ökonomischen Unterschiede bieten da für Generationen von Wissenschaftlern ausreichend Forschungsmaterial. Natürlich ist eine ganze Reihe von Theorien entstanden, die die empirischen Daten fassbar machen und erklären wollen. Zwei verschiedene Argumentationsrichtungen zur Erklärung der anhaltenden Wirtschaftsflaute in den NBL sollen hier kritisch betrachtet werden. Sie eignen sich deshalb hervorragend für eine solche Arbeit, weil sie in ihrer Argumentation von zwei äußerst verschiedenen Punkten ausgehen.
Zum einen wird versucht, die Problematik mit dem Hauptaugenmerk auf die Akteure zu erklären, zum anderen sieht man einen deterministischen Zusammenhang zwischen der un-
hinterfragten Übernahme der westlichen Institutionen im Osten Deutschlands und der dortigen Deindustrialisierung. Beide Argumentationen scheinen plausibel, doch sind sie auch ausreichend? Benennen sie wirklich alle wirkenden Faktoren?
Jede für sich sicherlich nicht, allerdings zusammengenommen erhalten sie ein enormes Erklärungspotenzial.
Diese Arbeit versucht, die scheinbar unvereinbaren Theorien dahingehend zu überprüfen, ob sich nicht ein weniger polarisierter Ansatz besser eignet, ob nicht beide Richtungen zusammengenommen, der Problematik gerechter werden würden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die zwei Betrachtungsweisen
- Akteursbezogene Erklärungsweise
- Erklärungsansatz durch Institutionentransfer
- Der real existierende Sozialismus
- Habitus des sozialistischen Menschen
- Die Wiedervereinigung
- Fakten, Daten, Entwicklungen
- Folgen
- Manageriales Handeln und „Hysteresiseffekte“
- Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der ökonomischen und sozialen Transformation Ostdeutschlands nach der Wiedervereinigung. Sie untersucht die anhaltende Wirtschaftsflaute in den neuen Bundesländern und analysiert zwei verschiedene Erklärungsansätze: die akteursbezogene Betrachtungsweise und den Ansatz des Institutionentransfers.
- Analyse der ökonomischen und sozialen Probleme in den neuen Bundesländern
- Bewertung der zwei dominanten Erklärungsansätze für die Wirtschaftsflaute
- Untersuchung des „sozialistischen Habitus“ und seiner Auswirkungen auf den Transformationsprozess
- Beurteilung des Einflusses von westdeutschen Institutionen und Marktinstrumentarien auf die ostdeutsche Wirtschaft
- Kritik an der Unfähigkeit ostdeutscher Manager im Kapitalismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der anhaltenden Wirtschaftsflaute in den neuen Bundesländern dar und führt die beiden betrachteten Erklärungsansätze ein.
- Die zwei Betrachtungsweisen: Dieses Kapitel stellt die akteursbezogene Erklärungsweise und den Ansatz des Institutionentransfers vor und beleuchtet deren Argumente und Stärken.
- Der real existierende Sozialismus: Das Kapitel beschreibt die Bedingungen und Irrationalitäten der Planwirtschaft und beleuchtet die Aufgaben des „sozialistischen Menschen“.
- Habitus des sozialistischen Menschen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Beschreibung des Kontrastes zwischen sozialistischer Arbeitskultur und den Anforderungen der kapitalistischen Produktionsform. Es stellt die Frage nach dem Einfluss der „sozialistischen Sozialisierung“ auf die Anpassungsfähigkeit ostdeutscher Manager.
- Die Wiedervereinigung: Dieses Kapitel behandelt die Fakten, Daten und Entwicklungen nach der Wiedervereinigung und beleuchtet die Folgen für die ostdeutsche Wirtschaft. Es analysiert das manageriale Handeln und die „Hysteresiseffekte“ im Transformationsprozess.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die ökonomische und soziale Transformation in Ostdeutschland, die Wirtschaftsflaute in den neuen Bundesländern, die akteursbezogene Erklärungsweise, den Ansatz des Institutionentransfers, den „sozialistischen Habitus“, die Arbeitskultur und die Anpassungsfähigkeit ostdeutscher Manager an die Anforderungen der Marktwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum gab es nach der Wiedervereinigung eine anhaltende Wirtschaftsflaute im Osten?
Die Arbeit diskutiert zwei Hauptgründe: Zum einen das Handeln der Akteure (ostdeutsche Manager) und zum anderen den schnellen Transfer westlicher Institutionen, der zu einer massiven Deindustrialisierung führte.
Was versteht man unter dem „sozialistischen Habitus“?
Der sozialistische Habitus beschreibt die durch die Planwirtschaft geprägten Denk- und Verhaltensmuster der Menschen, die oft im Kontrast zu den Anforderungen der kompetitiven Marktwirtschaft standen.
Welche Rolle spielte der Institutionentransfer bei der Transformation?
Die unhinterfragte Übernahme westdeutscher Gesetze und Marktinstrumente (Institutionentransfer) schuf zwar einen stabilen Rahmen, überforderte aber viele ostdeutsche Betriebe, die dem plötzlichen Wettbewerb nicht gewachsen waren.
Waren ostdeutsche Manager unfähig für den Kapitalismus?
Kritiker warfen ihnen mangelnde Anpassungsfähigkeit vor. Die Arbeit relativiert dies jedoch, indem sie die irrationalen Bedingungen der Planwirtschaft und die Hysteresiseffekte im Transformationsprozess einbezieht.
Was sind „Hysteresiseffekte“ in diesem Kontext?
In der Wirtschaftswissenschaft beschreiben Hysteresiseffekte das Phänomen, dass einmal eingetretene Zustände (wie hohe Arbeitslosigkeit) auch dann fortbestehen, wenn die ursprünglichen Ursachen bereits beseitigt wurden.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Matthias Alff (Autor:in), 2005, Ostdeutsche Manager auf ihrem langen Weg zur Marktwirtschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72985