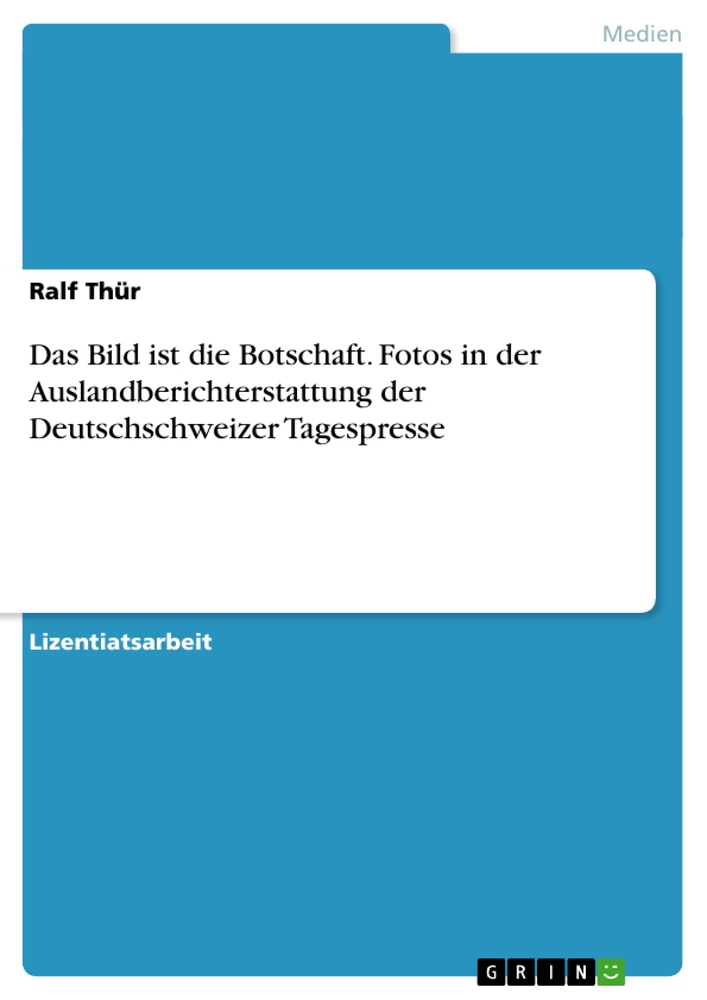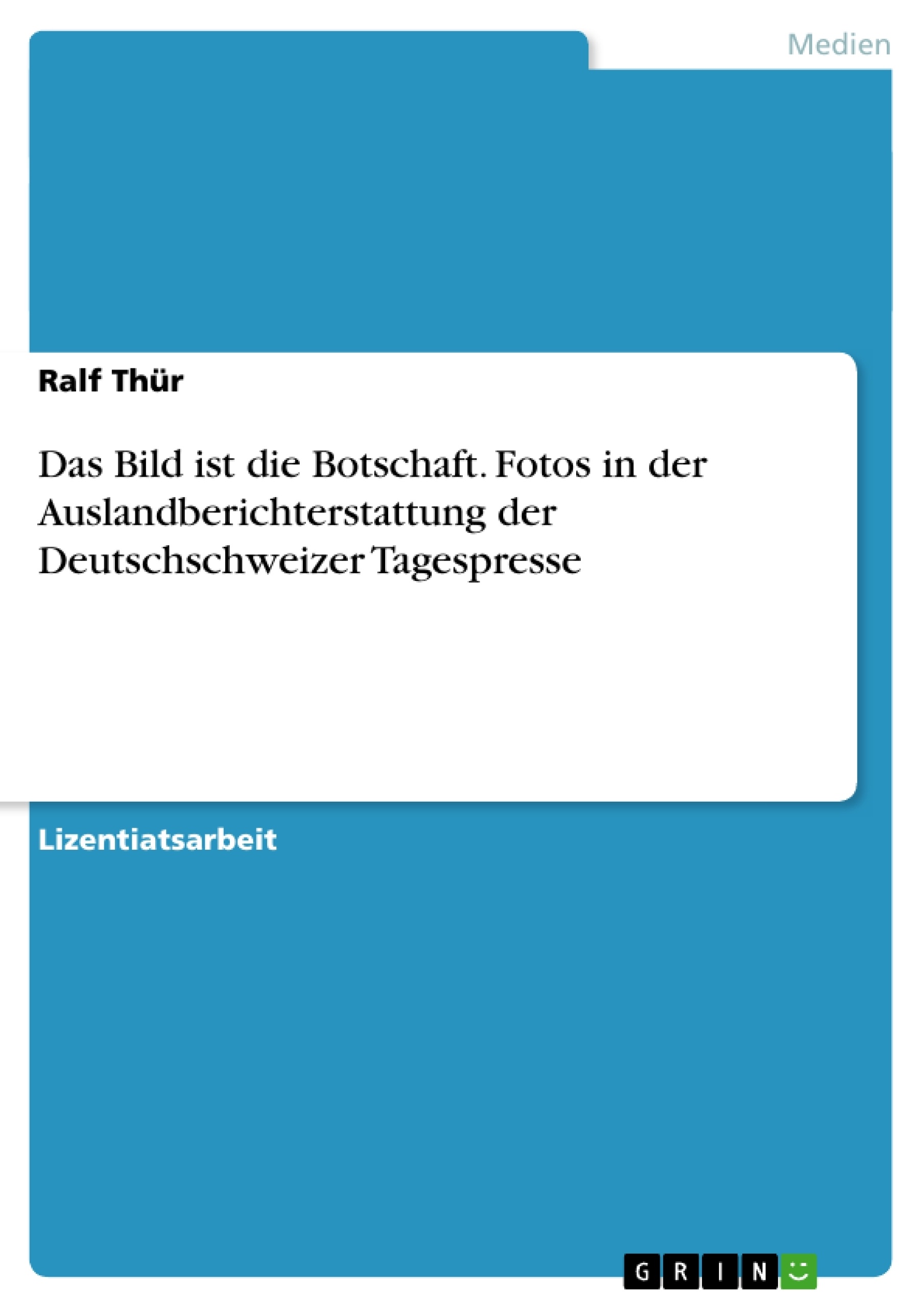Die Medien verbreiten Bilder, sie wählen die Bilder aus, die die Welt betrachtet und bestimmen damit, was wahrgenommen wird. Wie stark sich das Zeitungslayout bis heute gewandelt hat und ohne das Wissen einer bevorstehenden Kommerzialisierung des Internet, bestätigt eine bereits 1992 gemachte Äusserung des amerikanischen Zeitungsdesigners Mario Garcia in der Zeitschrift Klartext: „Die Zeitung des Jahres 2000 muss meiner Meinung nach auch ein wenig Fernsehen, ein wenig Radio, ein wenig Magazin sein“ (Fuchs 1992: o.S.).
Dem Element „Pressebild“ kommt im täglichen Kampf um die Aufmerksamkeit der Leser sowie in Zeiten der Visualisierung der Rezeptionsgewohnheiten eine entscheidende Rolle zu. In Anlehnung an das „Gründungsmotto“ der Medienwissenschaft „the medium is the message“ von Marshall McLuhan (1994: 23), ist für Marion Müller das Bild „die eigentliche Botschaft“ (Müller 1997: 289). Verschiedene Studien, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, belegen die überragende Bedeutung der Bildberichterstattung in den Zeitungen. Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser steigen in den Text oft über ein Bild ein. Mit der verkürzenden Formel „am Anfang war das Bild“ bringt Thomas Hartmann diesen Umstand auf den Punkt (Hartmann 1995: 32).
Die vorliegende Arbeit will in diesem Spannungsfeld ihren Beitrag leisten und analysiert, ausgehend vom konkreten materiellen Pressebild, den Visualisierungstrend der Zeitungsinhalte quantitativ sowie qualitativ in der Deutschschweizer Tagespresse von 1969 bis heute anhand des Ressorts Ausland. Die Untersuchung umfasst verschiedene Elemente und Mittel, die beim Einsatz der Bilder angewandt werden, formal und inhaltlich. Mit Hilfe eines quantifizierenden, inhaltsanalytischen Verfahrens werden verschiedene Ebenen, die die Visualisierung umfasst, und die die Bildinformation bietet, untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrund und Kontext
- Mediengeschichte
- Bildjournalismus im technisch-strukturellen Wandel
- Zeitungsdesign und Layout im Wandel
- Dynamisierung des Umbruchs
- Nachrichtenagenturen und Bildagenturen
- Fokus auf Pressebildagenturen
- Bildbegriff und Bildtypen
- Merkmale des Pressefotos
- Funktionen des Bildes
- Berufsbild Bildjournalist, Aufgaben und Aufträge
- Berufsethik und Presserat
- Modelle und Systematisierungen
- Ressort Ausland
- Regionalismus
- Emotionalisierung
- Personalisierung
- Negativismus
- Routineprogrammierung
- Theoretischer Teil
- Eingrenzung des Themas
- Gesellschaftliche Relevanz
- Probleme und kritische Merkmale
- Zentrale Begriffe
- Zeitung
- Ereignis
- Konflikte und Krisensituationen
- Theoretische Perspektiven
- Der formal-deskriptive Ansatz
- Nachrichtenwert-Theorie
- Die ikonografisch-ikonologische Methode
- Kritische Bemerkungen zur ikonografischen Bildanalyse
- Abgrenzung von anderen Konzepten
- Desiderata beim heutigen Wissensstand
- Überblick Forschungsstand
- Fragestellung
- Strukturierung der Fragestellung
- Kontext Form
- Kontext Quelle
- Kontext Inhalt
- Hypothesenbildung
- Kontext Form
- Kontext Quelle
- Kontext Inhalt
- Empirie und methodisches Vorgehen
- Forschungsmethode
- Untersuchungsanlage
- Untersuchungseinheit
- Untersuchungsobjekt
- Entwicklung des Codebuches
- Einzelne Dimensionen
- Reliabilität und Validität
- Definition des Samples
- Details zum Messverfahren
- Pretest
- Datenerhebung und Feldzugang
- Datenaufbereitung
- Datenauswertung
- Untersuchungsgegenstand
- Zeitungstitel im Kurzporträt
- Blick
- Der Bund
- Neue Zürcher Zeitung NZZ
- St. Galler Tagblatt
- Südostschweiz (ehemals Bündner Zeitung)
- Tages-Anzeiger
- Zürcher Oberländer
- Ergebnisse und Befunde
- Kontext Form
- Fragestellung H1
- Fragestellung H2
- Fragestellung H3
- Fragestellung H4
- Fragestellung H5
- Fragestellung H6
- Fragestellung H7
- Kontext Quelle
- Fragestellung H8
- Fragestellung H9
- Fragestellung H10
- Fragestellung H11
- Kontext Inhalt
- Fragestellung H12
- Fragestellung H13
- Fragestellung H15
- Fragestellung H16
- Zusammenfassung eigener Befunde
- Zusammenfassung Kontext Form (H1 bis H7)
- Zusammenfassung Kontext Quelle (H8 bis H11)
- Zusammenfassung Kontext Inhalt (H12 bis H16)
- Resümee
- Untersuchungsanlage und Fragestellung
- Auswertung der Hypothesen und Ergebnisse
- Kritische Reflexion und Dank
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Ergänzende Quellen
- Agenturen
- Politische und geografische Informationen, Studien
- Journalismus, Zeitungsdesign
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Lizentiatsarbeit befasst sich mit der Verwendung von Fotos in der Auslandberichterstattung der Deutschschweizer Tagespresse. Die Arbeit analysiert den Wandel des Bildjournalismus im Kontext des technisch-strukturellen Wandels der Medienlandschaft und beleuchtet die Rolle von Bildern in der Konstruktion von Nachrichten. Dabei werden die spezifischen Merkmale des Pressefotos, die Funktionen des Bildes in der Nachrichtenvermittlung sowie die ethischen Aspekte des Bildjournalismus untersucht.
- Bildjournalismus im Wandel der Medienlandschaft
- Die Rolle von Fotos in der Konstruktion von Nachrichten
- Merkmale und Funktionen des Pressefotos
- Ethische Aspekte des Bildjournalismus
- Analyse der Fotos in der Auslandberichterstattung der Deutschschweizer Tagespresse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert den Forschungsstand sowie die Fragestellung. Kapitel 2 beleuchtet den Hintergrund und Kontext der Arbeit, indem es die Mediengeschichte, den technisch-strukturellen Wandel des Bildjournalismus, das Zeitungsdesign, die Rolle von Nachrichtenagenturen und Bildagenturen sowie den Bildbegriff und die Bildtypen diskutiert. Kapitel 3 analysiert verschiedene Modelle und Systematisierungen des Bildjournalismus, darunter das Ressort Ausland, den Regionalismus, die Emotionalisierung, die Personalisierung, den Negativismus und die Routineprogrammierung. Der theoretische Teil in Kapitel 4 untersucht die gesellschaftliche Relevanz des Themas, problematisiert kritische Merkmale, definiert zentrale Begriffe und diskutiert verschiedene theoretische Perspektiven, darunter den formal-deskriptiven Ansatz, die Nachrichtenwert-Theorie, die ikonografisch-ikonologische Methode sowie kritische Bemerkungen zur ikonografischen Bildanalyse. Kapitel 5 formuliert die Fragestellung der Arbeit und stellt die Hypothesen vor. Kapitel 6 beschreibt die Empirie und das methodische Vorgehen der Untersuchung. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse und Befunde der Untersuchung, gegliedert nach den verschiedenen Fragestellungen und Kontexten. Die Zusammenfassung in Kapitel 8 fasst die zentralen Ergebnisse und Befunde zusammen und reflektiert die Ergebnisse kritisch.
Schlüsselwörter
Bildjournalismus, Auslandberichterstattung, Deutschschweizer Tagespresse, Fotos, Nachrichten, Bildanalyse, Ikonografie, Nachrichtenwert, Mediengeschichte, Technik, Strukturwandel, Zeitungsdesign, Nachrichtenagenturen, Bildagenturen, Berufsethik, Presserat, Regionalismus, Emotionalisierung, Personalisierung, Negativismus, Routineprogrammierung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Das Bild ist die Botschaft" im Journalismus?
In Anlehnung an McLuhan bedeutet dies, dass das Pressefoto oft den ersten und stärksten Eindruck vermittelt und den Einstieg in den Text steuert.
Wie hat sich das Zeitungsdesign seit 1969 verändert?
Es gab einen starken Trend zur Visualisierung, wobei Zeitungen heute Elemente von Magazinen und Fernsehen integrieren, um Aufmerksamkeit zu gewinnen.
Welche Rolle spielen Bildagenturen für die Tagespresse?
Bildagenturen sind die zentralen Lieferanten für die Auslandberichterstattung und beeinflussen durch ihre Auswahl, was die Welt wahrnimmt.
Was sind die ethischen Herausforderungen im Bildjournalismus?
Fragen der Berufsethik und die Richtlinien des Presserats sind entscheidend, um Manipulationen und Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu vermeiden.
Warum wird in der Auslandberichterstattung oft personalisiert?
Personalisierung und Emotionalisierung sind Nachrichtenwerte, die komplexe globale Ereignisse für den Leser greifbarer und interessanter machen.
- Quote paper
- Ralf Thür (Author), 2006, Das Bild ist die Botschaft. Fotos in der Auslandberichterstattung der Deutschschweizer Tagespresse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72997