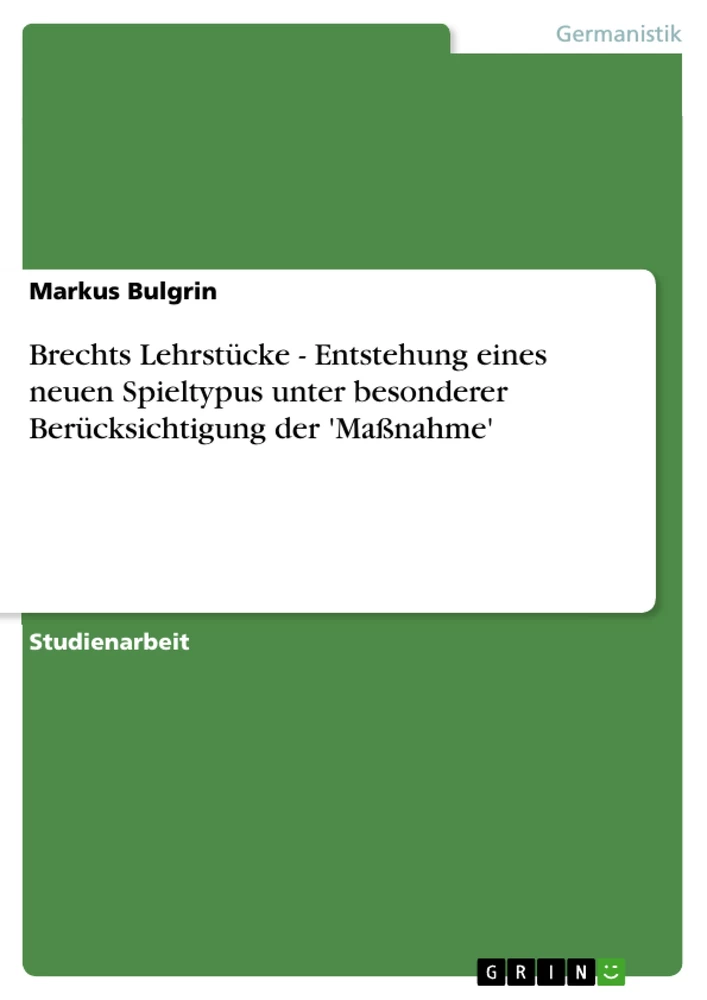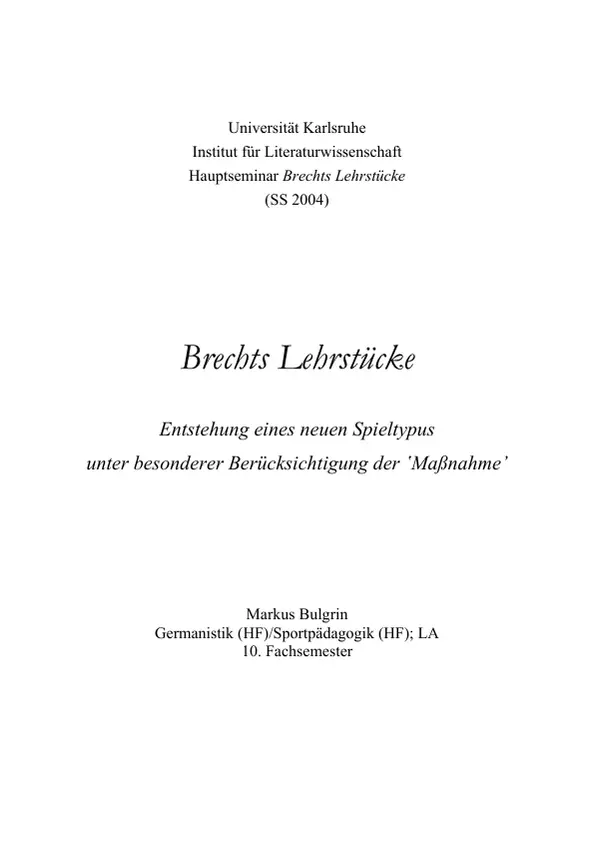Der Ursprung des Begriffs ‘Lehrstück’ ist bis heute unklar. Weder lässt sich der Terminus in Wörterbüchern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts finden, noch ist sicher geklärt, ob es sich tatsächlich um eine Brechtsche Wortschöpfung handelt. Brecht war es allerdings, der diesen „Missverständnisse provozierende[n] Begriff“ , der sich in vielen seiner Fragmente, Notizen und Berichte finden lässt, geläufig gemacht hatte. Erst als am 28. Juli 1929 im Rahmen der Festtage Deutsche Kammermusik Baden-Baden 1929 das Lehrstück von Brecht und dem Komponisten Hindemith (Brecht zeichnete sich für den Text, Hindemith für die Musik verantwortlich) uraufgeführt wurde, setzte sich der Terminus ‘Lehrstück’ als Begriff und bald schon als Schlagwort in der Musikkritik durch. Er bezeichnete seither ein neues musikalisches Genre, einen eigenen Spieltypus, der sich in Form, Ursprung und Verwendungszweck von den klassischen Theaterstücken unterschied und sich von seinem Verwendungszusammenhang her definierte: als pädagogisch motivierte Gebrauchskunst für Laien. Diesem damals neuartigen Spieltypus also widmet sich diese Arbeit, wobei auf die gerade angesprochene musikalische Komponente aus Platzgründen leider keine Rücksicht genommen werden kann. Auch hat dies nichts mit dem bis in die jüngste Vergangenheit gemachten Versäumnis der germanistischen Diskussion zu tun, die Musik als integralen Bestandteil der Lehrstücke anzuerkennen.
Herausgearbeitet werden soll vor allem der fast revolutionäre Charakter dieses neuen Spieltypus in einem von sozialen, gesellschaftlichen und vor allem wirtschaftlichen Umwälzungen geprägten, technischen Zeitalter, in dem auch der gesamte Kulturbetrieb krisenhaften Entwicklungen unterworfen war. Auch soll gezeigt werden, inwieweit die Technifizierung und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Menschen, aber auch die Kunst selbst beeinflusste.
Anhand der Maßnahme, sicherlich eines der umstrittensten Lehrstücke Brechts, sollen Lehrinhalte und Lernziele eines seiner Lehrstücke dargestellt und dabei gezeigt werden, dass es sich bei den Lehrstücken keinesfalls um starre Gebilde handelte, sondern Brecht immer wieder dazu bereit war, seine Texte auch selbstkritisch zu betrachten und ggf. zu ändern.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Entstehung des Lehrstücks – Die Kulturkrise der Zwanziger Jahre
- Brechts Kritik am bürgerlichen Theater und seine Philosophie eines neuen Spieltypus
- Das Lehrstück Die Maßnahme
- Die Erzählebene
- Die Maßnahme in der Kritik: Der Tod des jungen Genossen
- Vergleichende Textanalyse
- Brechts Lehrstücke: Heute noch zeitgemäß?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des Lehrstücks als einem neuartigen Spieltypus, der sich von den klassischen Theaterstücken deutlich unterscheidet. Sie untersucht Brechts Kritik am bürgerlichen Theater und seine Philosophie eines neuen Spieltypus, der dem Publikum ein aktives, kritisches und lernendes Verhältnis zum Theater ermöglicht. Der Fokus liegt auf den Lehrstücken im Kontext der Kulturkrise der zwanziger Jahre, wobei die „Maßnahme“ als eines der umstrittensten Lehrstücke exemplarisch analysiert wird.
- Die Kulturkrise der zwanziger Jahre
- Brechts Kritik am traditionellen Theater
- Die Entwicklung des Lehrstücks als pädagogisch motivierte Gebrauchskunst
- Die „Maßnahme“ als exemplarisches Lehrstück
- Die Bedeutung der Lehrstücke im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung des Lehrstücks im Kontext der Kulturkrise der zwanziger Jahre. Hier wird gezeigt, wie die sich wandelnden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Bedingungen sowohl die Musik als auch das Theater vor neue Herausforderungen stellten. Brechts Zusammenarbeit mit Komponisten der Neuen Musik, die sich von der Romantik des 19. Jahrhunderts abgrenzte, wird in diesem Zusammenhang hervorgehoben.
Kapitel zwei beschäftigt sich mit Brechts Kritik am bürgerlichen Theater und seiner Philosophie eines neuen Spieltypus. Brechts Forderungen nach einer „Gebrauchsmusik“ und einem Theater, das dem Publikum die Möglichkeit zum „Lernen“ bietet, werden hier analysiert.
Das dritte Kapitel untersucht das Lehrstück „Die Maßnahme“ im Detail. Die Erzählebene, die Kritik am Tod des jungen Genossen und die verschiedenen Versionen des Stückes werden analysiert und interpretiert. Dabei wird deutlich, wie Brecht seine Texte immer wieder selbstkritisch betrachtet und weiterentwickelt hat.
Schlüsselwörter
Lehrstück, Brecht, Kulturkrise, bürgerliches Theater, Gebrauchsmusik, „Die Maßnahme“, Vergleichende Textanalyse, Kritik, Selbstkritik, Musiktheater, neue Spielgattung, Pädagogik, Lernen, 20er Jahre, Gesellschaftliche Veränderungen.
- Arbeit zitieren
- Markus Bulgrin (Autor:in), 2004, Brechts Lehrstücke - Entstehung eines neuen Spieltypus unter besonderer Berücksichtigung der 'Maßnahme' , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73052