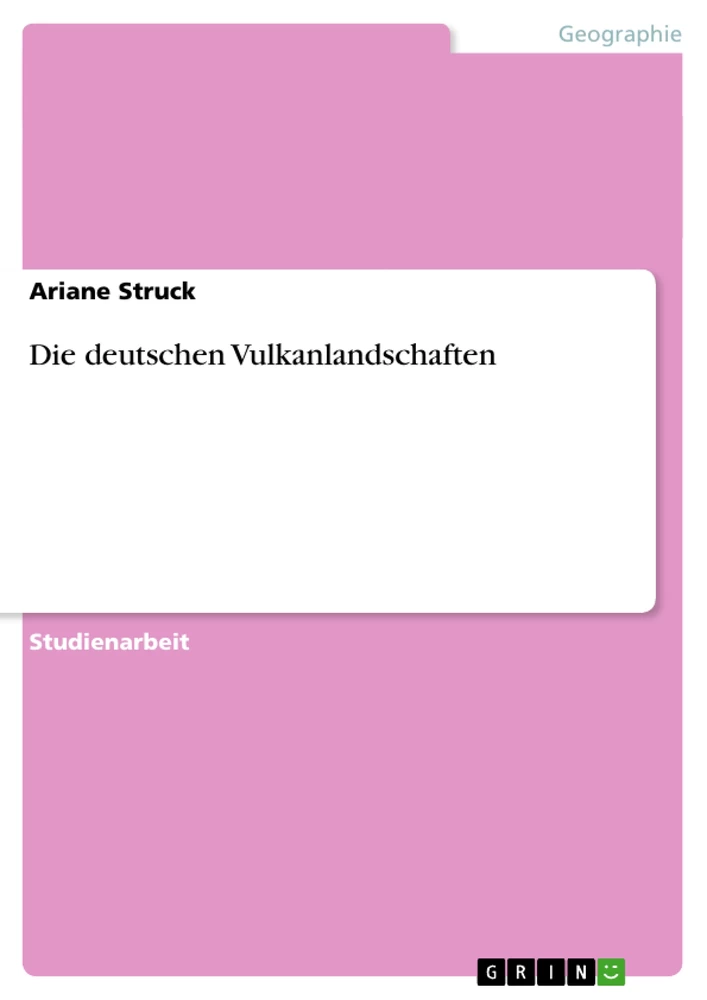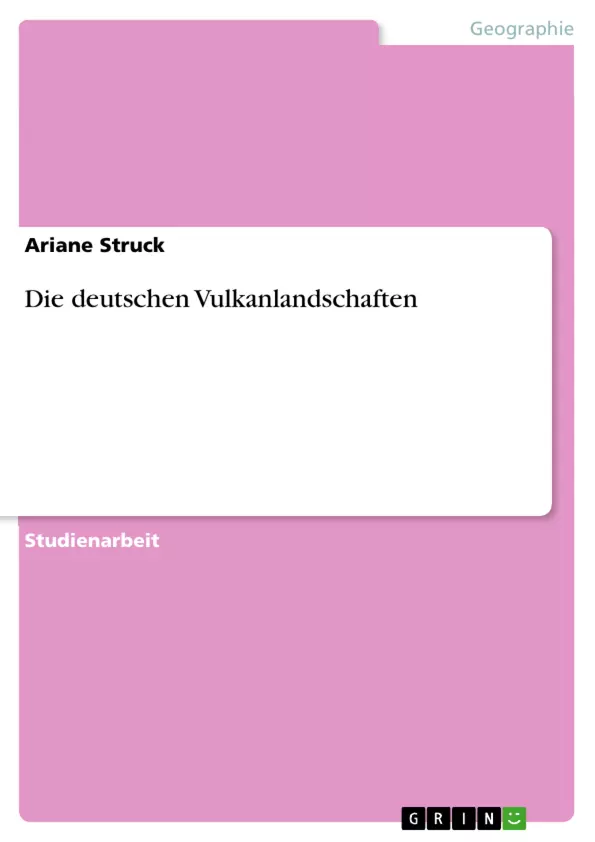Das mittlere Deutschland wird in einem West-Ost verlaufenden Gürtel vulkanischer Bildungen durchzogen.
Der Anfang dieses Bandes bildet im Westen die Vulkaneifel, nach Osten hin setzt es sich im Neuwieder Becken, im Siebengebirge, Westerwald, Vogelsberg, Knüll und der Basalt-Rhön, im Erzgebirge und als östlichster Punkt in der Lausitz fort. Nördlich vom Knüll sind vulkanische Gesteine in Nordhessen am Meißner und im Habichtswald (bei Kassel) vorzufinden.
Kleinere Einzelvorkommen vulkanischen Gesteins sind in Südniedersachsen, Westfalen und südöstlich der Rhön bei Gerolzhofen (Heldburger Gangschar = Gangfüllungen und Stiele von Basalten) anzutreffen. Weitere kleinere Einzelvorkommen von Basalten und Tuffen liegen im östlichen Fichtelgebirge, in der Oberpfalz, an der Fränkischen Linie (NW-SO Störung) bei Kemnath und bei Coburg + Bamberg.
Südlich des Mains sind vulkanische Gesteine nicht so weit verbreitet. Es handelt sich um Einzelvorkommen im Odenwald (am NO-Rand Gebiet von Groß-Umstadt, Otzberg im Zentralteil + Katzenbuckel im südöstl. Buntsandstein-Odenwald), und zahlreiche Schlotröhren bei Bad Urach-Kirchheim.
Bedeutendere vulkanische Aufkommen in diesem Gebiet sind der Kaiserstuhl und der Hegau (auf der Bruchzone zwischen Oberrheingraben und Bodensee im Teilstück "Bonndorfer Graben")
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick über die Entstehungsgeschichte des Vulkanismus in Deutschland
- Der tertiäre Vulkanismus
- Der quartäre Vulkanismus
- Deutsche Vulkanlandschaften des tertiären Vulkanismus
- Das Siebengebirge am Rhein
- Die Hocheifel
- Vogelsberg und Rhön
- Kaiserstuhl und Hegau
- Deutsche Vulkanlandschaften des quartären Vulkanismus
- Der Mosenberg bei Manderscheid (Westeifel)
- Die Maare der Westeifel
- Das Laacher-See-Vulkangebiet
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung und der landschaftlichen Gestaltung der deutschen Vulkanlandschaften. Sie bietet einen Überblick über die verschiedenen Vulkanismus-Phasen in Deutschland, vom tertiären bis zum quartären Vulkanismus, und erläutert die Entstehung der verschiedenen Vulkanlandschaften.
- Entstehungsgeschichte des Vulkanismus in Deutschland
- Tertiärer und quartärer Vulkanismus
- Geologische Prozesse und tektonische Aktivitäten
- Charakteristische Merkmale der Vulkanlandschaften
- Einfluss des Vulkanismus auf die Landschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine allgemeine Einführung in die deutschen Vulkanlandschaften und beschreibt ihre geographische Verbreitung. Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung des Vulkanismus in Deutschland und unterscheidet zwischen dem tertiären und quartären Vulkanismus. Die Entstehung des tertiären Vulkanismus wird anhand der alpidischen Faltung und der Bruchbildung in der variskischen Rumpffläche erklärt. Kapitel 2.2 beschreibt den quartären Vulkanismus und erläutert die Bedeutung der Hebung des Schiefergebirges für seine Entstehung.
Kapitel 3 stellt verschiedene Vulkanlandschaften des tertiären Vulkanismus vor, darunter das Siebengebirge, die Hocheifel, Vogelsberg und Rhön sowie der Kaiserstuhl und der Hegau.
Kapitel 4 beschreibt die Vulkanlandschaften des quartären Vulkanismus mit Fokus auf den Mosenberg bei Manderscheid, die Maare der Westeifel und das Laacher-See-Vulkangebiet.
Schlüsselwörter
Vulkanismus, Deutschland, Tertiär, Quartär, Vulkanlandschaften, Siebengebirge, Hocheifel, Vogelsberg, Rhön, Kaiserstuhl, Hegau, Maare, Laacher See, tektonische Aktivität, Bruchbildung, alpidische Faltung, Schiefergebirge, Basalt, Trachyt, Tuff.
Häufig gestellte Fragen
Wo gibt es in Deutschland noch aktive Vulkane?
Es gibt keine aktiven Vulkane mehr, aber geologisch junge Gebiete wie die Westeifel und das Laacher-See-Gebiet (Quartär) zeigen, dass der Vulkanismus erst vor wenigen tausend Jahren erloschen ist.
Was ist der Unterschied zwischen tertiärem und quartärem Vulkanismus?
Der tertiäre Vulkanismus (z. B. Vogelsberg, Rhön) ist Millionen Jahre alt, während der quartäre Vulkanismus (Eifel-Maare) wesentlich jünger ist und die heutige Landschaft prägt.
Wie entstand der Vogelsberg?
Der Vogelsberg entstand im Tertiär und gilt als das größte zusammenhängende Basaltmassiv Mitteleuropas, geformt durch zahlreiche Lavaströme aus zentralen Förderschloten.
Was sind Maare in der Eifel?
Maare sind durch Wasserdampfexplosionen entstandene Trichtervulkane, die sich nach dem Erlöschen oft mit Wasser füllen und als „Augen der Eifel“ bekannt sind.
Welche Gesteine sind typisch für deutsche Vulkanlandschaften?
Besonders verbreitet sind Basalt, Trachyt und Tuff, die durch verschiedene Arten von Eruptionen und Lavaergüssen entstanden sind.
- Quote paper
- Ariane Struck (Author), 1999, Die deutschen Vulkanlandschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7310