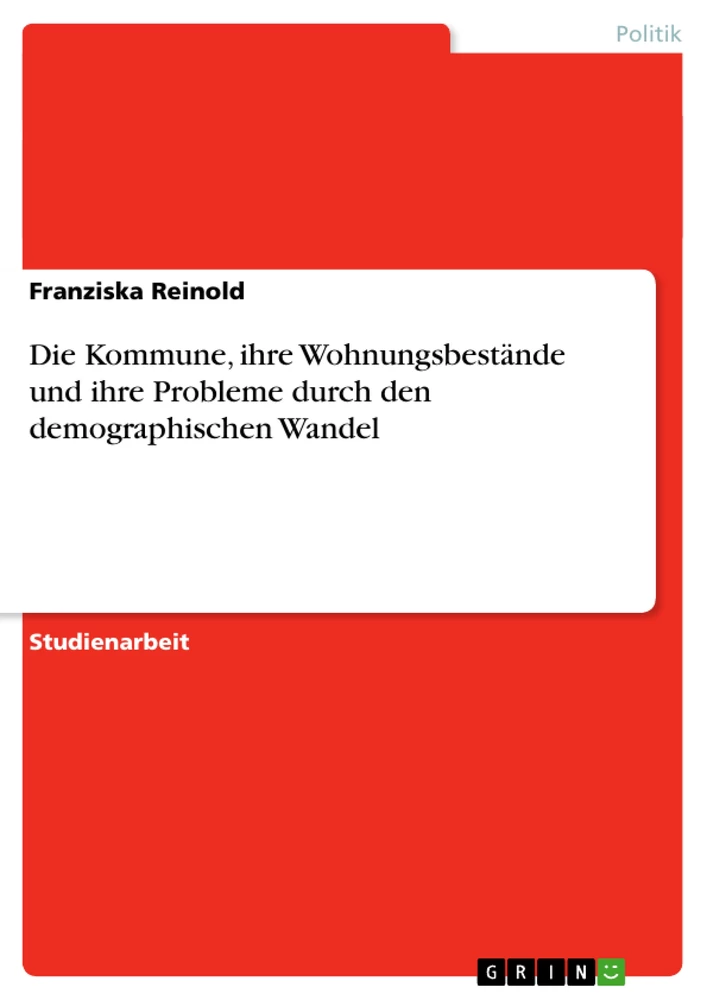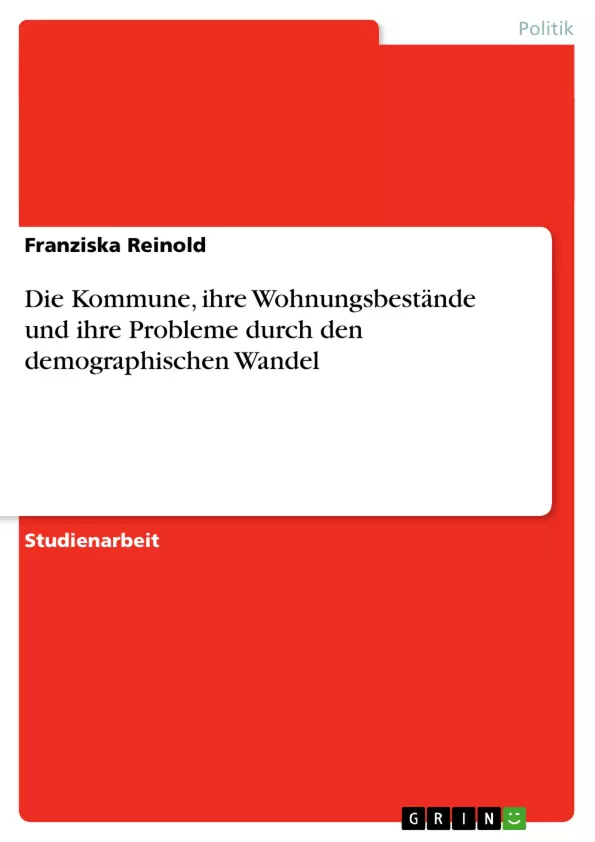Während Deutschland in der Vergangenheit eine der qualitativen und quantitativen Hochburgen des sozialen Wohnungsbaus war, hat, beginnend mit der Abschaffung der Privilegien und Bindungen der Wohnungsgemeinnützigkeit 1988 und fortgeführt mit dem Rückzug des Bundes aus der Förderung, ein deutlicher Bedeutungsverlust des sozialen Wohnungsbaus stattgefunden.
Die Kommunen und die ihr angehörigen Wohnungsbestände haben in der Vergangenheit die wichtige Aufgabe der sozialen Sicherung im Wohnungsbau übernommen, die gleichzeitig als Säule der sozialen Unterstützung fungierte. Den Bewohnern innerhalb einer Kommune wurde der Erhalt einer Wohnung gewährleistet, wenn es für sie auf dem ersten Wohnungsmarkt keine Möglichkeit gab, eine Wohnung selbst zu mieten. Ältere Menschen, Sozialschwache, Alleinerziehende mit ihren Kindern, Behinderte sowie ausländische Einwanderer bilden die Nutzergruppe der sozialen Förderstrukturen. Sie sind aufgrund ihrer finanziellen, sozialen und beruflichen Situation auf diese Sonderform der sozialen Unterstützung angewiesen. In den vergangenen Jahren ist eine enorme Veränderung innerhalb dieser sozialen Strukturen verlaufen, die mittlerweile deutlich zu erkennen ist. Für die Kommunen ist die Bereitstellung geförderter Wohnungen seit 1988 kein soziales Muss mehr, das der Gesetzgeber vorgibt. Dieser politische Entschluss führt zum Wegfall einer großen finanziellen Belastung für die Kommunen. Gleichzeitig eröffnet diese Entwicklung neue finanzielle Wege angefangen bei einer Reduzierung der sozial unterstützenden Wohnräume bis hin zu einem kompletten Verkauf der Wohnbestände an private Investoren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der soziale Wohnungsbau
- Die Privatisierung der kommunalen Wohnungsbestände
- Die Kommune und ihre Probleme
- Die Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland
- Die regionale Abwanderung
- Die alternde Gesellschaft
- Die Auswirkungen und Veränderungen des demografischen Wandel
- Die neuen und die alten Strukturen
- Konsequenzen für die Kommunen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Kommunen und ihre Wohnungsbestände in Deutschland. Dabei wird der Fokus auf den Rückzug des Bundes aus der Förderung des sozialen Wohnungsbaus und die zunehmende Privatisierung kommunaler Wohnungsbestände gelegt.
- Die Folgen der Privatisierung von kommunalen Wohnungsbeständen für die soziale Sicherung im Wohnungsbau
- Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Kommunen und ihre Finanzen
- Die Herausforderungen, denen Kommunen durch den Geburtenrückgang und die alternde Gesellschaft gegenüberstehen
- Mögliche Konsequenzen für das zukünftige kommunale Handeln
- Die Rolle der Kommune im Kontext des sozialen Stadtkonzeptes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Problematik des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland vor und beschreibt die Rolle der Kommune in der Vergangenheit. Kapitel 2 beleuchtet die Privatisierung kommunaler Wohnungsbestände und ihre Auswirkungen auf den sozialen Wohnungsbau. Kapitel 3 widmet sich den Problemen, denen Kommunen durch den demografischen Wandel gegenüberstehen, einschließlich der Entwicklung der Bevölkerung, regionaler Abwanderung und der alternden Gesellschaft. Kapitel 4 untersucht die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die neuen und alten Strukturen. Abschließend werden in Kapitel 5 die Konsequenzen für die Kommunen und das zukünftige kommunale Handeln dargelegt.
Schlüsselwörter
Sozialer Wohnungsbau, Privatisierung, demografischer Wandel, Geburtenrückgang, alternde Gesellschaft, Kommunen, Stadtentwicklung, Stadtkonzept, soziale Sicherung, finanzielle Belastung, soziale Unterstützung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst der demographische Wandel die kommunale Wohnungspolitik?
Der Wandel führt zu einem veränderten Bedarf an Wohnraum, insbesondere durch die alternde Gesellschaft und regionale Abwanderung.
Warum verliert der soziale Wohnungsbau in Deutschland an Bedeutung?
Gründe sind die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit 1988 und der Rückzug des Bundes aus der direkten Förderung des sozialen Wohnungsbaus.
Welche Folgen hat die Privatisierung kommunaler Wohnungsbestände?
Sie entlastet zwar kommunale Haushalte, führt aber oft zum Wegfall von Belegungsbindungen und erschwert die soziale Sicherung für einkommensschwache Gruppen.
Vor welchen Herausforderungen stehen Kommunen durch die alternde Gesellschaft?
Kommunen müssen Infrastrukturen anpassen, barrierefreien Wohnraum schaffen und den sozialen Zusammenhalt bei sinkenden Geburtenraten sichern.
Was bedeutet der Rückzug des Bundes aus der Wohnraumförderung?
Es bedeutet, dass Kommunen zunehmend auf sich allein gestellt sind oder Bestände an private Investoren verkaufen müssen, um finanzielle Lasten zu bewältigen.
Welche Gruppen sind besonders auf geförderten Wohnraum angewiesen?
Dazu gehören ältere Menschen, Alleinerziehende, Sozialschwache, Behinderte sowie Einwanderer.
- Arbeit zitieren
- Franziska Reinold (Autor:in), 2007, Die Kommune, ihre Wohnungsbestände und ihre Probleme durch den demographischen Wandel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73232