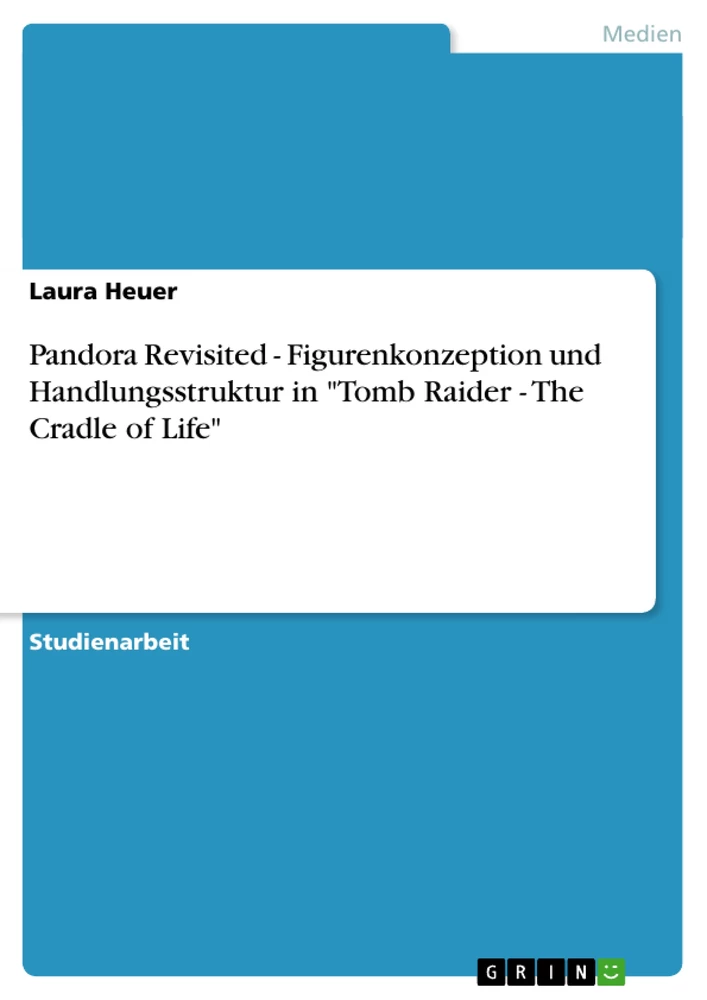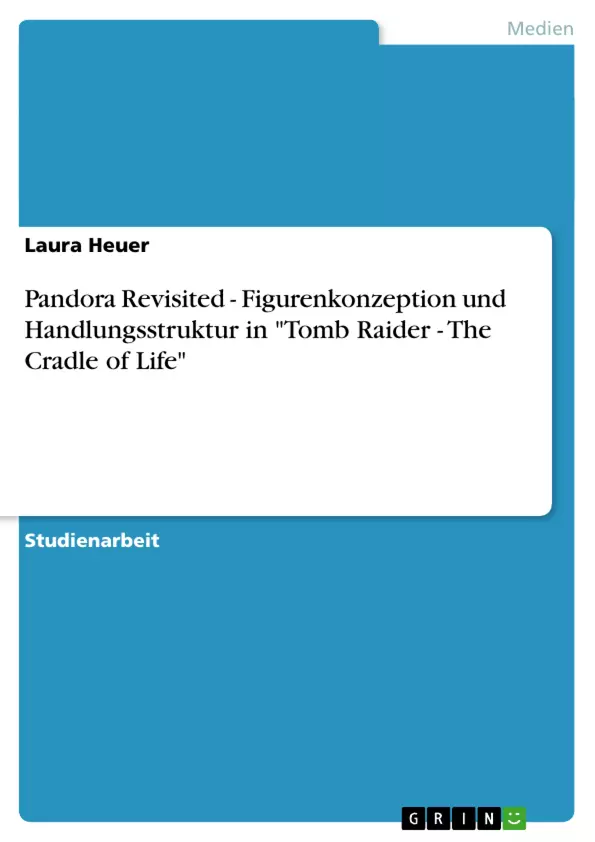Pandora ist Zeus Rache am betrügerischen Prometheus und den Menschen: er lässt die Götter des Olymp eine schöne Frau formen, die „von allen Göttern beschenkte“, damit sie Verderben über die Männer bringe, die ihrer Schönheit nicht widerstehen können. Durch sie kommen Krankheiten, Seuchen und andere Übel in die Welt und das bisher sorglose Leben der Menschheit. Wie die biblische Eva trägt Pandora damit die Schuld für die Verbannung des Menschen aus dem paradiesischen Urzustand und wie Eva gilt sie als Urahnin aller Frauen. Im 21. Jahrhundert macht sich eine moderne Kunstfrau auf die Suche nach der sprichwörtlich gewordenen Büchse der Pandora: in Tomb Raider - The Cradle Of Life (USA 2003, Regie: Jan de Bont) muss die Grabjägerin Lara Croft (Angelina Jolie) verhindern, dass der größenwahnsinnige Bio-Waffen Experte Jonathan Reiss (Ciarán Hinds) die Schatulle in die Hände bekommt, die, seit Jahrtausenden in der „Wiege des Lebens“ versteckt, das Geheimnis des Daseins und die Gefahr schrecklicher Seuchen birgt.
Tomb Raider 2 bietet sich für eine Untersuchung des Zusammenspiels postklassischer Figurenkonzeption mit den kausalen Handlungsketten filmischer Narration an, insbesondere da die Titelheldin, wie kaum eine andere, als Computerspielfigur und virtuelle Persönlichkeit gerade durch und mit den Medien existiert, die die Reizflut unserer heutigen Großstadtkultur ausmachen, welche mit dem viel beschworenen postmodernen Wandel in Gesellschaft, Kultur und Bewusstsein assoziiert wird. Lara Croft hat als ‚allbeschenkte’ Kunstfrau auch etwas von dem Konstruktcharakter, in dem sich das fragmentarische und heterogene Wesen der Postmoderne spiegelt. Demgegenüber stehen die Ansprüche klassischer linearer Handlungsverläufe und Konsistenz der Figur, die sich als Elemente der Narration in den Jahren der Hollywood Studio-Ära etabliert haben. Wie diese beiden Positionen miteinander vereinbart werden, wie sie sich wechselseitig beeinflussen und wie tradierte Rollenzuschreibungen und Konzepte im Zuge dessen unterlaufen werden, ist Gegenstand der folgenden Untersuchung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Lara Croft und die Büchse der Pandora
- 2. Die Bedeutung der Figur für die Narration
- 2.1. Lara Croft als ideale Frau
- 2.2. Parallelen zur Computerspielfigur im Film
- 2.3. Lara Croft als ,klassische' Filmfigur
- 3. Die Handlungsstrukturen
- 3.1. Postklassische Lesart: Computerspiel-Logik
- 3.2. ,Klassische' Lesart: Der Liebesplot
- 3.3. ,Klassische' Lesart: Die lineare Entwicklung der Figur
- 4. Die Cyber-Pandora
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Figurenkonzeption und Handlungsstruktur in "Tomb Raider - The Cradle of Life" im Kontext postklassischen Hollywoodkinos. Sie analysiert, wie die Figur Lara Croft, ursprünglich aus dem Computerspiel, in den Film adaptiert wurde und welche Auswirkungen diese Adaption auf die Erzählstruktur hat. Die Arbeit beleuchtet den Vergleich zwischen klassischer und postklassischer Erzählweise im Film.
- Die Adaption der Computerspielfigur Lara Croft in den Film.
- Der Vergleich zwischen klassischer und postklassischer Erzählstruktur.
- Die Rolle der Figur Lara Croft in der Narration.
- Die Analyse von Kausalitäten in der Handlung.
- Die Verbindung zwischen der mythischen Pandora und Lara Croft.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Lara Croft und die Büchse der Pandora: Dieses Kapitel stellt die Prämisse des Films vor und vergleicht die mythische Figur der Pandora mit der Protagonistin Lara Croft. Es werden die Parallelen zwischen dem Mythos und dem Film thematisiert, wobei der Fokus auf der Suche nach der „Büchse der Pandora“ und den damit verbundenen Gefahren liegt. Der Vergleich dient als Grundlage für die spätere Analyse der Figurenkonzeption und der Handlungsstruktur des Films, besonders im Hinblick auf den Einfluss der Computerspielvorlage und die Frage, ob die postmoderne Sichtweise der Medienlandschaft Einfluss auf den Film und sein Erzählfluss hat. Die Einführung des Mythos der Pandora bietet einen Kontext, um die Figur Lara Croft und ihre Rolle in der Handlung zu untersuchen.
2. Die Bedeutung der Figur für die Narration: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der Figur Lara Croft für die Erzählstruktur des Films. Es analysiert, wie die Eigenschaften von Lara Croft die Handlung vorantreiben und welche kausalen Beziehungen zwischen ihren Handlungen und den Ereignissen im Film bestehen. Dabei werden verschiedene theoretische Ansätze herangezogen, um die Rolle von Figuren in der Narration zu beleuchten, sowohl im Kontext klassischer als auch postklassischer Erzählstrukturen. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Figur Lara Croft als Produkt verschiedener Medien und Kulturen die Geschichte gestaltet. Die Besprechung klassischer Erzähltheorien bildet eine essentielle Grundlage, um die postklassischen Elemente im Film zu identifizieren und zu interpretieren.
3. Die Handlungsstrukturen: Dieses Kapitel untersucht die Handlungsstrukturen von "Tomb Raider - The Cradle of Life" aus der Perspektive sowohl klassischer als auch postklassischer Erzählkonventionen. Es analysiert, wie die Computerspiel-Logik, das klassische Liebesplot-Schema und die lineare Entwicklung der Figur in der Erzählstruktur des Films interagieren. Durch die vergleichende Betrachtung wird gezeigt, wie die postklassische Erzählweise Elemente des Computerspiels übernimmt, aber dennoch auf klassische Strukturen zurückgreift. Die Analyse des Liebesplots zeigt zudem eine weitere Facette der Charakterentwicklung von Lara Croft, die über die rein action-orientierten Aspekte hinausgeht.
4. Die Cyber-Pandora: Dieses Kapitel wird eine Schlussfolgerung darstellen, die sich aus den vorangegangenen Kapiteln ergibt. Es wird hier nicht zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Lara Croft, Tomb Raider, Postklassisches Hollywoodkino, Computerspieladaption, Figurenkonzeption, Handlungsstruktur, Kausalität, Klassische Narration, Postklassische Narration, Pandora-Mythos, Medienkultur.
Häufig gestellte Fragen zu "Tomb Raider - Die Wiege des Lebens" - Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Figurenkonzeption und Handlungsstruktur des Films "Tomb Raider - Die Wiege des Lebens" im Kontext des postklassischen Hollywoodkinos. Der Fokus liegt auf der Adaption der Computerspielfigur Lara Croft in den Film und den Auswirkungen dieser Adaption auf die Erzählstruktur. Es wird ein Vergleich zwischen klassischer und postklassischer Erzählweise gezogen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Adaption der Computerspielfigur Lara Croft, den Vergleich zwischen klassischer und postklassischer Erzählstruktur, die Rolle von Lara Croft in der Narration, die Analyse von Kausalitäten in der Handlung und die Verbindung zwischen dem Mythos der Pandora und Lara Croft.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 stellt den Film und den Pandora-Mythos vor und vergleicht beide. Kapitel 2 untersucht die Bedeutung der Figur Lara Croft für die Erzählstruktur. Kapitel 3 analysiert die Handlungsstrukturen aus klassischer und postklassischer Perspektive. Kapitel 4 bietet eine Schlussfolgerung (keine Zusammenfassung).
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie die Figur Lara Croft, ursprünglich aus dem Computerspiel, in den Film adaptiert wurde und welche Auswirkungen diese Adaption auf die Erzählstruktur hat. Sie beleuchtet den Vergleich zwischen klassischer und postklassischer Erzählweise im Film.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Es werden Zusammenfassungen für jedes Kapitel bereitgestellt. Kapitel 1 führt in den Film und den Pandora-Mythos ein. Kapitel 2 analysiert Lara Crofts Rolle in der Narration. Kapitel 3 untersucht die Handlungsstrukturen im Vergleich klassischer und postklassischer Erzählweisen. Kapitel 4 enthält keine Zusammenfassung, sondern die Schlussfolgerung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lara Croft, Tomb Raider, Postklassisches Hollywoodkino, Computerspieladaption, Figurenkonzeption, Handlungsstruktur, Kausalität, Klassische Narration, Postklassische Narration, Pandora-Mythos, Medienkultur.
Welche Aspekte der Figur Lara Croft werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Lara Croft als ideale Frau, vergleicht sie mit ihrer Computerspielfigur und analysiert sie als "klassische" Filmfigur. Es wird ihre Rolle in der Handlung und ihre Entwicklung betrachtet, sowohl im Kontext des Action-Genres als auch des Liebesplots.
Wie wird die Handlungsstruktur analysiert?
Die Handlungsstruktur wird unter dem Aspekt der Computerspiel-Logik, des klassischen Liebesplots und der linearen Figurenentwicklung analysiert. Es wird ein Vergleich zwischen klassischer und postklassischer Erzählweise vorgenommen, um die Interaktion verschiedener Erzählstrukturen im Film aufzuzeigen.
Welchen Einfluss hat der Pandora-Mythos auf die Analyse?
Der Pandora-Mythos dient als Vergleichsrahmen, um die Figur Lara Croft und ihre Rolle in der Handlung zu untersuchen. Die Parallelen zwischen dem Mythos und dem Film werden thematisiert, um die Figurenkonzeption und die Handlungsstruktur besser zu verstehen.
- Citar trabajo
- Laura Heuer (Autor), 2005, Pandora Revisited - Figurenkonzeption und Handlungsstruktur in "Tomb Raider - The Cradle of Life", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73261