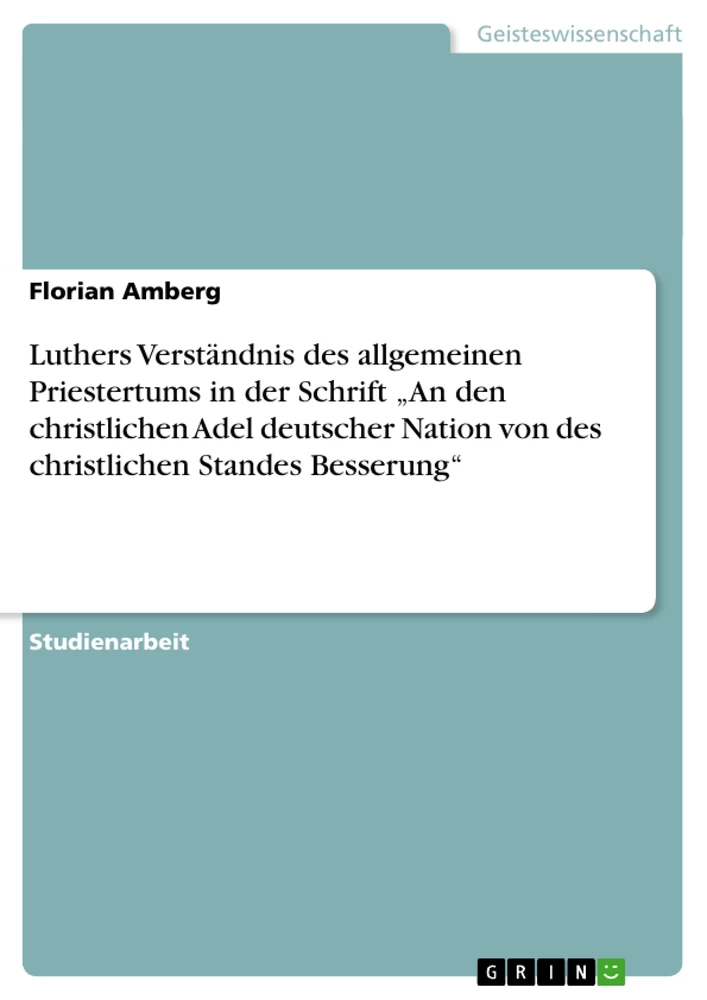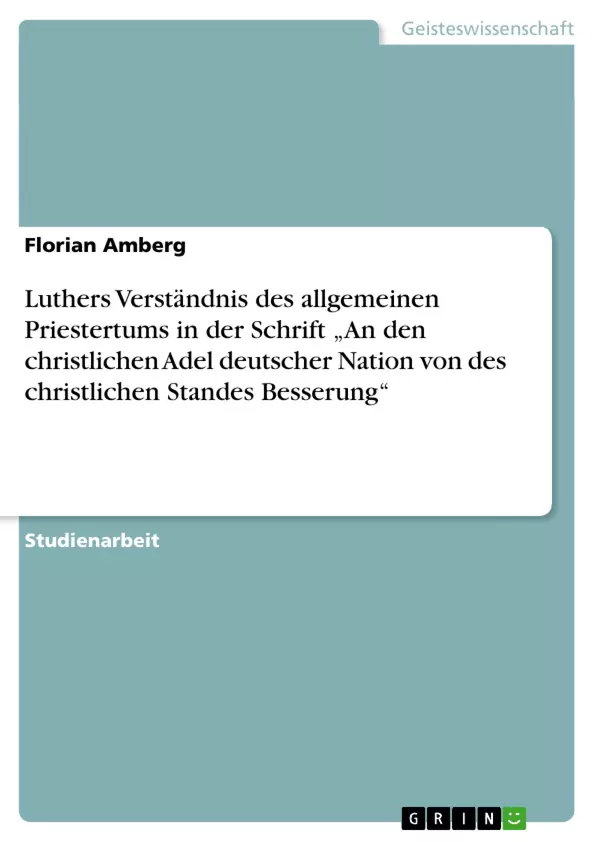Luthers Adelsschrift und sein Verständnis vom Allgemeinen Priestertum berühren zentrale Fragen der damaligen Zeit. Sie bewegen sich im Spannungsfeld von Freiheit und Begrenztheit, Recht und Pflicht, Macht und Ohnmacht, weltlichem und geistlichem Handeln, Ordnung und Anarchie – und nicht zuletzt von Hierarchie und Egalität, Gleichheit und Ungleichheit.
Bei der Analyse der Stringenz von Luthers Argumentationsmodellen ist eine klare Trennung von wörtlicher und bildhafter Rede erforderlich. Nach der Charakterisierung dieser hermeneutischen Problematik und der Darstellung des Lösungsansatzes werden die konstituierenden Elemente des Allgemeinen Priestertums und seine Konsequenzen dargelegt: Getaufte weltliche Machthaber stehen über der geistlichen Gewalt, Getaufte dürfen die Schrift selbständig auslegen und haben das Recht, ein Konzil einzuberufen. Luther beschreibt die Sünde, die gottgewollte Ordnung und die Qualität der Offenbarung als Kriterien, die innerhalb der Gemeinde Hierarchie stiften sollen. Anschließend wird in der Arbeit das Verhältnis vom Allgemeinen Priestertum und geistlichem Amt bestimmt. Schlussendlich zeigen Beispiele, dass einige Weisungen in Luthers Adelsschrift seinem Modell des Allgemeinen Priestertums spannungsvoll entgegenstehen.
Inhaltsverzeichnis
- „[V]nter yhn kein vnterscheyd, denn des ampts halben allein“: Einleitung
- ,,Dan alle Christen sein wahrhafftig geystlichs stands“: Hauptteil
- Aufbau und Gliederung der Schrift
- Entstehungskontext und Charakter
- Der geistliche Stand aller Christen
- Biblische Argumentation
- Praxisorientierte und geschichtliche Argumentation
- Hermeneutische Problematik: Wörtliche und bildhafte Rede
- Charakterisierung
- Einordnung und Folgerungen
- Begriffsdefinitionen
- Geistlicher Stand
- Amt
- Werk und Dienst
- Konstituierende Elemente des Allgemeinen Priestertums
- Konsequenzen des Allgemeinen Priestertums
- Macht der weltlichen über die geistliche Gewalt
- Eigenständige Schriftauslegung
- Recht auf Einberufung eines Konzils
- Freiheit und Pflicht des Priesters
- Hierarchiekriterien des Allgemeinen Priestertums
- Sünde
- Gottgewollte Ordnung
- Qualität der Offenbarung
- Allgemeines Priestertum und geistliches Amt
- Stringenz der Umsetzung des Allgemeinen Priestertums
- ,,[S]ollen wir mutig und frey werden“: Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Luthers Verständnis des Allgemeinen Priestertums in seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung“. Ziel ist es, Luthers Argumentation zu analysieren und die damit verbundenen Spannungen zwischen Freiheit und Begrenztheit, Recht und Pflicht sowie Hierarchie und Egalität zu beleuchten. Dabei wird der Fokus auf die Bedeutung des Allgemeinen Priestertums für das Verständnis von Kirche, Gemeinde und Gemeinschaft der Gläubigen gelegt.
- Luthers Verständnis des Allgemeinen Priestertums
- Die Rolle des christlichen Standes in der Gesellschaft
- Die Kritik an der römischen Kirche und deren Machtansprüche
- Spannungsfelder zwischen Freiheit und Begrenztheit, Recht und Pflicht sowie Hierarchie und Egalität
- Die Bedeutung des Allgemeinen Priestertums für die Reformation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den vieldeutigen Begriff des Allgemeinen Priestertums und stellt die zentralen Fragen der Schrift von Luther vor. Der Hauptteil analysiert den Aufbau und die Gliederung der Schrift, untersucht den Entstehungskontext und die Charakteristik der Schrift und beleuchtet Luthers Verständnis vom geistlichen Stand aller Christen. Es werden die biblischen und geschichtlichen Argumente Luthers sowie die hermeneutischen Probleme, die sich aus der wörtlichen und bildhaften Rede ergeben, beleuchtet. Des Weiteren werden wichtige Begriffe definiert und die konstituierenden Elemente des Allgemeinen Priestertums sowie die daraus resultierenden Konsequenzen, wie die Macht der weltlichen über die geistliche Gewalt, das Recht auf eigene Schriftauslegung und das Recht auf Einberufung eines Konzils, dargestellt. Die Freiheit und Pflicht des Priesters, die Hierarchiekriterien des Allgemeinen Priestertums und der Zusammenhang zwischen Allgemeinem Priestertum und geistlichem Amt werden ebenfalls behandelt. Der letzte Abschnitt des Hauptteils betrachtet die Stringenz der Umsetzung des Allgemeinen Priestertums. Der Schluss der Arbeit wird in dieser Vorschau nicht berücksichtigt, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Allgemeines Priestertum, Reformation, Luther, Adelsschrift, Christenheit, geistlicher Stand, Schriftauslegung, Kirche, Gemeinde, Gemeinschaft der Gläubigen, Hierarchie, Egalität, Freiheit, Pflicht, Macht, Ohnmacht.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Luther unter dem „Allgemeinen Priestertum“?
Luther vertrat die Ansicht, dass alle getauften Christen durch ihren Glauben zum geistlichen Stand gehören und somit „Priester“ sind, ohne dass es einer sakramentalen Weihe bedarf.
Warum richtete sich Luthers Schrift an den Adel?
Da die geistliche Obrigkeit Reformen verweigerte, forderte Luther den christlichen Adel auf, seine weltliche Macht zu nutzen, um die Kirche zu reformieren und Missstände zu beseitigen.
Welche Konsequenzen hatte Luthers Lehre für die Schriftauslegung?
Luther sprach jedem Christen das Recht zu, die Bibel selbstständig auszulegen, anstatt diese Autorität allein dem Papst vorzubehalten.
Was ist der Unterschied zwischen „Stand“ und „Amt“ bei Luther?
Alle Christen haben denselben geistlichen Stand, unterscheiden sich aber durch ihre Ämter (Aufgaben), die sie innerhalb der Gemeinschaft zum Wohl aller ausüben.
Welche Macht sprach Luther der weltlichen Gewalt zu?
Er forderte, dass die weltliche Macht auch über Geistliche richten darf, wenn diese gegen das Recht verstoßen, da alle Getauften der weltlichen Ordnung unterstehen.
- Quote paper
- Florian Amberg (Author), 2007, Luthers Verständnis des allgemeinen Priestertums in der Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73343