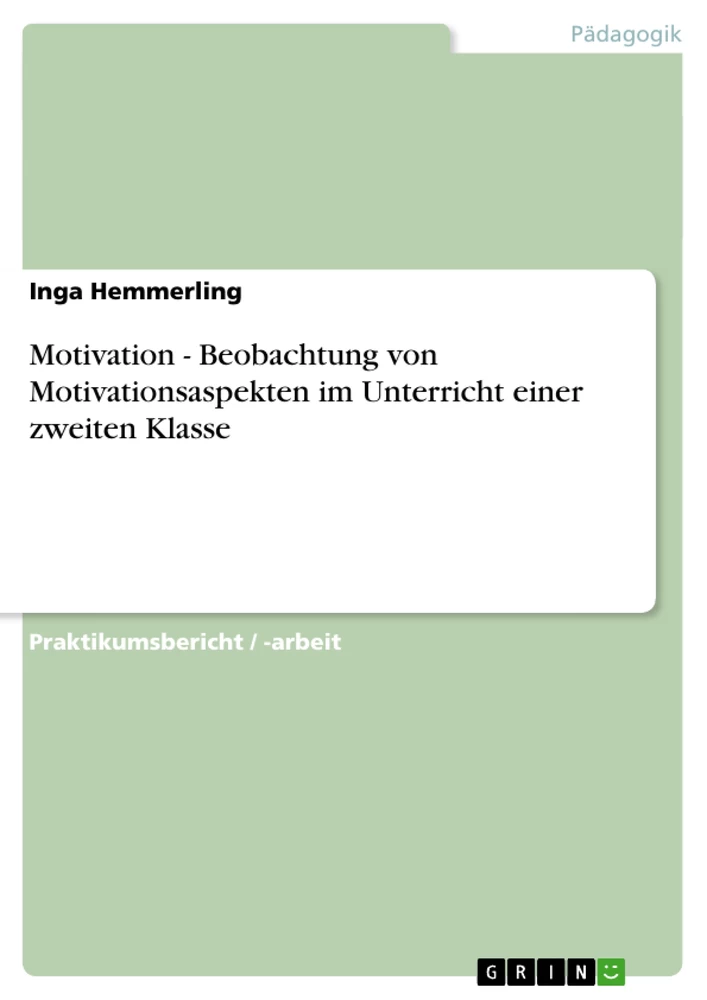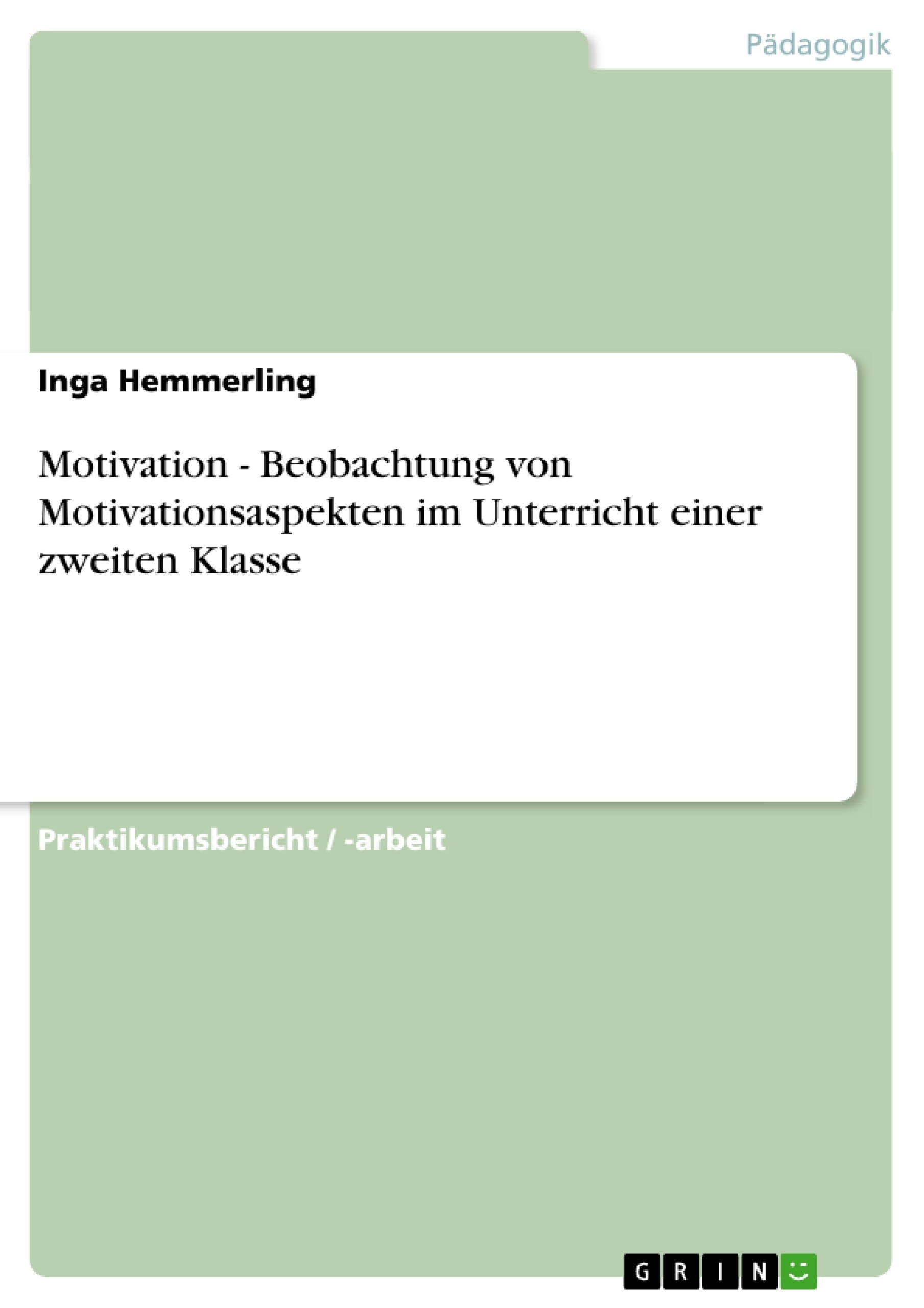„Wie motiviere ich die Kinder im Unterricht mitzuarbeiten?“
Diese Ausgangsfrage stellt sich oft bei dem ersten Versuch eine Klasse zu unterrichten. Die Motivation der Schüler ist ein entscheidender Faktor, ob eine Unterrichtsstunde gelingt und wieviel die Schüler aus einer Stunde "mitnehmen". Von diesem Aspekt ausgehend beschäftigte ich mich während meiner Beobachtungsphase im Schulpraktikum implizit mit dem Thema der „Motivation“, wobei ich die Möglichkeit der externen und die der internen Beobachtung, wenn ich kleine Unterrichtseinheiten selbst durchführte, für die Beantwortung der oben gestellten Frage nutze. Die Beantwortung der Frage, welche Motivierungsmöglichkeiten es für eine Schulklasse gibt und welche Formen und Auffälligkeiten ich beobachten konnte, soll in Verbindung mit der theoretischen Seite der Motivation die Grundlage meines Praktikumsberichtes sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Einige Motivationsmodelle im direkten Bezug zu den Beobachtungen im Unterricht
- 2.1 Die Intrinsische und extrinsische Motivation
- 2.2 Die Bedürfnispyramide von Maslow
- 2.3 Die Leistungsmotivation von Atkinson
- 2.4 Die Attributionstheorie von Weiner
- 3 Motivieren im Unterricht
- 3.1 Erfolg und Verstärkung
- 3.2 Mit Spaß und Interesse an den Lerngegenstand
- 3.3 Motivation der Schüler untereinander
- 3.4 Funktion der Zieltransparenz
- 4 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, die im Rahmen eines Schulpraktikums in einer zweiten Klasse beobachteten Motivationsaspekte von Schülern zu analysieren und mit verschiedenen Motivationsmodellen in Verbindung zu setzen. Die Arbeit untersucht, wie Motivation im Unterricht gefördert werden kann und welche Rolle verschiedene Faktoren wie Erfolgserlebnisse, intrinsisches Interesse und soziale Interaktion spielen.
- Beobachtung und Analyse von Schülermotivation im Unterricht
- Anwendung verschiedener Motivationsmodelle (intrinsische/extrinsische Motivation, Maslow, Atkinson, Weiner)
- Methoden zur Steigerung der Schülermotivation im Unterricht
- Die Bedeutung von Erfolgserlebnissen und positivem Feedback
- Der Einfluss sozialer Interaktion auf die Motivation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext des sechswöchigen Schulpraktikums an der Astrid-Lindgren-Schule in Bochum-Linden. Die Autorin schildert die Schule, ihre Struktur und den Prozess der Zuweisung zu einer Klasse. Der Fokus liegt auf der Klasse 2a, in der die Autorin ihre Beobachtungen und ersten Unterrichtsversuche durchführte. Ein spontaner Vertretungseinsatz führte zur zentralen Frage der Arbeit: Wie kann man Schüler motivieren? Die Einleitung legt den Grundstein für die spätere Auseinandersetzung mit Motivationsmodellen und deren Anwendung im praktischen Unterricht.
2 Einige Motivationsmodelle im direkten Bezug zu den Beobachtungen im Unterricht: Dieses Kapitel beginnt mit einer Definition von Motivation, die den Einfluss von Motiven und Situationen auf das Verhalten betont. Es werden vier ausgewählte Motivationsmodelle vorgestellt und mit den Beobachtungen im Unterricht in Beziehung gesetzt. Die Autorin erklärt die Wechselwirkung zwischen persönlichen Motiven und konkreten Situationen, wobei das stärkste Motiv das Verhalten in einer bestimmten Situation bestimmt. Das Kapitel dient als theoretische Grundlage für die Analyse der Beobachtungen.
Schlüsselwörter
Motivation, Schülermotivation, Unterricht, Motivationsmodelle, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Maslowsche Bedürfnispyramide, Leistungsmotivation (Atkinson), Attributionstheorie (Weiner), Beobachtung, Schulpraktikum, Grundschule.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Schülermotivation im Unterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Aspekte der Schülermotivation, die während eines sechswöchigen Schulpraktikums in einer zweiten Klasse beobachtet wurden. Sie verbindet diese Beobachtungen mit verschiedenen Motivationsmodellen und untersucht, wie Motivation im Unterricht gefördert werden kann.
Welche Motivationsmodelle werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die intrinsische und extrinsische Motivation, Maslows Bedürfnispyramide, Atkinsons Leistungsmotivationsmodell und Weiners Attributionstheorie. Diese Modelle werden mit den im Unterricht beobachteten Schülermotivationsphänomenen in Beziehung gesetzt.
Welche konkreten Themen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht die Beobachtung und Analyse von Schülermotivation, die Anwendung verschiedener Motivationsmodelle, Methoden zur Steigerung der Schülermotivation, die Bedeutung von Erfolgserlebnissen und positivem Feedback sowie den Einfluss sozialer Interaktion auf die Motivation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu verschiedenen Motivationsmodellen, ein Kapitel zu Methoden der Motivationsförderung im Unterricht und eine Schlussbemerkung. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Wo fand das Schulpraktikum statt?
Das sechswöchige Schulpraktikum fand an der Astrid-Lindgren-Schule in Bochum-Linden statt, in der Klasse 2a.
Welche Rolle spielte der Vertretungseinsatz?
Ein spontaner Vertretungseinsatz während des Praktikums führte zur zentralen Forschungsfrage der Arbeit: Wie kann man Schüler motivieren?
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Motivation, Schülermotivation, Unterricht, Motivationsmodelle, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Maslowsche Bedürfnispyramide, Leistungsmotivation (Atkinson), Attributionstheorie (Weiner), Beobachtung und Schulpraktikum.
Wie wird die Schülermotivation im Unterricht analysiert?
Die Schülermotivation wird durch direkte Beobachtung im Unterricht analysiert und im Kontext der vorgestellten Motivationsmodelle interpretiert. Die Arbeit legt Wert auf die Wechselwirkung zwischen persönlichen Motiven und konkreten Unterrichtssituationen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit sind nicht im gegebenen Text enthalten, da nur der Aufbau und die zentralen Themen beschrieben werden.)
- Quote paper
- Inga Hemmerling (Author), 2006, Motivation - Beobachtung von Motivationsaspekten im Unterricht einer zweiten Klasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73416