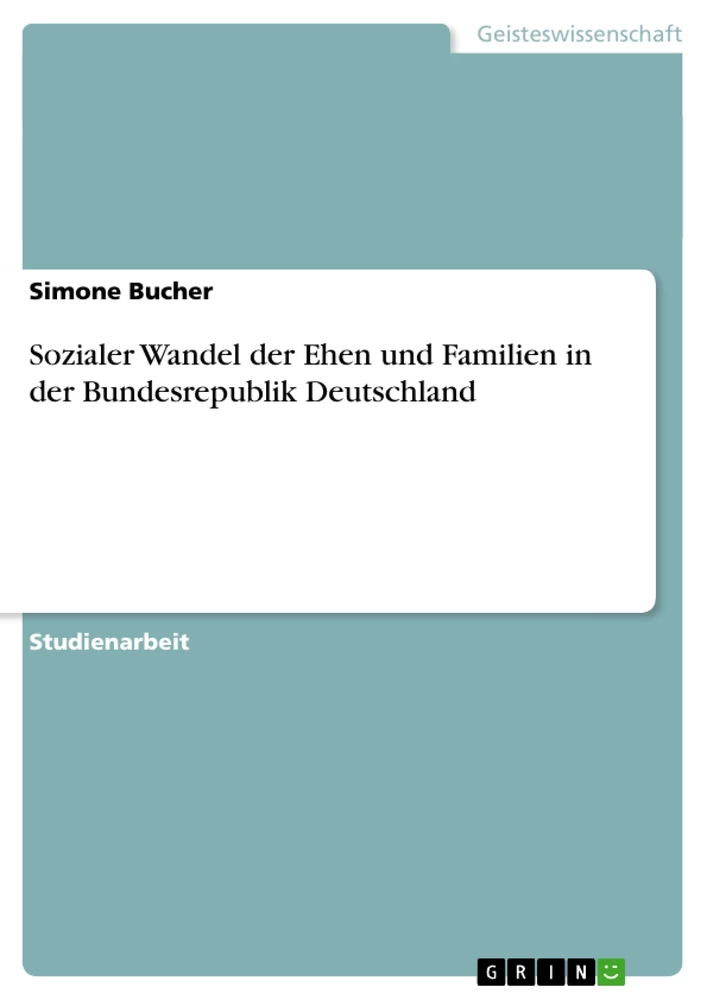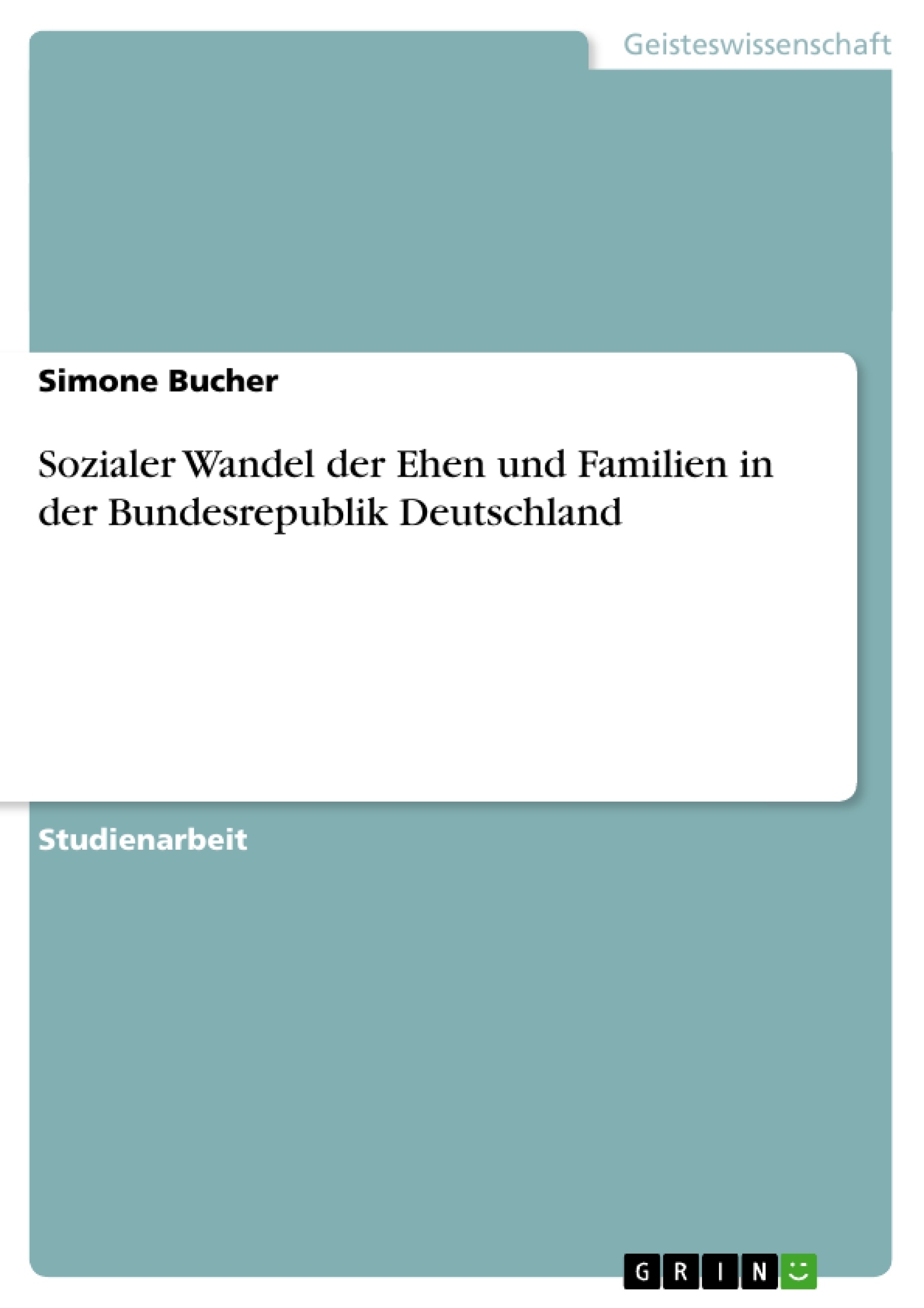Seit Mitte der 60er Jahre ist die Familie in den hoch entwickelten Industriegesellschaften ausgeprägten Wandlungsprozessen unterworfen.
„Überall in den entwickelten Industrieländern sinkt die Geburtenrate. Die Heiratsneigung geht zurück, und immer häufiger lassen sich Ehepaare scheiden“. Diese demographischen Wandlungsprozesse werden als die wichtigsten Symptome für die Krise der heutigen Familie bezeichnet. Der „demographische Bruch“ wird im Jahre 1965 angesiedelt, als in Europa Frieden, Vollbeschäftigung und eine stetige Erhöhung des Lebensstandards zu verzeichnen war.
Zu Beginn der 60er Jahre zeichnete sich zudem der „Individualisierungsschub“ ab.
In allen Industrieländern, aber besonders deutlich in der Bundesrepublik Deutschland „hat sich in der wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegsentwicklung ein gesellschaftlicher Individualisierungsschub von bislang unerkannter Reichweite und Dynamik vollzogen“. Begünstigt und unterstützt von einem relativ hohen materiellen Lebensstandard und weit vorangetriebenen sozialen Sicherheiten wurden die Menschen in einem „historischen Kontinuitätsbruch aus traditionalen Klassenbindungen und Versorgungsbezügen der Familie herausgelöst und verstärkt auf sich selbst und ihr individuelles Schicksal mit allen Risiken, Chancen und Widersprüchen verwiesen.“
Eine „Pluralisierung der Lebens- und Beziehungsformen“, eine „Entkopplung und Ausdifferenzierung der in Familie und Ehe zusammen gefassten Lebens- und Verhaltenselemente“ und eine Abwendung vom Leitbild der bürgerlichen Kleinfamilie sind hierbei verstärkt wahrzunehmen.
Der gesellschaftliche Individualisierungsprozess im Sinne einer zunehmenden Freisetzung aus sozialen Bindungen wurde von einem sozialen Wertewandel begleitet. Die „Selbstentfaltungswerte, die Betonung von Autonomie, Gleichbehandlung und Selbstverwirklichung“, haben in diesem Zusammenhang ganz besonders an Bedeutung gewonnen.
Die Paarbeziehungen lösen sich nun in Folge dessen immer weiter von der dominanten Familienorientiertheit ab und zentrieren sich zunehmend um Liebe und Sexualität, zugleich aber auch an Werten der Selbstrealisierung und Selbstbestimmung. Die Wahl für die institutionalisierte Ehe wird immer mehr von einer subjektiven Werteorientierung, besonders vom Kinderwunsch, bedingt. Ihre Dauerhaftigkeit wiederum wird immer mehr von der Partnerzufriedenheit und individuellen Anspruchsmustern abhängig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1.1 Der demographische Bruch
- 1.2 Der Individualisierungsschub
- 1.3 Pluralisierung der Lebens- und Beziehungsformen
- 1.4 Wertewandel
- Struktureller Wandel der Familie
- 2.1 Die gute, alte Zeit: die vorindustrielle Familie
- 2.2 Der Wandel aus demographischer Sicht
- 2.2.1 Geburtenentwicklung
- 2.2.2 Eheschließungen
- 2.2.3 Scheidungen
- Pluralisierung der Familienformen
- 3.1 Nichteheliche Lebensgemeinschaften
- 3.2 Alleinerziehende
- 3.3 Kinderlosigkeit
- Die Individualisierungsthese als Erklärungsansatz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den sozialen Wandel von Ehen und Familien in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere seit Mitte der 1960er Jahre. Sie untersucht die demographischen, sozialen und kulturellen Faktoren, die zu diesem Wandel geführt haben und beleuchtet die Folgen für die Familienstruktur und das gesellschaftliche Leben.
- Der demographische Wandel und seine Auswirkungen auf die Familienstruktur
- Die Pluralisierung der Familienformen und die Abkehr vom traditionellen Familienmodell
- Die Individualisierungsthese als Erklärungsansatz für den sozialen Wandel
- Die Folgen des sozialen Wandels für die Lebensentwürfe von Frauen und Männern
- Die Herausforderungen und Chancen des modernen Familienlebens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den sozialen Wandel von Ehen und Familien in der Bundesrepublik Deutschland seit Mitte der 1960er Jahre dar und erläutert die zentralen Themen und die Bedeutung des demographischen Bruchs und des Individualisierungsschubs.
- Struktureller Wandel der Familie: Dieser Abschnitt beschreibt die Entwicklung der Familienstruktur in der Bundesrepublik Deutschland, beginnend mit der vorindustriellen Zeit und dem Wandel hin zur bürgerlichen Familie. Er beleuchtet die wichtigsten demographischen Veränderungen wie die Geburtenentwicklung, die Eheschließungen und die Scheidungen.
- Pluralisierung der Familienformen: In diesem Kapitel werden verschiedene moderne Familienformen wie nichteheliche Lebensgemeinschaften, Alleinerziehende und kinderlose Paare analysiert. Es wird gezeigt, wie die Familie heute vielfältiger und individueller geworden ist.
- Die Individualisierungsthese als Erklärungsansatz: Dieser Abschnitt widmet sich der Individualisierungstheorie als einem wichtigen Erklärungsansatz für den sozialen Wandel von Ehe und Familie. Es werden die Folgen des Individualisierungsprozesses für das Familienleben und die Gesellschaft im Ganzen betrachtet.
Schlüsselwörter
Sozialer Wandel, Familie, Ehe, Demografie, Individualisierung, Pluralisierung, Familienformen, Lebensgemeinschaften, Alleinerziehende, Kinderlosigkeit, Wertewandel, Selbstverwirklichung, Autonomie, demographischer Bruch, Individualisierungsschub.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „demographische Bruch“ von 1965?
Dieser Begriff markiert den Zeitpunkt in Europa, ab dem Geburtenraten sanken und sich Familienstrukturen durch Wohlstand und sozialen Wandel grundlegend veränderten.
Was besagt die Individualisierungsthese im Kontext der Familie?
Sie erklärt, wie Menschen aus traditionellen Bindungen herausgelöst werden und verstärkt auf ihr individuelles Schicksal und ihre Selbstverwirklichung verwiesen werden.
Welche neuen Familienformen sind seit den 60ern entstanden?
Die Arbeit nennt nichteheliche Lebensgemeinschaften, Alleinerziehende und bewusst kinderlose Paare als Beispiele für die Pluralisierung der Lebensformen.
Wie hat sich die Bedeutung der Ehe gewandelt?
Die Ehe ist heute weniger eine traditionelle Institution, sondern wird subjektiv durch Werte wie Liebe, Sexualität und Partnerzufriedenheit begründet.
Welchen Einfluss hatte der Wertewandel auf die Geburtenrate?
Die Betonung von Autonomie und Selbstentfaltung führte zu einem Rückgang der Heiratsneigung und einer sinkenden Geburtenrate in Industriegesellschaften.
- Arbeit zitieren
- Simone Bucher (Autor:in), 2006, Sozialer Wandel der Ehen und Familien in der Bundesrepublik Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73541