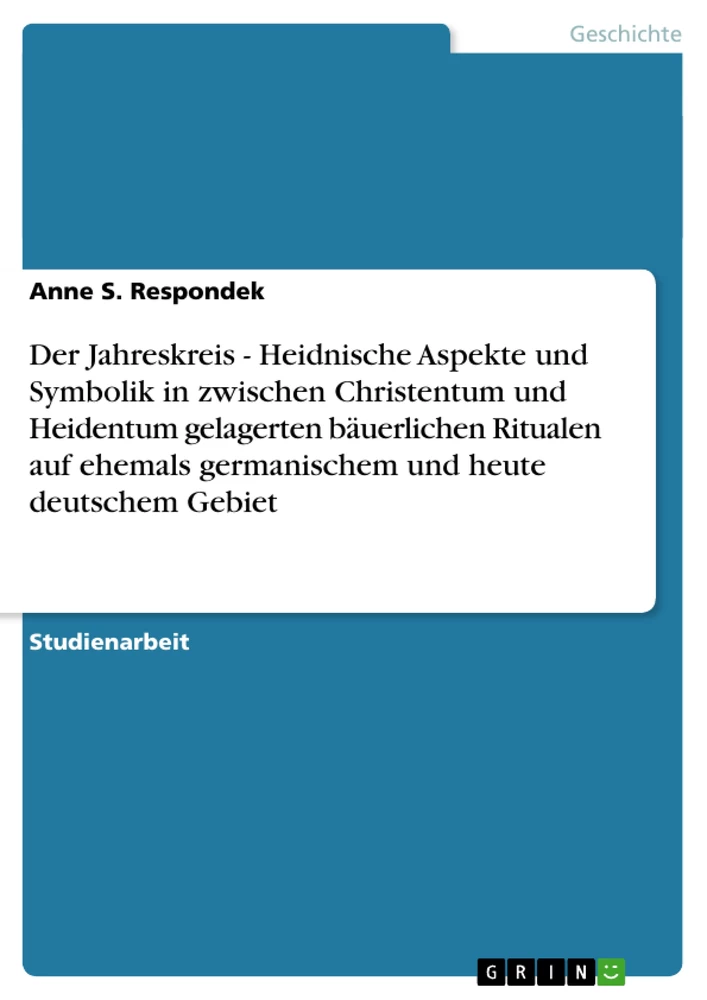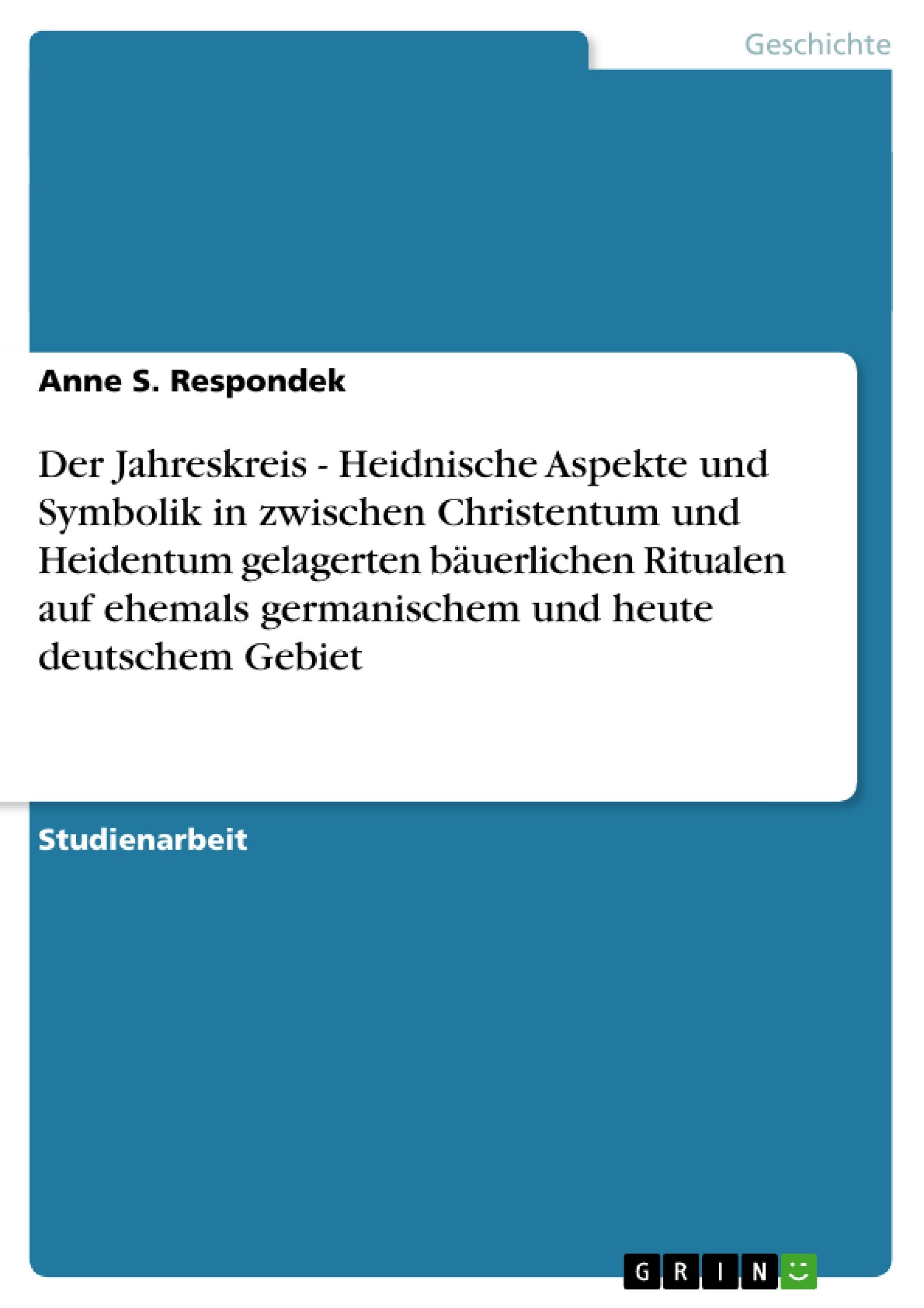Das (ur-)alte wie neuere Bauerntum hat und hatte stets berufsbedingt einen starken Bezug zur Natur, von der und mit der es lebt und sich nährt. Es verehrt dahingehend aus sich heraus auch stets die „Grosse Mutter Erde“, wie es allen heidnischen Völkern gleich ist, und wie selbst Tacitus bemerkte1, der in seiner „germania“ die subjektive Betrachtung der heidnischen Völker nicht nur als Kritik an Rom nutzte, sondern der „die schlimmste Gefahr nicht so sehr in deren der Germanen, Anm. d. V. Leibeskraft und Tapferkeit, als in deren Freiheitsliebe, Sittenreinheit und Glaubensstärke“ sah. Nach Grimm setzt sich diese Verehrung der All-Mutter bis heute in den Marienkult der katholischen Kirche hin fort, ebenso wie in der heutigen katholischen Heiligenverehrung noch der polytheistische Heidenglaube erkennbar ist.
Inhaltsverzeichnis 2
1. Einleitung 3
2. Winterbräuche 5
3. Frühjahrsbräuche 8
4. Sommerbräuche 11
5. Herbstbräuche 12
6. Fazit 13
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Winterbräuche
- Frühjahrsbräuche
- Sommerbräuche
- Herbstbräuche
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verschmelzung heidnischer und christlicher Traditionen im mittelalterlichen bäuerlichen Jahreskreis auf ehemals germanischem Gebiet. Ziel ist es, heidnische Aspekte und Symbolik in scheinbar christlichen Ritualen aufzuzeigen und deren Kontinuität über die Christianisierung hinweg zu belegen.
- Heidnische Winterbräuche und deren Christianisierung
- Kontinuität heidnischer Traditionen im Jahreskreis
- Die Rolle von Symbolen und Ritualen im Wandel der Religionen
- Die Übernahme und Umdeutung heidnischer Feste durch das Christentum
- Der Einfluss der Natur auf die religiösen Praktiken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den starken Bezug des bäuerlichen Lebens zur Natur und die Verehrung der „Großen Mutter Erde“ im germanischen Heidentum. Sie verweist auf Tacitus' Beschreibung der Germanen und Grimms These einer Fortsetzung des heidnischen Mutterkultes im Marienkult. Die Arbeit untersucht, wie heidnische Aspekte trotz der Christianisierung im Jahreskreis fortlebten, wobei die christlichen Missionare heidnische Bräuche entweder umkehrten oder umdeuteten.
Winterbräuche: Dieses Kapitel behandelt die Winterbräuche, beginnend mit einer Totenfeier am 1. Oktober, die mit dem Kirchweihfest des Heiligen Michael, Schutzengelfeiern und Allerseelen in Verbindung gebracht wird. Es wird gezeigt, wie christliche Feste auf heidnischen Traditionen aufbauten, indem ähnliche Speise- und Trankopfer dargebracht wurden. Die Kapitel erläutert die Verbindung zwischen St. Martin, dem Heiligen Nikolaus und der Wilden Jagd, wobei Wotan als Symbolfigur des "Schimmelreiters" identifiziert wird und die Attribute von St. Martin mit denen Wotans verglichen werden.
Schlüsselwörter
Heidentum, Christentum, Mittelalter, Jahreskreis, Winterbräuche, heidnische Symbolik, Christianisierung, Rituale, Wotan, Donar, Marienkult, Volksglaube, germanische Mythologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verschmelzung heidnischer und christlicher Traditionen im mittelalterlichen bäuerlichen Jahreskreis
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie heidnische und christliche Traditionen im mittelalterlichen bäuerlichen Jahreskreis auf ehemals germanischem Gebiet miteinander verschmolzen sind. Sie konzentriert sich darauf, heidnische Aspekte und Symbolik in scheinbar christlichen Ritualen aufzuzeigen und deren Kontinuität über die Christianisierung hinweg zu belegen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Winter-, Frühlings-, Sommer- und Herbstbräuche. Ein besonderer Fokus liegt auf der Christianisierung heidnischer Winterbräuche, der Kontinuität heidnischer Traditionen im Jahreskreis, der Rolle von Symbolen und Ritualen im Wandel der Religionen, der Übernahme und Umdeutung heidnischer Feste durch das Christentum und dem Einfluss der Natur auf die religiösen Praktiken.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Tacitus' Beschreibung der Germanen und Grimms These einer Fortsetzung des heidnischen Mutterkultes im Marienkult. Weitere Quellen sind nicht explizit genannt, aber die Analyse basiert auf der Untersuchung von Bräuchen und Ritualen des mittelalterlichen bäuerlichen Jahreskreises.
Wie werden heidnische und christliche Traditionen in Beziehung gesetzt?
Die Arbeit zeigt auf, wie christliche Missionare heidnische Bräuche entweder umkehrten oder umdeuteten. Sie analysiert, wie christliche Feste (z.B. Kirchweihfest des Heiligen Michael, Allerseelen, Martinstag, Nikolaustag) auf heidnischen Traditionen aufbauen und ähnliche Rituale und Opfergaben beinhalten. Die Arbeit identifiziert beispielsweise Wotan als Symbolfigur des "Schimmelreiters" und vergleicht die Attribute von St. Martin mit denen Wotans.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Heidentum, Christentum, Mittelalter, Jahreskreis, Winterbräuche, heidnische Symbolik, Christianisierung, Rituale, Wotan, Donar, Marienkult, Volksglaube und germanische Mythologie.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Winter-, Frühlings-, Sommer- und Herbstbräuchen sowie ein Fazit. Die Einleitung beleuchtet den starken Bezug des bäuerlichen Lebens zur Natur und die Verehrung der „Großen Mutter Erde“ im germanischen Heidentum.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit wird in der bereitgestellten Vorschau nicht explizit genannt, aber die Arbeit legt nahe, dass heidnische Traditionen trotz der Christianisierung im Jahreskreis fortbestanden und in christlichen Bräuchen weiterlebten, oft in umgedeuteter oder adaptierter Form.
- Quote paper
- Anne S. Respondek (Author), 2006, Der Jahreskreis - Heidnische Aspekte und Symbolik in zwischen Christentum und Heidentum gelagerten bäuerlichen Ritualen auf ehemals germanischem und heute deutschem Gebiet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73560