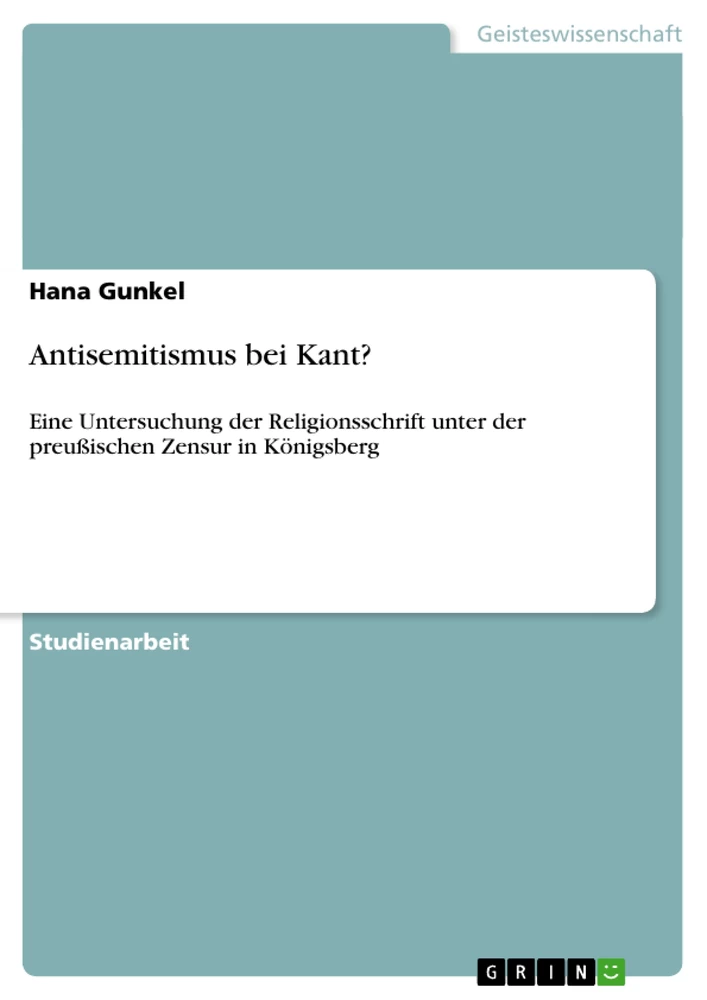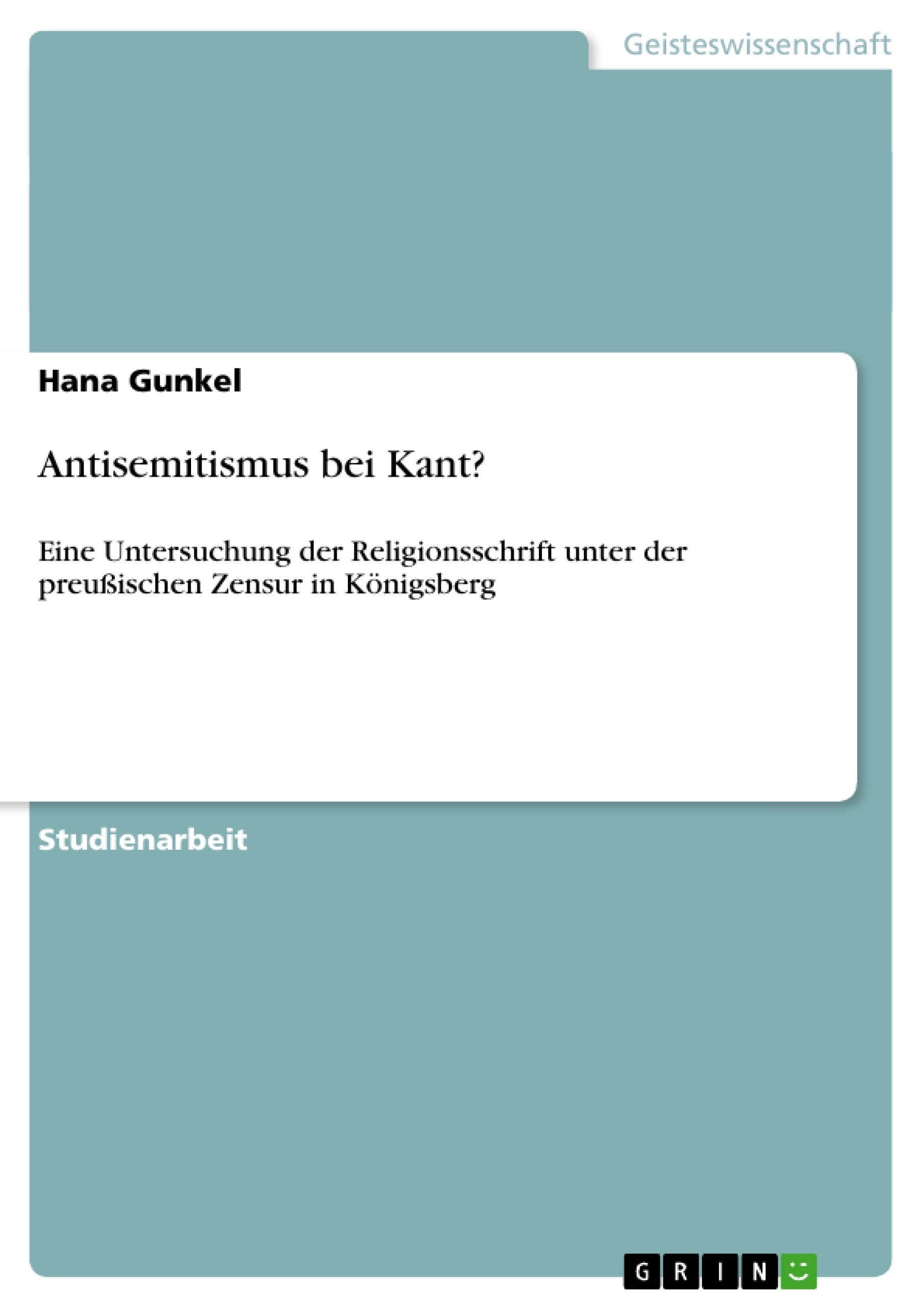. Einleitung
Immanuel Kant ist einer der meistbeachtetsten deutschen Philosophen und zog eine Reihe von bedeutenden „Kantianern“ nach sich, die auf seine Lehren aufbauten und sie weiterentwickelten. Je bedeutender ein Autor nun ist, um so wichtiger ist seine moralische Integrität, wie in aktuellen Debatten deutlich wird. Darum ist es unbedingt notwendig Vorwürfen hinsichtlich eines möglichen Antisemitismus in Kants Schriften nachzugehen. Zwar hat der Vorwurf des Antisemitismus heute eine ganz andere Dimension, als zu Lebzeiten Kants, aber gerade weil Kants Werke zeitlose Wichtigkeit haben, scheint es sinnvoll diesen Vorwürfen nachzugehen und sie in die Zeit und deren Umstände einzuordnen.
Bettina Stangneth hat in ihrem Essay Antisemitistischen und antijudaistischen Motiven bei Kant verschiedene Tatsachen, Meinungen und mögliche Ursachen zusammengetragen und soll für diese Arbeit als wichtige Quelle dieser Vorwürfe dienen. Der Großteil dieser Vorwürfe richtet sich auf Kants Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, darum soll anhand dieser Schrift überprüft werden, ob diese Vorwürfe gerechtfertigt sind, oder ob mögliche antijudaistische Äußerungen nicht einen anderen, vielleicht philosophisch begründeten Hintergrund haben.
So ist es doch denkbar dass Kant in seiner Religionsschrift Religion im allgemeinen kritisieren wollte und dies aus bestimmten Gründen beim Judentum expliziter getan hat als beim Christentum. Um dies herauszuarbeiten wird die Religionsschrift in groben Zügen dargestellt, um anschließend die antisemitischen bzw. antijüdischen und antichristlichen Motiven herauszuarbeiten. Dabei soll neben den Äußerungen in seinem Werk auf Kants persönliches Verhältnis zu den Juden eingegangen werden, da dies nicht unerheblich für einen möglichen Antisemitismus erscheint.
Daneben werden die Bedingungen betrachtet, unter denen Kant die Religionsschrift 1793 in Königsberg geschrieben hat. Denn in jene Zeit fiel mit der Amtsübernahme Friedrich Wilhelm II. eine Verschärfung der staatlichen Zensur, die durchaus einen Einfluss auf Kants Schriften gehabt haben könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Religionsschrift als Werk der Aufklärung
- Überblick über die Religionsschrift
- Antiklerikale Elemente
- Antisemitische bzw. Antijudaistische Elemente
- Antijudaistische Äußerungen in Kants Religionsschrift
- Kant - ein Antijudaist?
- Antichristliche Äußerungen
- Antisemitische bzw. Antijudaistische Elemente
- Kants Schrift unter der preußischen Zensur jener Zeit
- Wandel der Zensur unter Friedrich Wilhelm II
- Die Religionsschrift und die preußische Zensur
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Kants Schrift "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" im Hinblick auf mögliche antisemitische und antijudaistische Elemente. Ziel ist es, die Vorwürfe des Antisemitismus in Kants Schriften zu untersuchen und in den Kontext seiner Zeit und des preußischen Zensursystems zu stellen.
- Analyse der Religionsschrift im Kontext der Aufklärung und des Deismus
- Untersuchung der antisemitischen und antijudaistischen Äußerungen in der Religionsschrift
- Rekonstruktion des Verhältnisses von Kants Werk zur preußischen Zensur
- Bewertung der Vorwürfe des Antisemitismus unter Berücksichtigung der Zeitumstände
- Erörterung der Frage, ob antijudaistische Aussagen in der Religionsschrift Ausdruck einer allgemeinen Religionskritik sind
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Arbeit in den Kontext aktueller Debatten um Kants moralische Integrität. Es wird die Relevanz der Untersuchung von Antisemitismusvorwürfen in Kants Schriften betont, die sich insbesondere auf die Religionsschrift beziehen.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Religionsschrift als Werk der Aufklärung und beschreibt den historischen Kontext des Deismus, der Religion als eine spezialisierte Bewusstseinsebene neben anderen Wissenschaften sah.
Im dritten Kapitel wird die antiklerikale Kritik Kants genauer betrachtet, wobei ein Schwerpunkt auf den antisemitischen und antijudaistischen Elementen in der Religionsschrift liegt. Die Arbeit untersucht antijudaistische Äußerungen in Kants Werk und diskutiert die Frage, ob Kant als Antijudaist betrachtet werden kann.
Das vierte Kapitel analysiert Kants Schrift im Hinblick auf die preußische Zensur unter Friedrich Wilhelm II. Die Arbeit betrachtet den Wandel der Zensur und die möglichen Auswirkungen auf Kants Werk. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob die antisemitischen Elemente in Kants Religionsschrift möglicherweise eine Strategie waren, um die Zensur zu umgehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Antisemitismus, Religionskritik, Aufklärung, Deismus, preußische Zensur, Immanuel Kant und "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft". Im Fokus stehen die antisemitischen und antijudaistischen Elemente in Kants Religionsschrift sowie die Rolle der Zensur im Kontext der preußischen Gesellschaft.
- Quote paper
- Hana Gunkel (Author), 2006, Antisemitismus bei Kant?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73659