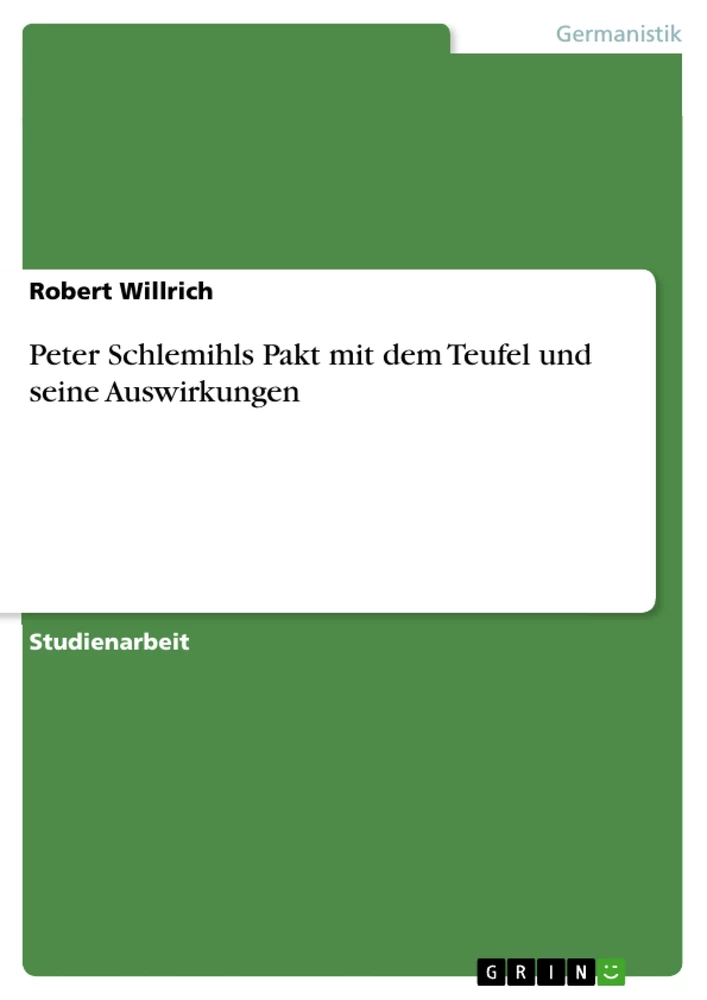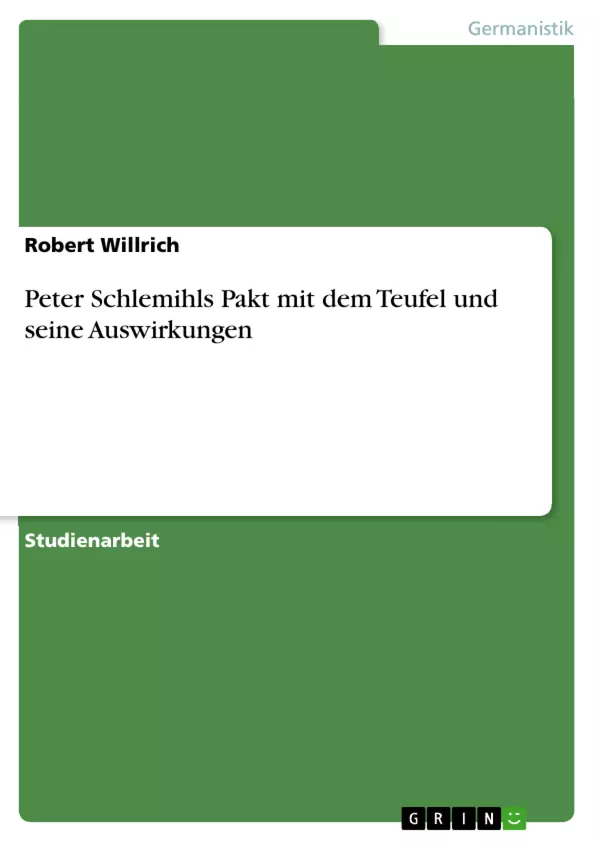Und genau diese Normalität verwirkt die Hauptfigur in Chamissos Novelle Peter Schlemihls wundersame Geschichte, da sie ihren Schatten verkauft. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich deshalb mit dem abgeschlossenen Tauschgeschäft, das zu dem Verlust dieser Normalität führt, zwischen der – als grauen Mann auftretenden – Teufelsfigur und Schlemihl selbst.
Im ersten Teil der Arbeit möchte ich untersuchen, warum sich Schlemihl auf den satanischen Handel eingelassen hat und inwieweit man ihn von einer bestimmten Schuld freisprechen kann. Man sagt, dass große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen, aber hatte Schlemihl tatsächlich eine Chance die Folgen vorherzusehen? Es soll mir darum gehen, seine möglichen Gründe aufzudecken, weil dieses Thema bisher eher vernachlässigt oder Schlemihl von vornherein die Alleinschuld zugesprochen wurde, anstatt die dafür zuständigen Umstände zu beleuchten.
Die Arbeit soll überdies Aufschluss darüber geben, welche Konsequenzen dieses mephistophelische Abkommen für Schlemihl hat. In welche Zwangslagen wird er getrieben und wie versucht er damit umzugehen? Auch die Reaktionen der Menschen auf seine Schattenlosigkeit möchte ich versuchen kurz zu erläutern.
Da Schlemihl nach seinem Paktabschluss zu einem Großteil auf soziale Kontakte verzichten muss, ist es nur logisch auch die Rolle des Geldes zu untersuchen, weil das der Gegenwert ist, den er durch den Handel erhält. Ich möchte zeigen, welchen Stellenwert das Gold in Schlemihls Leben hat und nachweisen, dass sein verfolgtes Ziel eigentlich nie das Anhäufen von materiellen Wertgegenständen ist. Ich will des Weiteren hinterfragen, inwieweit er mit seinem Reichtum den Schattenverlust kompensieren kann und welche charakterlichen Veränderungen sich feststellen lassen.
Doch natürlich soll auch die zweite Begegnung zwischen den beiden Hauptcharakteren nicht unberücksichtigt bleiben. Deshalb wird im Folgenden geprüft, was ‚der Graue’ hauptsächlich mit dem ersten Geschäft bezweckt hat und mit welchen Mitteln er darum kämpft auch sein endgültiges Ziel zu erreichen. Im Kontrast dazu soll es mir aber auch darum gehen, zu zeigen wie und warum sich Schlemihl widersetzt, um schlussendlich einen Sieg über seinen dämonischen Feind zu erringen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Geschäft mit dem Teufel
- 2.1 Gründe für den Verkauf des Schattens
- 2.2 Reaktionen und Folgen der Schattenlosigkeit
- 3 Die Rolle des Geldes
- 4 Die zweite Begegnung mit dem grauen Mann
- 4.1 Das eigentliche Ziel und die diabolischen Verführungskünste
- 4.2 Warum der zweite Vertrag scheitert
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Chamissos Novelle "Peter Schlemihls wundersame Geschichte" mit Fokus auf den Pakt zwischen Schlemihl und dem Teufel. Die Zielsetzung besteht darin, Schlemihls Beweggründe für den Verkauf seines Schattens zu analysieren, die Folgen seiner Tat zu beleuchten und die Rolle des Geldes im Kontext der Geschichte zu erörtern. Die zweite Begegnung zwischen Schlemihl und dem Teufel wird ebenfalls betrachtet.
- Schlemihls Beweggründe für den Schattenverkauf
- Die Folgen des Schattenverlusts für Schlemihl
- Die Rolle des Geldes und des materiellen Reichtums
- Die Natur des Paktes und die Täuschung durch den Teufel
- Schlemihls Reaktion auf seine Situation und sein Kampf gegen den Teufel
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Novelle "Peter Schlemihls wundersame Geschichte" ein und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Sie benennt den Fokus auf den Tauschhandel zwischen Schlemihl und dem Teufel und kündigt die Untersuchung von Schlemihls Motiven, den Konsequenzen des Schattenverlusts und die Bedeutung des Geldes an. Die Einleitung hebt die bisherigen Forschungslücken hervor, insbesondere die Neigung, Schlemihl allein für seine Tat verantwortlich zu machen, ohne die Umstände ausreichend zu berücksichtigen. Sie verspricht eine differenzierte Analyse, welche auch die Reaktionen der Gesellschaft auf Schlemihls Schattenlosigkeit beleuchtet und die Rolle der zweiten Begegnung mit dem Teufel untersucht.
2 Das Geschäft mit dem Teufel: Dieses Kapitel analysiert den Tauschhandel zwischen Schlemihl und dem Teufel im Detail. Es untersucht zunächst die Gründe für Schlemihls Entscheidung, seinen Schatten zu verkaufen. Hierbei werden sowohl seine prekären finanziellen Verhältnisse als auch seine Naivität und Unwissenheit über die Konsequenzen seines Handelns beleuchtet. Das Kapitel beleuchtet Schlemihls materialistische Begierde und den Einfluss der Gesellschaft auf seine Entscheidung. Der zweite Teil des Kapitels befasst sich mit den Folgen der Schattenlosigkeit, inklusive Schlemihls sozialer Ausgrenzung und den grotesken Reaktionen der Gesellschaft. Der unermessliche Reichtum wird als Quelle des Elends für Schlemihl dargestellt, welcher durch den Verlust seines Schattens seine Normalität und Freiheit verliert.
Schlüsselwörter
Peter Schlemihl, Chamisso, Schatten, Teufel, Pakt, Geld, Reichtum, Materialismus, soziale Ausgrenzung, Naivität, Freiheit, Identität, Verführung, Folgen, Konsequenzen.
Häufig gestellte Fragen zu Chamissos "Peter Schlemihls wundersame Geschichte"
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Die HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine wissenschaftliche Arbeit zu Chamissos Novelle "Peter Schlemihls wundersame Geschichte". Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Schlüsselwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Analyse des Pakts zwischen Schlemihl und dem Teufel, Schlemihls Beweggründen, den Konsequenzen des Schattenverlusts und der Rolle des Geldes.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht detailliert den Pakt zwischen Peter Schlemihl und dem Teufel. Im Mittelpunkt stehen Schlemihls Beweggründe für den Verkauf seines Schattens, die Folgen seines Handelns (soziale Ausgrenzung, Verlust der Identität), die Rolle des Geldes und des materiellen Reichtums, die Natur des Teufelspakts und die Täuschung durch den Teufel, sowie Schlemihls Reaktion auf seine Situation und seinen Kampf gegen den Teufel. Die zweite Begegnung zwischen Schlemihl und dem Teufel wird ebenfalls analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über das Geschäft mit dem Teufel (inkl. der Gründe für den Schattenverkauf und den Folgen der Schattenlosigkeit), ein Kapitel über die Rolle des Geldes, ein Kapitel über die zweite Begegnung mit dem grauen Mann (inkl. dessen diabolischer Verführungskünste und dem Scheitern des zweiten Vertrags) und ein Fazit.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit (laut Zusammenfassung)?
Die Zusammenfassung hebt hervor, dass Schlemihls Entscheidung, seinen Schatten zu verkaufen, sowohl durch seine prekären finanziellen Verhältnisse als auch durch Naivität und Unwissenheit über die Konsequenzen beeinflusst wurde. Der unermessliche Reichtum wird als Quelle des Elends dargestellt, da Schlemihl durch den Verlust seines Schattens seine Normalität und Freiheit verliert. Die Arbeit kritisiert auch die Tendenz, Schlemihl allein für seine Tat verantwortlich zu machen, ohne die gesellschaftlichen Umstände ausreichend zu berücksichtigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Peter Schlemihl, Chamisso, Schatten, Teufel, Pakt, Geld, Reichtum, Materialismus, soziale Ausgrenzung, Naivität, Freiheit, Identität, Verführung, Folgen, Konsequenzen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke konzipiert und dient der Analyse der Thematik in strukturierter und professioneller Weise. Sie eignet sich für Studenten, Wissenschaftler und alle, die sich für Chamissos Novelle und deren Interpretation interessieren.
- Quote paper
- Robert Willrich (Author), 2006, Peter Schlemihls Pakt mit dem Teufel und seine Auswirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73664