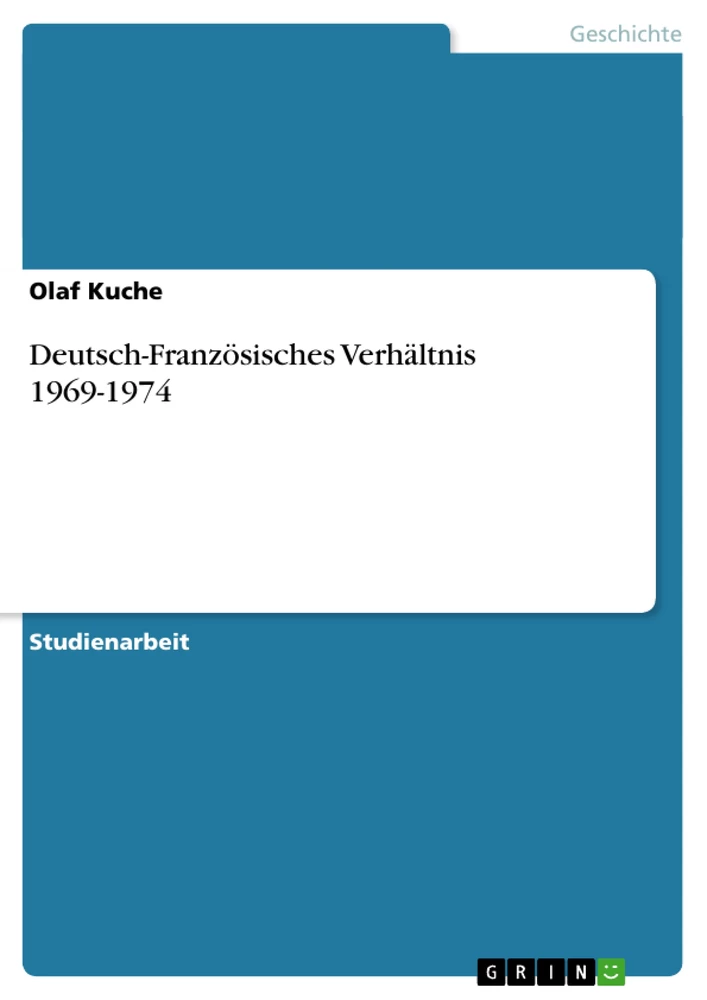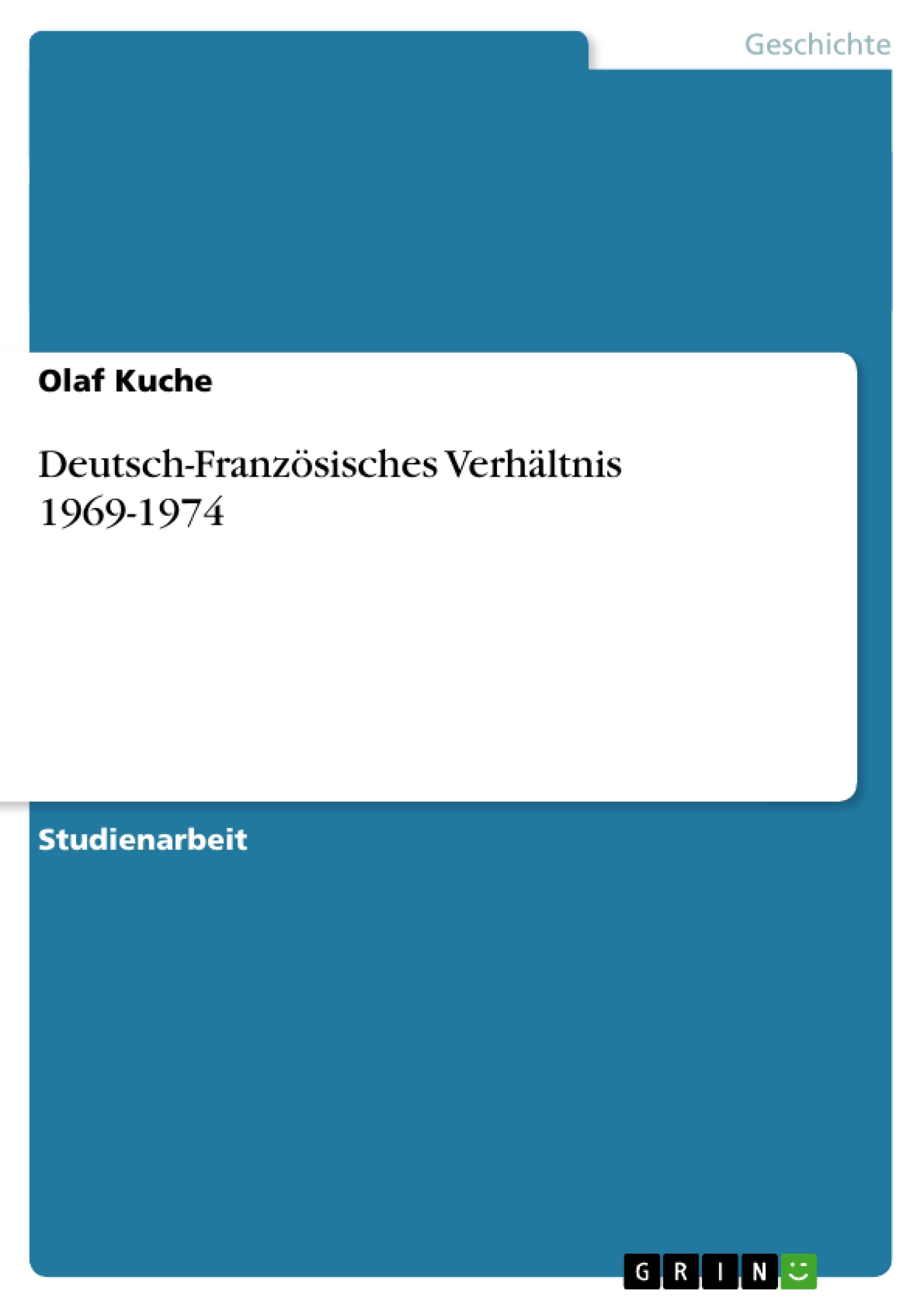Die Einsicht in die Überlegenheit kooperativen Verhaltens selbst in einer "Welt von Egoisten" hat sich in der internationalen Politik erst relativ spät durchgesetzt. In dem Maße aber, in dem Interdependenz als vorherrschendes Charakteristikum der Staatenbeziehung untereinander in das Bewußtsein von Politikern wie auch Politikwissenschaftlern rückte, wuchs auch das Interesse an dem Phänomen der internationalen Kooperation. In einer Welt, in der eine zunehmende internationale Verflechtung die Eigenständigkeit binnenstaatlichen Geschehens aufhebt, technische Kommunikationsfortschritte geographische Distanzen überwinden und die Bedeutung internationaler Austauschprozesse dramatisch zunimmt, wächst auch das Bedürfnis nach internationaler Steuerung. Dieser inzwischen allgemeingültigen Erkenntnis ging ein langer Lernprozeß voraus, der auf der außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitischen Handlungsebene der Bundesrepublik Deutschland und ihrer europäischen Verbündeten in den 70er Jahren, auf die sich die vorliegende Arbeit konzentriert, seine entscheidenden Impulse aus der Ost-West-Konfrontation bezog. Im Verlauf des sogenannten "Kalten Krieges", in dem die USA und ihre westeuropäischen Verbündeten seit Beginn der 50er Jahre in permanenter Verteidigungsbereitschaft gegen eine mögliche Aggression des von der Sowjetunion hegemonisierten Ostblocks gegenüberstanden, hatte sich Europa zu einer Region der Hochrüstung und des "löcherigen Friedens" entwickelt. Parallel zu dieser bedrohlichen Situation - als Ursache und Folge zugleich - wuchs auch die Rivalität unter den westeuropäischen Staaten, die sich am deutlichsten in der Sonderrolle Frankreichs widerspiegelte. Besonders während der Regierungszeit von Staatspräsident Charles de Gaulle (1958-1969) verprellte Frankreich durch spektakuläre Alleingänge die europäischen Partner im sicherheits- und wirtschaftspolitischen Bündnissystem. So blockierte z.B. General de Gaulle lange Jahre den EWG-Beitritt Großbritanniens, boykottierte die EG-Institutionen 1965/66 und erklärte einseitig den Austritt aus der integrierten NATO-Verteidigungsorganisation 1966. Erst aufgrund der sich wandelnden politischen Rahmenbedingungen (Rücktritt von de Gaulle 1969; Amtsantritt des ersten SPD-Kanzlers Willy Brandt in Deutschland ebenfalls 1969) setzte Anfang der 70er Jahre ein Umdenken ein, das zu einer intensiveren Kooperation der westeuropäischen Staaten führen sollte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung.
- II. Zur Vorgeschichte der europäischen Einigungsbestrebungen..
- 1. Die Montanunion als Wegbereiter der EWG
- 2. Motivationen französischer Europapolitik.
- 3. Bedeutung der \"Relance européenne\"-Initiative ......
- III. Neuorientierung der Europapolitik.
- 1. Die Gipfelkonferenz in Den Haag 1969.
- 2. Deutsche Europapolitik Anfang der 70er Jahre
- 3. Erweiterung der EWG
- IV. Ausbau der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
- 1. Der,,Werner-Plan\".
- 2.,,Krönungs- und Motorthese“.
- V. Währungskrise und endgültiges Scheitern der WWU...
- 1. Die Erweiterung der Gemeinschaft und ihre Folgen .
- 2. Die Geldkrise 1971 und das Ende des Bretton-Woods-Systems
- 3. Scheitern der WWU....
- VI. Anfänge der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ)..
- 1. Der Luxemburger und der Kopenhagener Bericht.
- 2. Leistungsvermögen der EPZ ..
- 3. Die EPZ als integratives Moment...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen im Zeitraum von 1969 bis 1974. Sie beleuchtet die Initiative zur "Relance Europèene" und untersucht die Ursachen und Folgen für die europäische Integration.
- Die "Relance Europèene" als politische Initiative
- Die Rolle Deutschlands und Frankreichs in der europäischen Integration
- Die Bedeutung der "Krönungs- und Motorthese" für die europäische Zusammenarbeit
- Die Herausforderungen der Währungskrise und des Scheiterns der Wirtschafts- und Währungsunion
- Die Anfänge der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die historische Entwicklung der internationalen Kooperation und betont die Bedeutung der europäischen Integration im Kontext der Ost-West-Konfrontation. Kapitel II untersucht die Vorgeschichte der europäischen Einigungsbestrebungen, insbesondere die Rolle der Montanunion und die Motivationen der französischen Europapolitik. Kapitel III beleuchtet die Neuorientierung der Europapolitik im Zuge der "Relance Europèene", einschließlich der Gipfelkonferenz in Den Haag und der deutschen Europapolitik der frühen 1970er Jahre. Kapitel IV analysiert den Ausbau der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und die "Krönungs- und Motorthese".
Kapitel V behandelt die Währungskrise und das Scheitern der Wirtschafts- und Währungsunion. Hierbei werden die Folgen der Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft, die Geldkrise von 1971 und das Ende des Bretton-Woods-Systems beleuchtet. Kapitel VI beschäftigt sich mit den Anfängen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ), einschließlich des Luxemburger und Kopenhagener Berichts sowie des Leistungsvermögens und der integrierenden Funktion der EPZ.
Schlüsselwörter
Deutsch-Französisches Verhältnis, "Relance Europèene", Europäische Integration, Wirtschafts- und Währungsunion, "Krönungs- und Motorthese", Währungskrise, Bretton-Woods-System, Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ), Ost-West-Konfrontation.
Häufig gestellte Fragen
Was war die „Relance Européenne“?
Die „Relance Européenne“ war eine politische Initiative zur Wiederbelebung der europäischen Integration, die Ende der 1960er Jahre, insbesondere nach dem Rücktritt de Gaulles, an Fahrt gewann.
Welche Rolle spielte die Gipfelkonferenz in Den Haag 1969?
Die Konferenz markierte einen Wendepunkt, der den Weg für die Erweiterung der EG (z. B. Beitritt Großbritanniens) und die engere politische Zusammenarbeit ebnete.
Was besagt die „Krönungs- und Motorthese“?
Diese Thesen beschreiben unterschiedliche Ansätze zur europäischen Integration: Entweder als Abschluss eines wirtschaftlichen Prozesses (Krönung) oder als treibende Kraft für weitere Einigung (Motor).
Warum scheiterte die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) in den 70ern?
Das Scheitern wurde primär durch die Währungskrise von 1971 und das Ende des Bretton-Woods-Systems verursacht.
Was verbirgt sich hinter der Abkürzung EPZ?
EPZ steht für Europäische Politische Zusammenarbeit, die Vorläuferin der heutigen Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU.
Wie beeinflusste die Ost-West-Konfrontation die europäische Politik?
Die Bedrohung durch den Kalten Krieg war ein wesentlicher Impuls für die Notwendigkeit internationaler Steuerung und Kooperation in Westeuropa.
- Quote paper
- Olaf Kuche (Author), 2001, Deutsch-Französisches Verhältnis 1969-1974, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7368