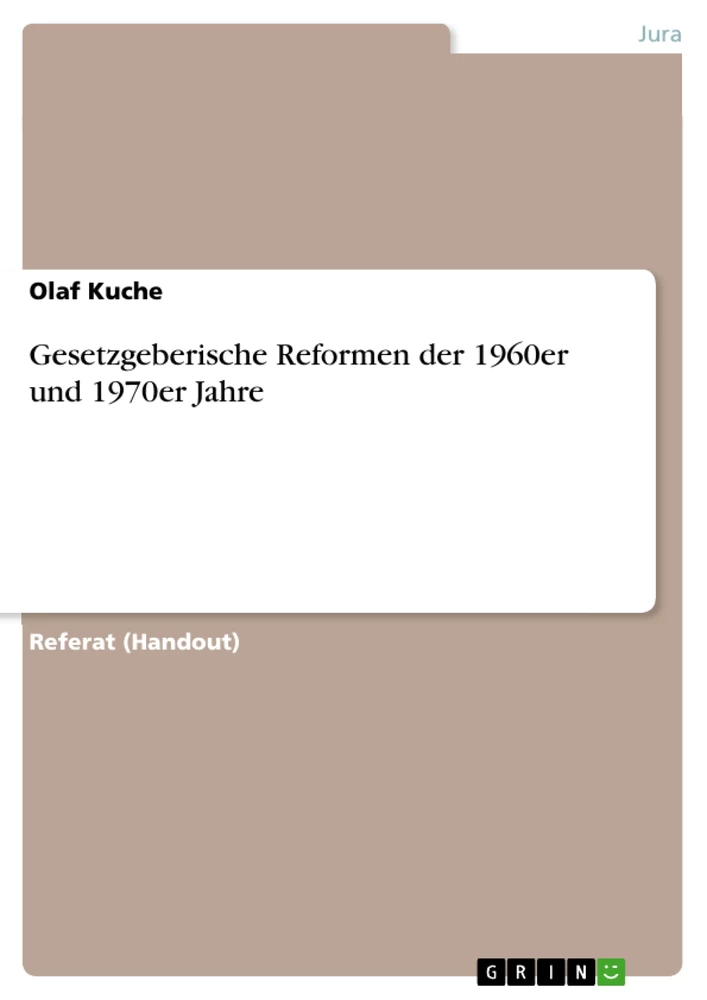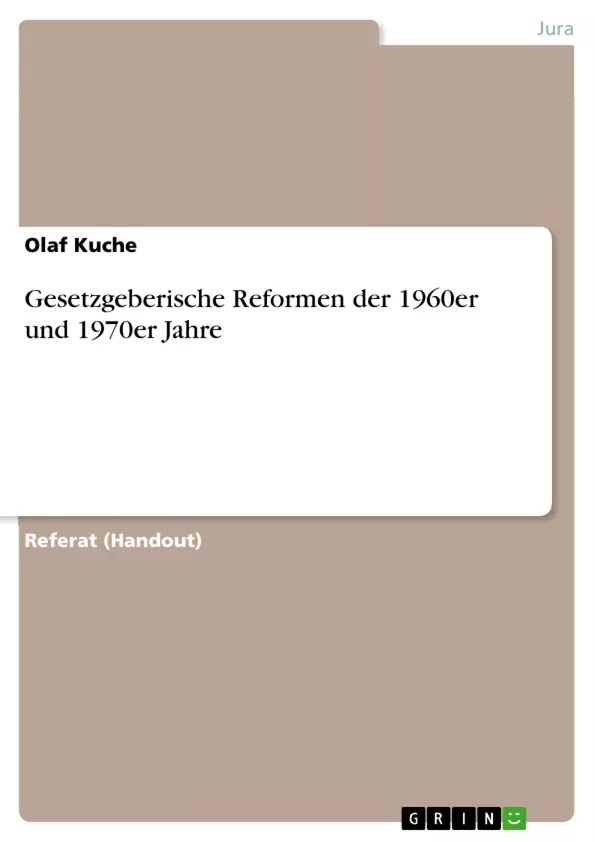"Gesetzgeberische Reformen der 1960er und 1970er Jahre"
Bildungs- und Universitätsreform/ Masse statt Klasse
Die seriöse politische wie wissenschaftliche Diskussion über eine Reformierung des Bildungswesens wird Mitte der 60er Jahre zunehmend durch einen ideologischen Disput ersetzt. Es ging nun nicht mehr um ein Optimierung des bestehenden Systems, sondern um radikale Umwälzungen der bestehenden Strukturen. Die von marxistischen Theoretikern entwickelte Kritik an den herrschenden Machtverhältnissen in den modernen Industriegesellschaften begeisterten vor allem die studentische Jugend und die progressiven Bildungspolitiker. Die entscheidenden Impulse für die Formulierung ihrer gesellschaftskritischen Thesen lieferten der Studentengeneration dabei die Begründer der Frankfurter Schule (Max Horkheimer, Theodor Adorno und Herbert Marcuse).
Doch schon bald zeigte sich, daß die klassenkämpferischen Aufrufe zur Revolutionierung der Gesellschaft weder bei der Arbeiterschaft noch dem breiten bürgerlichen Mittelstand größere Resonanz fanden und so wurde die Diskussion bald ausschließlich innerhalb des Hochschulbereichs geführt. Hier erschien eine totale Veränderung des Bildungswesens der richtige Hebel zu sein, um die bisherigen gesellschaftlichen Strukturen zu reformieren. Unter den propagandistisch äußerst wirkungsvollen Schlagworten wie "Demokratisierung der Bildungsinstitutionen", "Förderung der Chancengleichheit", Leistungsgerechtigkeit" und "soziale Integration", wurden Anfang der 60er Jahre die ersten Reformen in Angriff genommen.
Inhaltsverzeichnis
- Ausgangssituation in den 60er Jahren
- Die seriöse politische wie wissenschaftliche Diskussion über eine Reformierung des Bildungswesens wird Mitte der 60er Jahre zunehmend durch einen ideologischen Disput ersetzt.
- Doch schon bald zeigte sich, daß die klassenkämpferischen Aufrufe zur Revolutionierung der Gesellschaft weder bei der Arbeiterschaft noch dem breiten bürgerlichen Mittelstand größere Resonanz fanden und so wurde die Diskussion bald ausschließlich innerhalb des Hochschulbereichs geführt.
- An den Hochschulen organisierten sich Interessengruppen, bestehend aus progressiven Professoren sowie Vertretern der Assistentenschaft und der Studenten, die die alte Ordinarienuniversität reformieren und durch ein Modell der Gruppenuniversität - in der Regel mit drittelparitätischer Besetzung der Entscheidungsgremien - ablösen wollten.
- Doch die Reformen im Hochschulbereich kamen vielen Studenten „zu langsam“ voran, so daß sie mit ihren Forderungen auf die Straße gingen, um so die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen.
- Die Mitbestimmung in der gesellschaftspolitischen Diskussion
- Daraufhin räumte die Politik den öffentlichen Forderungen nach Bildungsreformen und damit auch der Mitbestimmung einen nie dagewesenen Stellenwert ein.
- Zu diesem Zweck wurde eine Verfassungsänderung angestrengt, die dem Bund mehr Gesetzgebungsbefugnisse nicht nur bei der Ausbildungsbeihilfe und Förderung der wissenschaftlichen Forschung einräumen, sondern vor allen Dingen auch die Rahmenplanung der allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens beinhaltete sollte.
- Das neu gegründete Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, welches aus dem ehemaligen Forschungsministerium entstand, fungierte dabei als gesetzgeberische Planungsstelle für die bildungspolitischen Ziele der neuen Regierung, die nach der Verfassungänderung nun ihre Vorstellungen umsetzen konnte.
- Die Folgen des Hochschulrahmengesetzes vom 1. Juli 1970
- Die Versuche, durch die neuen Bildungsrichtlinien die innere Verfassung der Universitäten neu zu ordnen, verstärkte sich nach 1970.
- In der Folgezeit entspann sich eine heftige Kontroverse über die Legitimität der Grundrechts-Novellierung.
- Es war nicht verwunderlich, daß selbst die CDU-regierten Länder von der Reform-Euphorie ergriffen wurden.
- Bei der Diskussion beriefen sich beide Lager – das der funktionsgerechten Mitbestimmung und das der paritätischen Mitbestimmung in ihrer Argumentation auf das Grundgesetz und nahmen für sich in Anspruch, durch ihre Vorstellung die Verfassung der Bundesrepublik zu verwirklichen.
- Mit der Verabschiedung eines Vorschaltgesetzes vom 26.10.1971 für ein späteres Niedersächsisches Gesamthochschulgesetz verließ die inzwischen festgefahrene Mitbestimmungsdiskussion endgültig die politische Ebene.
- Das Vorschaltgesetz als Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde
- Das Gesetz sah vor, daß die Entscheidungsgremien in den Universitäten durchgehend in folgendem Verhältnis von vier (Hochschullehrer) zu zwei (wissenschaftliche Mitarbeiter) zu zwei (Studentenvertreter) zu zwei (nichtwissenschaftliche Mitarbeiter) besetzt werde.
- Daraufhin zogen 400 Professoren und Dozenten der Universitäten und Fachhochschulen vor das Bundesverfassungsgericht.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die gesellschaftspolitische Debatte über Bildungsreformen in den 1960er und 1970er Jahren, insbesondere die Rolle der Mitbestimmung und ihre Auswirkungen auf das Hochschulwesen in der Bundesrepublik Deutschland. Sie untersucht die Ursachen und die Entwicklung dieser Debatte, die zum Hochschulrahmengesetz von 1970 und dem anschließenden Vorschaltgesetz von 1971 führten.
- Die Ideologie und Kritik der Studentenbewegung und deren Einfluss auf die Bildungspolitik.
- Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts und die Rechtsprechung zur Mitbestimmung in der Hochschule.
- Die Folgen der Hochschulreformen für die deutsche Universitätslandschaft und ihre Auswirkungen auf die wissenschaftliche Freiheit.
- Die verschiedenen Perspektiven auf die Mitbestimmung: Von der funktionsgerechten Mitbestimmung bis zur paritätischen Mitbestimmung.
- Die Spannungen zwischen den verschiedenen Akteuren: Professoren, Studenten, Assistenten und die Politik.
Zusammenfassung der Kapitel
- Ausgangssituation in den 60er Jahren: Dieses Kapitel beschreibt den ideologischen Kontext der 1960er Jahre, der von Studentenprotesten und dem Wunsch nach einer radikalen Umwälzung der Bildungsstrukturen geprägt war. Es beleuchtet den Einfluss marxistischer Theorien auf die Studentenbewegung und die Kritik an den bestehenden Machtverhältnissen in der Gesellschaft. Außerdem werden die ersten Reformversuche im Hochschulbereich und die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Professorenschaft dargestellt.
- Die Mitbestimmung in der gesellschaftspolitischen Diskussion: Dieses Kapitel schildert die zunehmende Bedeutung der Mitbestimmungsdiskussion in der öffentlichen Debatte und den Einfluss der sozial-liberalen Regierung von Willy Brandt auf die Bildungsreformen. Es beschreibt die Verfassungsänderungen, die dem Bund mehr Gesetzgebungsbefugnisse im Hochschulwesen einräumten, und die Gründung des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft.
- Die Folgen des Hochschulrahmengesetzes vom 1. Juli 1970: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen des Hochschulrahmengesetzes auf die Universitätsverfassung und die Debatte über die Grenzen der Übertragbarkeit des Demokratiebegriffes auf die Universität. Es analysiert die Kritik der Professorenschaft an der Mitbestimmung und die unterschiedlichen Positionen der politischen Parteien zu diesem Thema.
- Das Vorschaltgesetz als Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde: Dieses Kapitel behandelt das Vorschaltgesetz von 1971, das eine paritätische Mitbestimmung in den Hochschulen einführte und zu einer Verfassungsbeschwerde von 400 Professoren und Dozenten führte. Es analysiert die Argumente der Beschwerdeführer und die potentielle Verletzung von Grundrechten durch das Gesetz.
Schlüsselwörter
Hochschulreform, Mitbestimmung, Studentenbewegung, Hochschulrahmengesetz, Vorschaltgesetz, Grundrechte, Freiheit der Wissenschaft, Demokratie, Universitätsverfassung, Bildungspolitik, Marxismus, Frankfurter Schule, Bundesverfassungsgericht, Verfassung.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Auslöser für die Bildungsreformen der 1960er Jahre?
Ein ideologischer Disput, getrieben von der Studentenbewegung und gesellschaftskritischen Thesen der Frankfurter Schule (Adorno, Horkheimer), forderte radikale Umwälzungen statt bloßer Optimierung.
Was ist das Modell der "Gruppenuniversität"?
Es sollte die alte Ordinarienuniversität ablösen und sah eine Mitbestimmung verschiedener Gruppen (Professoren, Assistenten, Studenten) in den Entscheidungsgremien vor.
Welche Bedeutung hatte das Hochschulrahmengesetz von 1970?
Es war der Versuch des Bundes, durch Rahmenplanung allgemeine Grundsätze für das Hochschulwesen festzulegen und die innere Verfassung der Universitäten neu zu ordnen.
Warum klagten 400 Professoren vor dem Bundesverfassungsgericht?
Sie richteten sich gegen das Vorschaltgesetz von 1971, das paritätische Mitbestimmungsverhältnisse vorsah, welche sie als Verletzung der Freiheit der Wissenschaft und ihrer Grundrechte ansahen.
Welche Schlagworte prägten die Reformdiskussion?
Zentral waren Begriffe wie "Demokratisierung der Bildungsinstitutionen", "Chancengleichheit", "Leistungsgerechtigkeit" und "soziale Integration".
- Arbeit zitieren
- Olaf Kuche (Autor:in), 2000, Gesetzgeberische Reformen der 1960er und 1970er Jahre, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7369