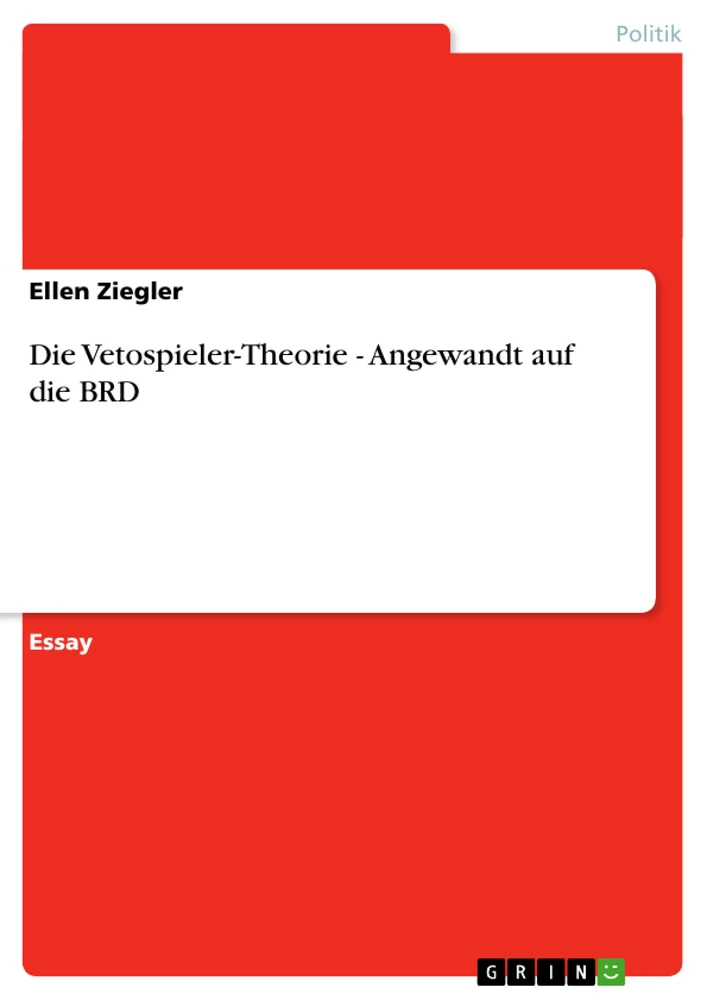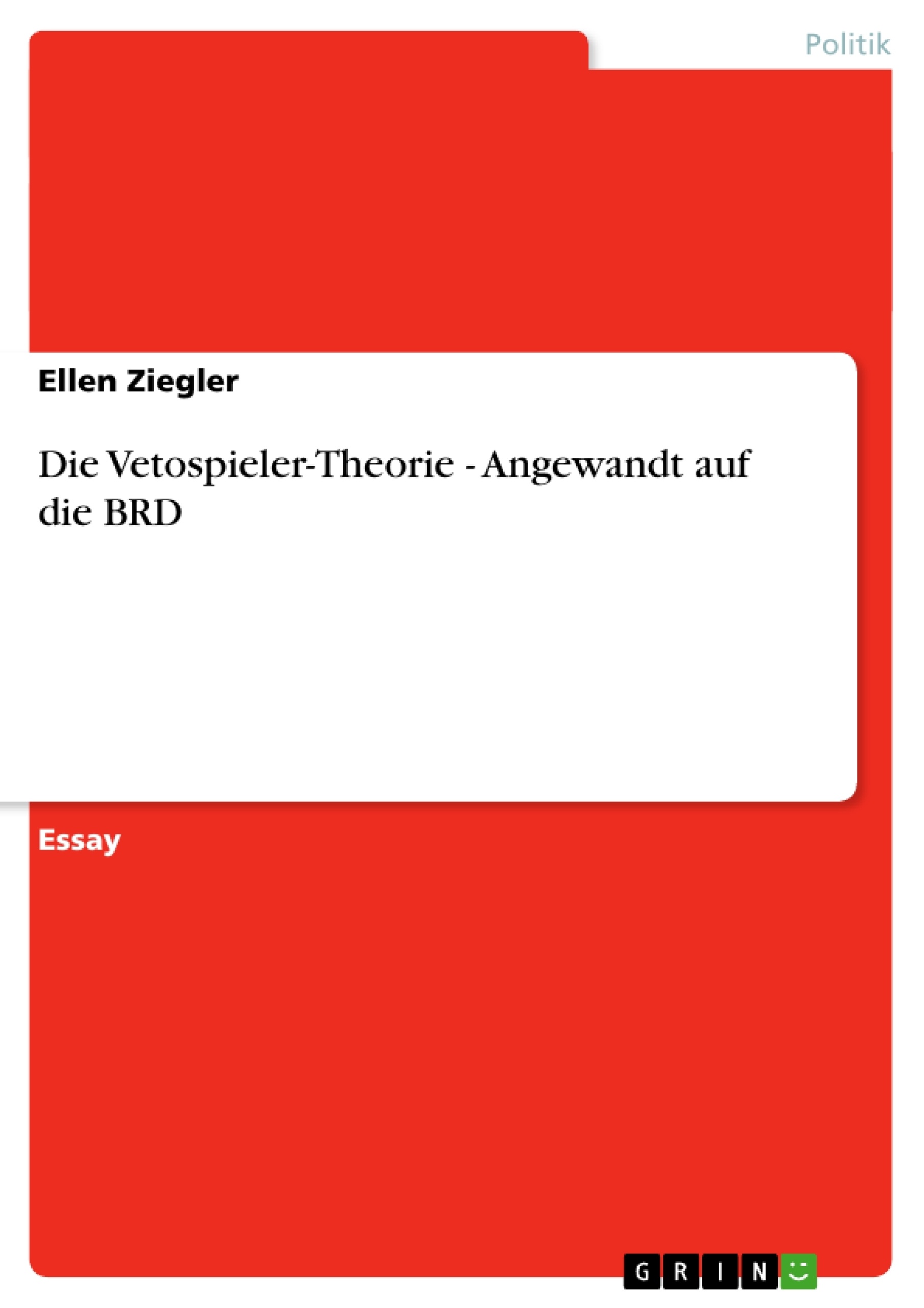Die Vetospieler Theorie des Amerikaners George Tsebelis, Professor an der Universität von Kalifornien, ist das neuartige und gleichzeitig Bahnbrechende Ergebnis, eines in den frühen 1990er Jahren begonnenen Bestrebens, für den Vergleich politischer Systeme einen methodisch wie theoretisch völlig neuen, aber zugleich auch möglichst einfachen und modernen Bezugsrahmen zu entwickeln. Tsebelis verabschiedet sich, von der in der traditionellen Politikwissenschaft bevorzugten dichotomen Einteilungen politischer Systeme z.B. in parlamentarische versus präsidentielle Systeme. Tsebelis fragt, welche institutionellen oder parteilichen Akteure bei Entscheidungen zustimmen müssen, bevor der Status quo einer Policy verändern wird. Neben den institutionellen und parteilichen Vetospielern existieren auch noch sonstige Vetospieler, diese sind z.B. Verbände oder Interessengruppen. (vgl. Merkel 2003: 255f.). In seinem Buch Veto Players: How Political Institutions Work aus dem Jahr 2002 glaubt Tsebelis mit den drei Parametern: Zahl der Vetospieler, policy congruence und der internen Kohäsion der Spieler einen Ansatz gefunden zu haben, mit dem man Stabilität und Wandel von Policies erklären und voraussagen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fallbeispiele zur Vetospieler - Theorie
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vetospieler-Theorie von George Tsebelis und ihre Anwendbarkeit auf die Bundesrepublik Deutschland. Das Ziel ist es, zu erforschen, inwiefern die Theorie die Stabilität und den Wandel von Policies in Deutschland erklären kann.
- Die Vetospieler-Theorie und ihre zentralen Annahmen
- Die Rolle von Vetospielern in der deutschen Politik
- Die Anwendung der Vetospieler-Theorie auf konkrete Fallbeispiele (Steuerreform, Rentenreform, Arbeitsmarktreform)
- Kritik und Bewertung der Theorie im Hinblick auf die deutsche Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Vetospieler-Theorie von George Tsebelis vor und erläutert, wie sie für den Vergleich politischer Systeme eingesetzt werden kann. Die Theorie basiert auf der Annahme, dass politische Entscheidungen von Akteuren beeinflusst werden, die ein Veto einlegen können. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Theorie auf die Bundesrepublik Deutschland anwendbar ist und welche Auswirkungen sie auf die deutsche Politik hat.
Fallbeispiele zur Vetospieler - Theorie
Dieses Kapitel stellt drei Fallbeispiele aus der deutschen Politik vor: die Steuerreform aus dem Jahr 2000, die Rentenreform aus dem Jahr 2001 und die ausgebliebene Reform des Arbeitsmarktes. Die Fallbeispiele sollen zeigen, wie die Vetospieler-Theorie konkret auf politische Prozesse in Deutschland angewendet werden kann.
Schlussbetrachtung
Die Schlussbetrachtung soll die Aussagekraft der Vetospieler-Theorie im Hinblick auf die Bundesrepublik Deutschland kritisch diskutieren. Es werden die Stärken und Schwächen der Theorie beleuchtet und ihre Relevanz für die Analyse der deutschen Politik bewertet.
Schlüsselwörter
Vetospieler, Politik, Reform, Politikfeld, Status Quo, Stabilität, Wandel, Bundesrepublik Deutschland, Steuerreform, Rentenreform, Arbeitsmarktreform, Koalition, Bundestag, Bundesrat, Parteien, Interessengruppen, Kongruenz, Kohäsion, Tsebelis.
- Quote paper
- Ellen Ziegler (Author), 2007, Die Vetospieler-Theorie - Angewandt auf die BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73690