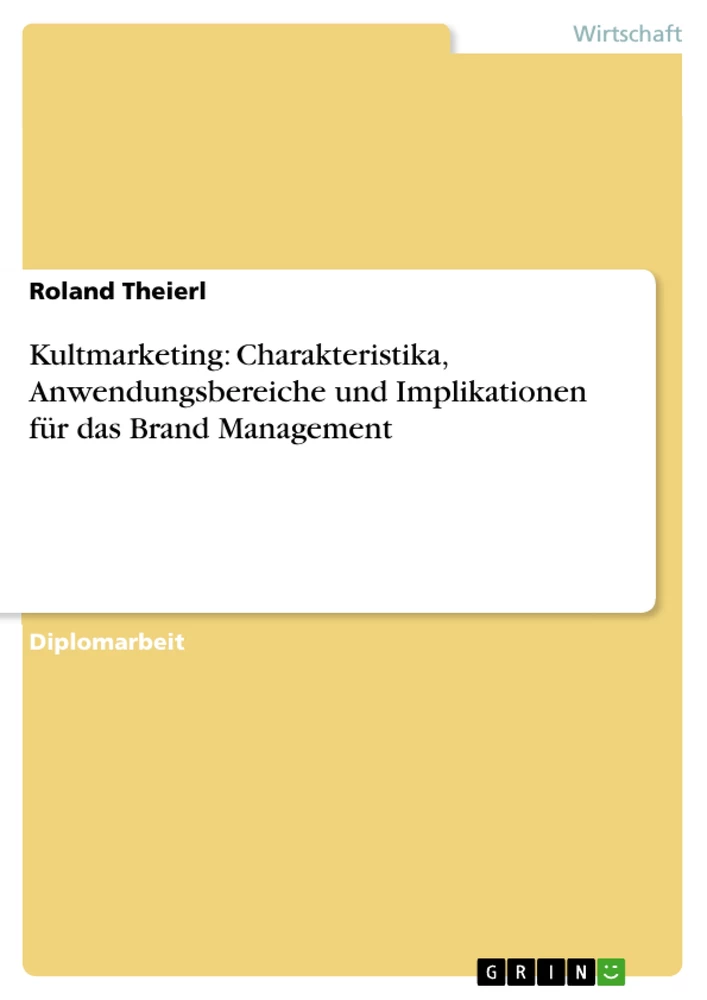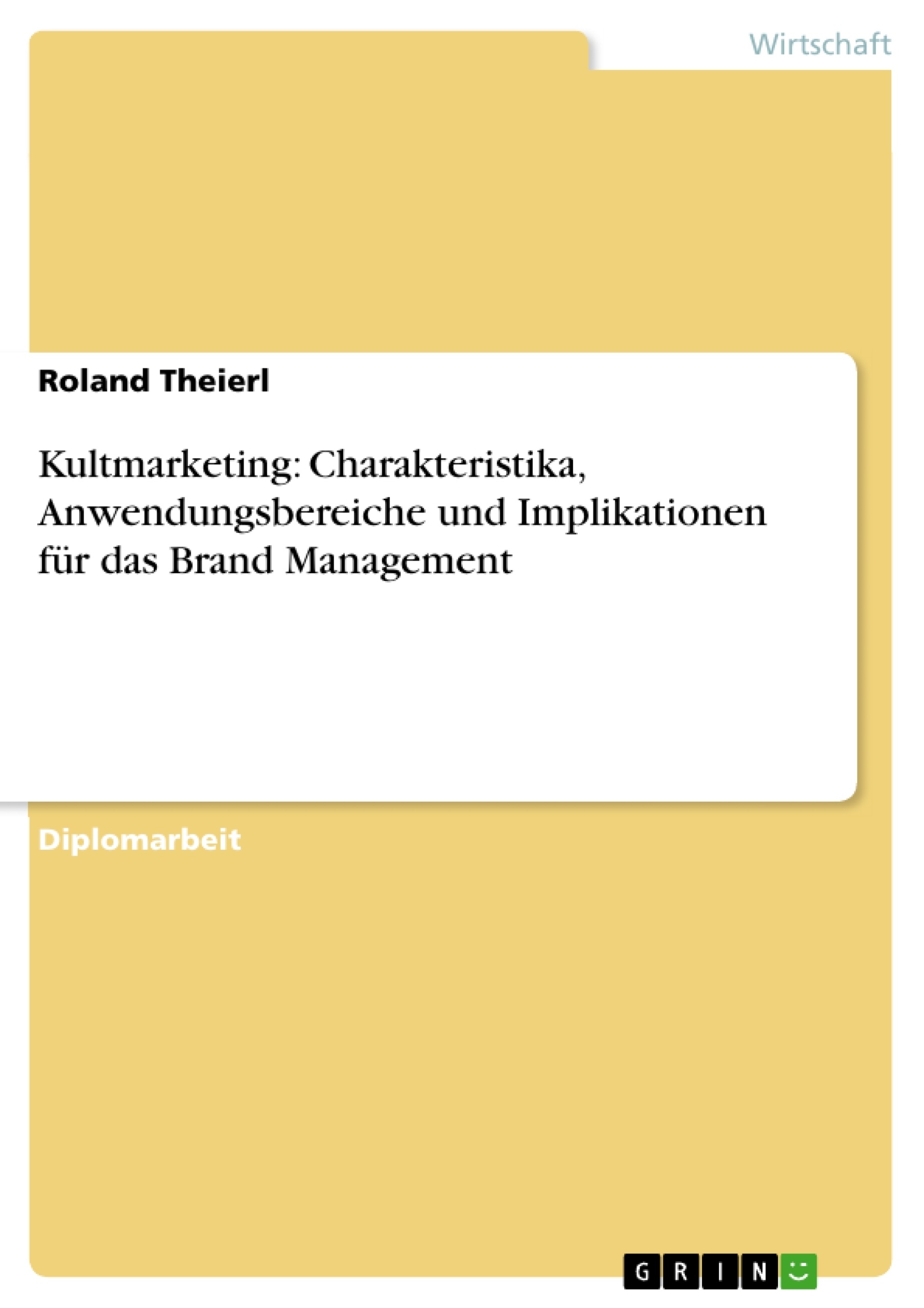Die Massenproduktion ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrunderst ermöglichte eine breite, undifferenzierte Marktbearbeitung, die in den Sechsziger- und Siebziger-Jahren in ein Überangebot an Waren mündete. Erstmals in der Geschichte gab es mehr Angebot als Nachfrage. Auch die Produkte selbst wurden immer ähnlicher und damit austauschbar. Es vollzog sich ein Wandel von Verkäufer- zu Käufermärkten. Diese Veränderung verlangte von Unternehmen eine zielgruppenspezifische Verbraucherorientierung.
Wettbewerbsvorteile wurden nicht mehr duch Produktüberlegenheit erzielt, sondern durch ein überlegenes Marketing. Insbesonders die Markenbildung gewann hierbei immer mehr an Bedeutung. Eines der aktuellsten Begriffe des Markenmanagements stellt hierbei die Kultmarke dar. Produktmythos, Iconic Brands, Emotional Branding – dies sind nur einige damit verbundene Schlagwörter. Doch was steckt wirklich hinter dem aktuellen Kult um die Kultmarken? Nur ein gezielter Hype von Werbeagenturen oder doch eine klare Strategie aus der Markenkrise?
Was unterscheidet nun eine Kultmarke von klassischen Marken? Welche Kultmarketingmethoden werden angeboten? Sprechen die allgemeinen sozio-kulturellen und ökonomischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Kultmarketing? Welche Erfolgsvoraussetzungen müssen dafür innerhalb des Unternehmens gegeben sein? Sind die Methoden des Kultmarketings universell einsetzbar oder speziell für bestimmte Phasen des Produktlebenszyklus angedacht? Und wo liegen die Gefahren und Probleme des Kultmarketings?
Aus dieser Problemstellung läßt sich die für die vorliegende Diplomarbeit zentrale Forschungsfrage ableiten:
Stellt Kultmarketing eine neue, ernst zu nehmende Strategie zur Markenbildung dar und läßt sich ein Modell zur Bildung von Kultmarken erarbeiten?
Ziel dieser Arbeit ist es, das Phänomen „Kultmarken“ zu analysieren, und die damit verbundenen Marketingtools vor dem existierenden Theorie- und Literaturhintergrund strukturiert zusammen zu fassen. Es soll untersucht werden, in wie weit sich Kultmarken von ‚normalen Marken’ unterscheiden und welche neuen Ansätze das Kultmarketing hinsichtlich Markenbildung offeriert. Die in der Literatur zu diesem Thema angebotenen Marketingmethoden sollen strukturiert ausgearbeitet werden und zu einem Modell zur Bildung von Kultmarken zusammengefaßt werden. Dieses Modell wird in weiterer Folge anhand von drei Fallbeispielen aus der Praxis auf seine Gültigkeit überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfragen
- 1.2 Untersuchungskonzept & Erhebungsmethode
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Begriffliche Grundlagen
- 2.1 Kult
- 2.1.1 Etymologie des Begriffes Kult inklusive historischer Verweise
- 2.1.2 Umfassendere Definitionen von Kult
- 2.1.3 Abgrenzung zur Sekte
- 2.1.4 Abschließende Bemerkung zur Definition von Kult
- 2.1.5 Theorien über die Beweggründe, Kulten beizutreten
- 2.1.5.1 Zugehörigkeit
- 2.1.5.2 Identitätsstiftung
- 2.2 Marke
- 2.2.1 Etymologie des Begriffes Marke inklusive historischer Verweise
- 3 Markenbildung anhand des Customer-Based Brand Equity Modells von Keller
- 3.1 Brand Building Blocks
- 3.2 Markenidentität/-abhebung
- 3.3 Markenbedeutung
- 3.4 Markenresponse
- 3.5 Markenbeziehung
- 4 Einordnung der Kultmarke in das Markensystem
- 4.1 Konsumentenverhalten und Markenverwendung
- 4.2 Definition Kultmarken
- 4.2.1 Abgrenzung zu „Iconic Brands”
- 5 Allgemeine Erfolgsvoraussetzungen von Kultmarken
- 5.1 Vorgehensweise bei der Suche nach Erfolgsfaktoren
- 5.2 Externe Rahmenbedingungen: Umweltanalyse
- 5.2.1.1 Sozio-kulturelle Umweltbedingungen
- 5.2.1.2 Ökonomische Bedingungen
- 5.3 Unternehmensinterne Erfolgsvoraussetzungen für Kultmarken
- 6 Modell zur Bildung von Kultmarken
- 6.1 Charakteristika von Kultmarken
- 6.2 Kult & Marketing
- 6.2.1 Marketingtechniken von Kultgemeinschaften
- 6.2.1.1 Abgrenzung
- 6.2.1.2 Initiation/Einführung
- 6.2.1.3 Sitten, Pflichten und Gebräuche
- 6.2.1.4 Ideologie
- 6.2.2 Von Marketingmethoden der Kultgemeinschaften zum Kultmarketing
- 6.3 Strategien des Kultmarketings anhand des STP-Ansatzes
- 6.3.1 Segmentierung
- 6.3.1.1 Szenemarketing als Segmentierungsansatz
- 6.3.1.2 Brand Communities
- 6.3.2 Targeting
- 6.3.3 Positioning
- 6.4 Marketing Mix
- 6.4.1 Produktpolitik
- 6.4.1.1 Markensymbolik
- 6.4.2 Kommunikationspolitik
- 6.4.2.1 Community marketing
- 6.4.2.2 Differenzierung durch Abgrenzung
- 6.4.2.3 Connected Marketing
- 6.4.2.4 Word of Mouth / Mundpropaganda / Empfehlungsmarketing
- 6.4.2.5 Virales Marketing
- 6.4.2.6 Buzzmarketing
- 6.4.2.7 Theatralisierung und Inszenierung
- 6.4.3 Distributionspolitik
- 6.4.4 Preispolitik
- 6.5 Zusammenfassung des Kultmarken-Modells
- 6.6 Anwendungsbereiche des Kultmarketings
- 7 Empirischer Teil: Analyse des Kultmarketing-Charakters ausgewählter Marken
- 7.1 Apple Computer
- 7.2 Harley Davidson Motorcycles
- 7.3 Red Bull Energy Drink
- 7.4 Interpretation der Ergebnisse
- 8 Gefahren beim Einsatz des Kultmarketings
- 9 Kritische Betrachtung des Kultmarketings
- 10 Fazit & Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht das Phänomen des Kultmarketings. Ziel ist es, herauszufinden, ob Kultmarketing eine ernstzunehmende Strategie zur Markenbildung darstellt und ob sich ein Modell zur Bildung von Kultmarken entwickeln lässt. Die Arbeit analysiert dazu die relevanten Begrifflichkeiten, untersucht Erfolgsfaktoren und entwickelt ein umfassendes Modell.
- Definition und Abgrenzung von Kultmarken
- Erfolgsfaktoren von Kultmarken (interne und externe Faktoren)
- Strategien und Methoden des Kultmarketings
- Entwicklung eines Modells zur Bildung von Kultmarken
- Anwendungsbereiche und Risiken des Kultmarketings
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Problemstellung, ausgehend von der Entwicklung von Verkäufer- zu Käufermärkten und der steigenden Bedeutung von Markenbildung. Die zentrale Forschungsfrage wird formuliert: Stellt Kultmarketing eine neue, ernstzunehmende Strategie zur Markenbildung dar, und lässt sich ein Modell zur Bildung von Kultmarken erarbeiten?
2 Begriffliche Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die weitere Untersuchung. Es definiert die Begriffe "Kult" und "Marke" einschließlich ihrer historischen Entwicklung und untersucht Theorien über die Motive, Kulten beizutreten (Zugehörigkeit, Identitätsstiftung).
3 Markenbildung anhand des Customer-Based Brand Equity Modells von Keller: Das Kapitel erläutert das Customer-Based Brand Equity Modell von Keller als Rahmen für das Verständnis von Markenbildung. Es beschreibt die einzelnen Bausteine (Brand Building Blocks) und deren Bedeutung für den Aufbau einer starken Marke.
4 Einordnung der Kultmarke in das Markensystem: Dieses Kapitel ordnet den Begriff der Kultmarke in das bestehende Markensystem ein. Es analysiert das Konsumentenverhalten im Zusammenhang mit Kultmarken und grenzt Kultmarken von anderen Markenarten, wie z.B. "Iconic Brands", ab.
5 Allgemeine Erfolgsvoraussetzungen von Kultmarken: Hier werden die allgemeinen Erfolgsvoraussetzungen für Kultmarken untersucht. Es wird zwischen externen Rahmenbedingungen (sozio-kulturelle und ökonomische Umwelt) und unternehmensinternen Faktoren unterschieden.
6 Modell zur Bildung von Kultmarken: Das Kernstück der Arbeit. Dieses Kapitel präsentiert ein Modell zur Bildung von Kultmarken, welches die Charakteristika von Kultmarken, Marketingtechniken von Kultgemeinschaften und Strategien des Kultmarketings (STP-Ansatz) umfasst. Der Marketing-Mix (Produkt-, Kommunikations-, Distributions- und Preispolitik) im Kontext des Kultmarketings wird detailliert beschrieben.
7 Empirischer Teil: Analyse des Kultmarketing-Charakters ausgewählter Marken: Dieser Abschnitt analysiert ausgewählte Marken (Apple, Harley Davidson, Red Bull) auf ihren Kultmarketing-Charakter. Die Ergebnisse werden interpretiert.
8 Gefahren beim Einsatz des Kultmarketings: Dieses Kapitel beleuchtet mögliche Risiken und Gefahren, die mit dem Einsatz von Kultmarketing verbunden sind.
9 Kritische Betrachtung des Kultmarketings: Eine kritische Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen des Kultmarketings.
Schlüsselwörter
Kultmarketing, Kultmarke, Markenbildung, Markenmanagement, Konsumentenverhalten, Customer-Based Brand Equity, STP-Ansatz, Marketing-Mix, Erfolgsfaktoren, sozio-kulturelle Faktoren, ökonomische Faktoren, Brand Community, Szenemarketing.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Kultmarketing - Ein Modell zur Bildung von Kultmarken
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht das Phänomen des Kultmarketings. Das zentrale Ziel ist es, herauszufinden, ob Kultmarketing eine ernstzunehmende Strategie zur Markenbildung darstellt und ob sich ein Modell zur Bildung von Kultmarken entwickeln lässt.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit folgenden zentralen Fragen: Stellt Kultmarketing eine neue, ernstzunehmende Strategie zur Markenbildung dar? Lässt sich ein Modell zur Bildung von Kultmarken erarbeiten? Wie lassen sich Kultmarken definieren und von anderen Markenarten abgrenzen? Welche Erfolgsfaktoren (interne und externe) beeinflussen die Entstehung von Kultmarken? Welche Strategien und Methoden des Kultmarketings existieren? Welche Anwendungsbereiche und Risiken bestehen im Zusammenhang mit Kultmarketing?
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Customer-Based Brand Equity Modell von Keller, welches als Rahmen für das Verständnis von Markenbildung dient. Es werden die Begriffe "Kult" und "Marke" einschließlich ihrer historischen Entwicklung definiert und Theorien über die Motive, Kulten beizutreten (Zugehörigkeit, Identitätsstiftung) untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Begriffliche Grundlagen (Definition von Kult und Marke), Markenbildung nach Keller, Einordnung der Kultmarke, Erfolgsfaktoren von Kultmarken, ein Modell zur Bildung von Kultmarken, empirische Analyse ausgewählter Marken (Apple, Harley Davidson, Red Bull), Gefahren und kritische Betrachtung des Kultmarketings sowie Fazit und Ausblick.
Was beinhaltet das entwickelte Modell zur Bildung von Kultmarken?
Das Modell umfasst die Charakteristika von Kultmarken, Marketingtechniken von Kultgemeinschaften (Initiation, Sitten, Gebräuche, Ideologie), Strategien des Kultmarketings (STP-Ansatz: Segmentierung, Targeting, Positioning) und den Marketing-Mix (Produkt-, Kommunikations-, Distributions- und Preispolitik) im Kontext des Kultmarketings.
Welche Marken werden im empirischen Teil analysiert?
Der empirische Teil analysiert die Marken Apple Computer, Harley Davidson Motorcycles und Red Bull Energy Drink auf ihren Kultmarketing-Charakter.
Welche Strategien und Methoden des Kultmarketings werden diskutiert?
Die Arbeit behandelt verschiedene Strategien und Methoden des Kultmarketings, wie Szenemarketing, Brand Communities, Community Marketing, Differenzierung durch Abgrenzung, Connected Marketing, Word-of-Mouth Marketing, virales Marketing, Buzzmarketing, und Theatralisierung und Inszenierung.
Welche Risiken und Gefahren des Kultmarketings werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet mögliche Risiken und Gefahren, die mit dem Einsatz von Kultmarketing verbunden sind. Dies wird in einem separaten Kapitel kritisch diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kultmarketing, Kultmarke, Markenbildung, Markenmanagement, Konsumentenverhalten, Customer-Based Brand Equity, STP-Ansatz, Marketing-Mix, Erfolgsfaktoren, sozio-kulturelle Faktoren, ökonomische Faktoren, Brand Community, Szenemarketing.
- Citar trabajo
- Roland Theierl (Autor), 2007, Kultmarketing: Charakteristika, Anwendungsbereiche und Implikationen für das Brand Management, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73754