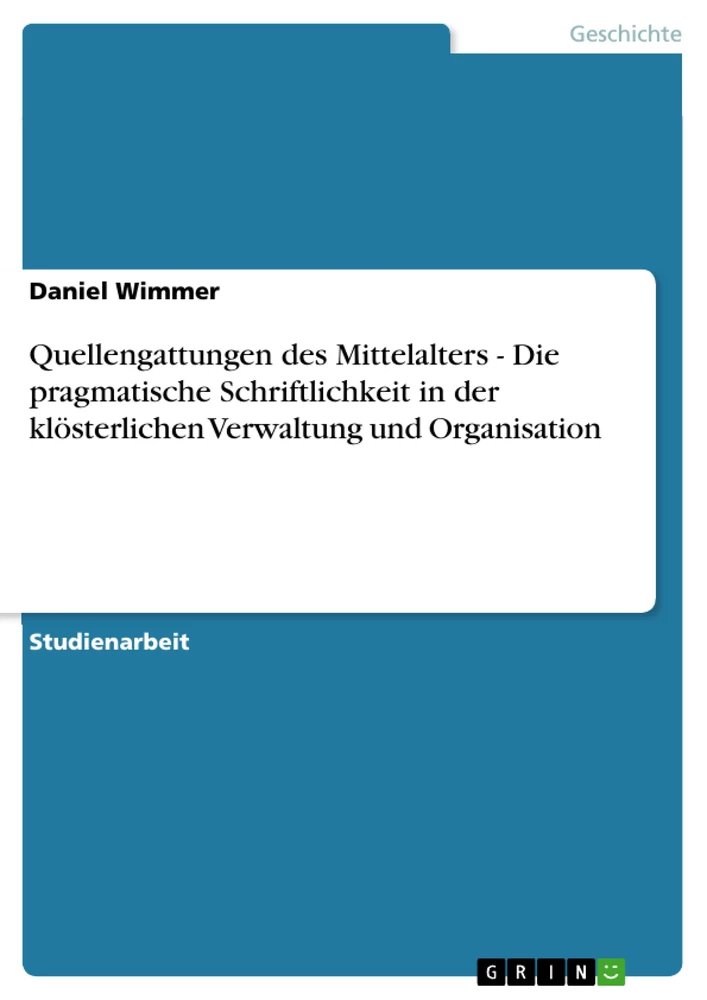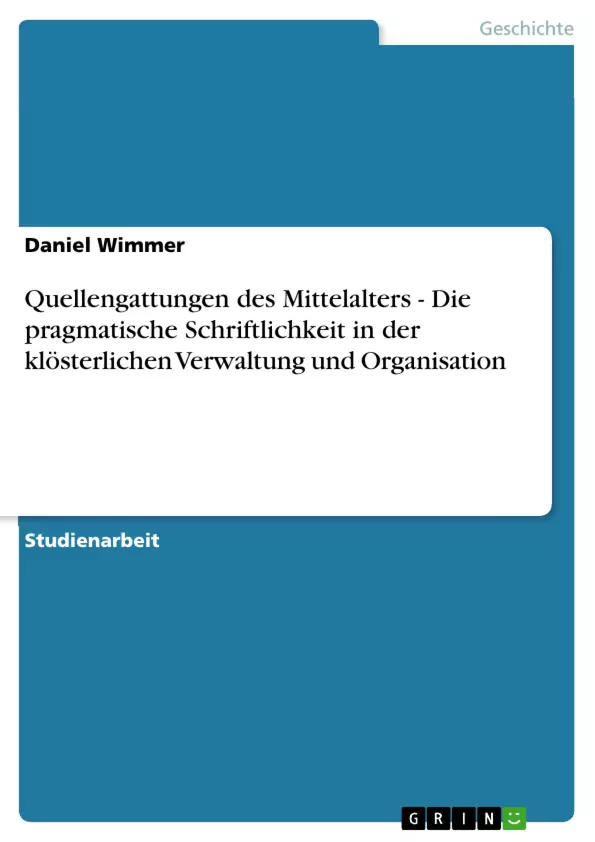Quellen sind das wichtigste Gut des Historikers. Aus ihnen gewinnt er die für seine Arbeit nötigen Erkenntnisse, sie helfen ihm, ein Verständnis für die Zeit zu entwickeln, mit der er sich beschäftigt.
Historische Quellen sind aber vielfältig, alles von vergangenen Generationen überlieferte kann für den Historiker einen gewissen Quellenwert haben. Daher bleibt ihm nichts anderes übrig, als das Angebot zu sichten und die für ihn relevanten Quellen auszuwählen.
Auch für das Mittelalter verfügt der Historiker über einen großen Quellenreichtum von vielfältiger Art. Um eine Hausarbeit über die Quellengattungen des Mittelalters zu schreiben, bedarf es daher zunächst der Eingrenzung des Umfangs der zu untersuchenden Quellen. Selbst wenn man sich „nur“ auf die schriftlichen mittelalterlichen Quellen beschränken möchte, erkennt man schnell, dass das Mittelalter eine Vielzahl historiographischer Quellengattungen hat, die mit ihren eigenen Wurzeln und Traditionen für sich selbst betrachtet einzigartig und bedeutsam sind.
Diese Hausarbeit beschäftigt sich daher ausschließlich mit den mittelalterlichen Quellen der pragmatischen Schriftlichkeit, die in Zusammenhang mit der klösterlichen Organisation und Verwaltung stehen. Inspiriert durch die Monographie Robert Fossiers über die Quellen der mittelalterlichen Wirtschafts- und Sozialgeschichte1 wurden die für diese Arbeit in Frage kommenden Quellengattungen in zwei übergeordnete Bereiche eingeteilt: Zum einen diejenigen Quellen, deren primäres Ziel die Erleichterung des klösterlichen Wirtschaftslebens und der Verwaltung war. Dazu zählen neben den vielfältigen Urbaraufzeichnungen auch Güterverzeichnisse. Zum anderen die Quellen, die durch ihren rechtlichen Inhalt vor allem der Organisation und Entfaltung des Klosterlebens dienlich waren, wozu die Traditionsbücher, aber auch die schriftlichen Rechtstexte der Consuetudines und Statuten zu zählen sind.
Diese Arbeit möchte mit Hilfe der Einzelbeobachtungen auch der Frage nachgehen, ob man trotz der Unterschiedlichkeit der Aufzeichnungen und ihrer Primäraufgaben funktionelle Linearitäten außerhalb administrativer und juristischer Aspekte erkennen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- pragmatische Schriftlichkeit.
- Quellen der Klosterverwaltung..
- Urbare
- Güterverzeichnis.
- Quellen der Klosterorganisation ….......
- Traditionsbuch.
- Consuetudo.
- Statuten kirchlicher Instanzen
- Schlussgedanke........
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die mittelalterlichen Quellen der pragmatischen Schriftlichkeit im Kontext der klösterlichen Organisation und Verwaltung. Sie konzentriert sich auf zwei Hauptbereiche: Quellen, die das klösterliche Wirtschaftsleben und die Verwaltung erleichtern, und Quellen, die der Organisation und Entfaltung des Klosterlebens dienen. Die Arbeit analysiert exemplarische Quellengattungen und betrachtet deren funktionelle Linearitäten jenseits administrativer und juristischer Aspekte.
- Die Rolle der pragmatischen Schriftlichkeit in der mittelalterlichen Klosterverwaltung und Organisation.
- Die verschiedenen Quellengattungen der pragmatischen Schriftlichkeit, wie Urbare, Güterverzeichnisse, Traditionsbücher, Consuetudines und Statuten.
- Die Entstehung und Entwicklung dieser Quellengattungen im Laufe des Mittelalters.
- Die Funktionen und Inhalte dieser Quellen im Kontext der klösterlichen Praxis.
- Die Frage nach funktionellen Linearitäten außerhalb administrativer und juristischer Aspekte.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung von Quellen für die historische Forschung dar und begrenzt den Umfang der Arbeit auf die pragmatische Schriftlichkeit im klösterlichen Kontext.
- pragmatische Schriftlichkeit: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der pragmatischen Schriftlichkeit im Mittelalter, ihre Rolle im Klosterwesen und die Entstehung neuer Dokumentarten wie Urbare und Traditionsbücher.
- Quellen der Klosterverwaltung: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Urbaren und Güterverzeichnissen, analysiert ihre Inhalte und stellt exemplarische Beispiele vor.
- Quellen der Klosterorganisation: Hier werden Traditionsbücher, Consuetudines und Statuten behandelt, ihre Funktionen erläutert und konkrete Beispiele vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter, insbesondere im Kontext des Klosterwesens. Schlüsselbegriffe sind: Urbare, Güterverzeichnisse, Traditionsbücher, Consuetudines, Statuten, Klosterverwaltung, Klosterorganisation, Rechtsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Mittelalter.
- Citar trabajo
- Daniel Wimmer (Autor), 2006, Quellengattungen des Mittelalters - Die pragmatische Schriftlichkeit in der klösterlichen Verwaltung und Organisation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73840