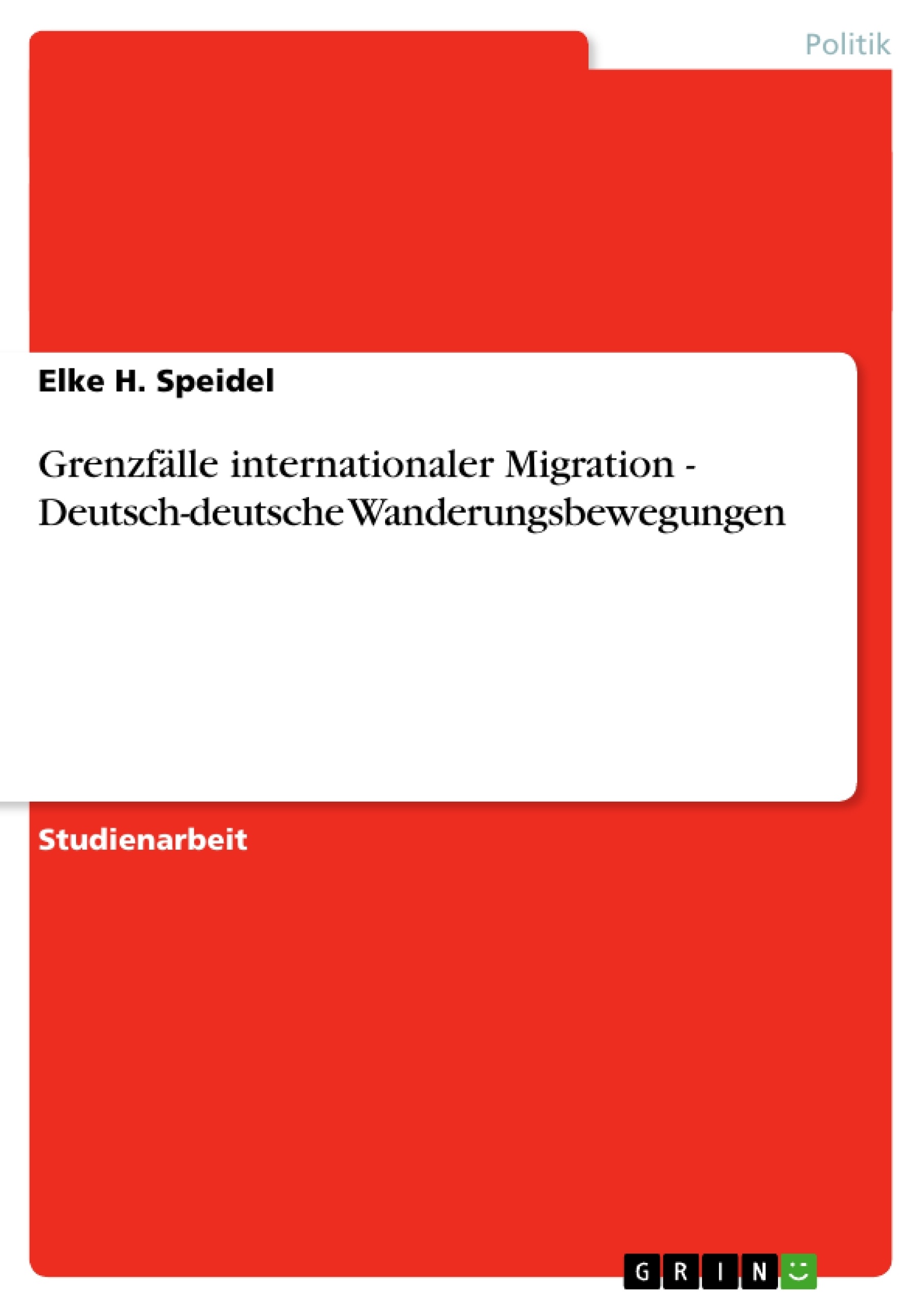Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem inzwischen historischen Thema der Wanderungsbewegungen von deutschen Staatsangehörigen über die deutsch-deutsche Grenze zwischen 1949 und 1990. Diese Wanderungsbewegungen lassen sich international in den Ost-West-Konflikt einordnen und ergeben sich aus dem unterschiedlichen Politik- und Demokratieverständnis, aber auch dem Wohlfahrtsgefälle zwischen den beiden Machtblöcken Sowjetunion und USA. Der Ost-West-Konflikt innerhalb Deutschlands war ein Teilbereich dieser politischen Konstellation und – als Folge der Doppelstaatlichkeit des geteilten Deutschland – selbst ein (bedingt) internationales Geschehen. Versucht wird eine vergleichende Darstellung des politbürokratischen Umgangs mit Migrant/innen in und aus beiden Teilen Deutschlands und damit ein Zusammenführen west- oder ostdeutscher Teil-Sichtweisen auf das Gesamtphänomen, die bisher in der einschlägigen Literatur nach wie vor überwiegen.
Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Analyse der Push- und Pull-Faktoren, die der Migrationsforschung zufolge wesentliche Ursachen von Wanderung sind. Als „Migration“ im Sinne dieser Arbeit sollen Wanderungsbewegungen von Personen gelten, die ihren Wohnsitz entweder längerfristig oder dauerhaft wechseln. Internationale Migration bedeutet die Verlagerung des Wohnortes von einem in einen anderen Staat, unabhängig davon, ob sich internationale Migranten später entschließen, in ihr Herkunftsland zurückzukehren oder zwischen diesem und dem Aufnahmeland zu pendeln. Diese Definition betrifft die deutsch-deutschen Migrationsvorgänge in hohem Maß, da ein Großteil der Wandernden als Remigrant/innen zum Teil mehrfach zwischen den betroffenen Gebieten hin- und herwechselten. Intranationale oder Binnenmigration dagegen bezieht sich auf die Wohnortverlagerung innerhalb eines Staates.
Die hier behandelten Wohnortwechsel sind migrationspolitisch betrachtet Grenzfälle im doppelten Sinn, denn die Migrant/innen überschritten dabei eine Grenze, die als solche nicht vollständig, zeitlich nicht durchgängig und nicht von allen Beteiligten gleichermaßen anerkannt war. Je nachdem, ob man für den Betrachtungszeitraum einen deutschen Staat oder zwei deutsche Staaten unterstellt, was nach dem Staatsangehörigkeitsrecht der betroffenen Gebiete zeit- und/oder regimeabhängig unterschiedlich beurteilt wurde, zählen die Wohnortwechsel der betroffenen Personengruppen zur einen – der internationalen – oder anderen – der intranationalen – Wanderungsart.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Internationale Migration als Definitionsfrage
- 2 Der phasenhafte Verlauf deutsch-deutscher Migrationspolitik
- 3 Framing-Differenzen im Migrationsverständnis Ost und West
- 3.1 Framing durch Staatsangehörigkeit und politisches Handeln
- 3.2 Bundesdeutsches Framing: Zwischen Recht und Pragmatismus
- 3.3 DDR-Staatsangehörigkeitsrecht und Framing
- 4 Zusammenfassung und Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutsch-deutschen Wanderungsbewegungen zwischen 1949 und 1990. Ziel ist ein vergleichender Blick auf den politischen Umgang mit Migranten in Ost und West, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven in der bestehenden Literatur. Die Analyse konzentriert sich auf die politbürokratische Praxis und vernachlässigt bewusst Push- und Pull-Faktoren der klassischen Migrationsforschung.
- Deutsch-deutsche Migration im Kontext des Ost-West-Konflikts
- Unterschiede im Migrationsverständnis zwischen Ost und West
- Politische Steuerung und Verwaltungspraxis der Migration in beiden deutschen Staaten
- Definition von Migration und die Problematik der Terminologie
- Phasenhafte Entwicklung der deutsch-deutschen Migrationspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Internationale Migration als Definitionsfrage: Die Einleitung definiert den Untersuchungsgegenstand: deutsch-deutsche Wanderungsbewegungen (1949-1990) im Kontext des Ost-West-Konflikts. Sie betont die Notwendigkeit eines vergleichenden Ansatzes, der west- und ostdeutsche Perspektiven vereint. Die Arbeit fokussiert auf den politischen Umgang mit Migration und Verwaltungspraktiken, lässt aber klassische Migrationsfaktoren wie Push- und Pull-Faktoren bewusst außer Acht. Die Definition von „internationaler Migration“ wird präzisiert, wobei die Besonderheit der deutsch-deutschen Situation als Grenzfall hervorgehoben wird, da die Grenze nicht von allen Beteiligten gleichermaßen anerkannt wurde. Schließlich wird die Problematik der von den politischen Regimen unterschiedlich definierten Schlüsselbegriffe, wie „Staat“ und „Staatsangehörigkeit“, angesprochen.
2 Der phasenhafte Verlauf deutsch-deutscher Migrationspolitik: Dieses Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Phasen der Migrationspolitik in der DDR. Verschiedene Autoren teilen die Geschichte in verschiedene Phasen ein. Lochen und Meyer-Seitz unterteilen die Politik der DDR gegenüber Ausreisewilligen in drei Phasen: (1) Bis 1983 wurde Ausreise grundsätzlich verweigert; (2) 1983-1988 wurde ein Antragsrecht eingeführt, hauptsächlich aus humanitären Gründen; (3) ab 1988 wurde ein allgemeines Antragsrecht und die gerichtliche Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen eingeführt. Andere Autoren wie Gärtner definieren andere Phasen, beispielsweise die Periode von 1949 bis 1961 (Mauerbau) mit Unterperioden, die durch Ereignisse wie die Arbeiterunruhen von 1953 beeinflusst wurden. Die unterschiedlichen Perspektiven der Phasenbildung verdeutlichen die Komplexität des Themas.
Schlüsselwörter
Deutsch-deutsche Migration, Ost-West-Konflikt, Migrationspolitik, Framing, Staatsangehörigkeit, DDR, Bundesrepublik Deutschland, politische Steuerung, Verwaltungspraxis, Grenzfälle der Migration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Deutsch-Deutsche Wanderungsbewegungen (1949-1990)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die deutsch-deutschen Wanderungsbewegungen zwischen 1949 und 1990. Der Fokus liegt auf einem vergleichenden Blick auf den politischen Umgang mit Migranten in Ost und West, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven in der bestehenden Literatur. Die Analyse konzentriert sich auf die politbürokratische Praxis und vernachlässigt bewusst Push- und Pull-Faktoren der klassischen Migrationsforschung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt u.a. die deutsch-deutsche Migration im Kontext des Ost-West-Konflikts, Unterschiede im Migrationsverständnis zwischen Ost und West, die politische Steuerung und Verwaltungspraxis der Migration in beiden deutschen Staaten, die Definition von Migration und die Problematik der Terminologie sowie die phasenhafte Entwicklung der deutsch-deutschen Migrationspolitik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum phasenhaften Verlauf der deutsch-deutschen Migrationspolitik, ein Kapitel zu den Framing-Differenzen im Migrationsverständnis Ost und West (inklusive Unterkapiteln zu Staatsangehörigkeit, bundesdeutschem und DDR-Framing) und eine Zusammenfassung/Stellungnahme. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Wie wird Migration in dieser Arbeit definiert?
Die Arbeit präzisiert die Definition von „internationaler Migration“ und hebt die Besonderheit der deutsch-deutschen Situation als Grenzfall hervor, da die Grenze nicht von allen Beteiligten gleichermaßen anerkannt wurde. Die Problematik der von den politischen Regimen unterschiedlich definierten Schlüsselbegriffe, wie „Staat“ und „Staatsangehörigkeit“, wird ebenfalls angesprochen.
Wie werden die Phasen der deutsch-deutschen Migrationspolitik dargestellt?
Das Kapitel zum phasenhaften Verlauf beschreibt die unterschiedlichen Phasen der Migrationspolitik in der DDR. Es werden verschiedene Perspektiven von Autoren wie Lochen und Meyer-Seitz (drei Phasen: Verweigerung, humanitäre Ausreise, allgemeines Antragsrecht) und Gärtner (andere Phasendefinitionen, z.B. bis 1961 mit Unterperioden) vorgestellt, um die Komplexität des Themas zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Deutsch-deutsche Migration, Ost-West-Konflikt, Migrationspolitik, Framing, Staatsangehörigkeit, DDR, Bundesrepublik Deutschland, politische Steuerung, Verwaltungspraxis, Grenzfälle der Migration.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, der west- und ostdeutsche Perspektiven vereint und sich auf die politbürokratische Praxis konzentriert. Klassische Migrationsfaktoren wie Push- und Pull-Faktoren werden bewusst vernachlässigt.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Elke H. Speidel (Autor:in), 2004, Grenzfälle internationaler Migration - Deutsch-deutsche Wanderungsbewegungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74077