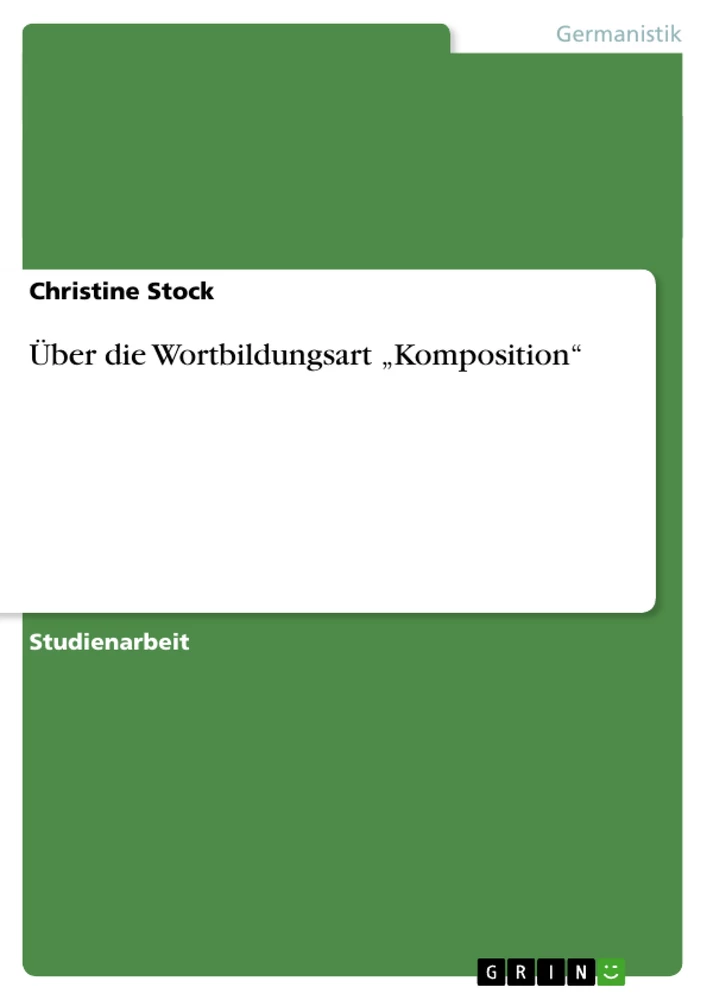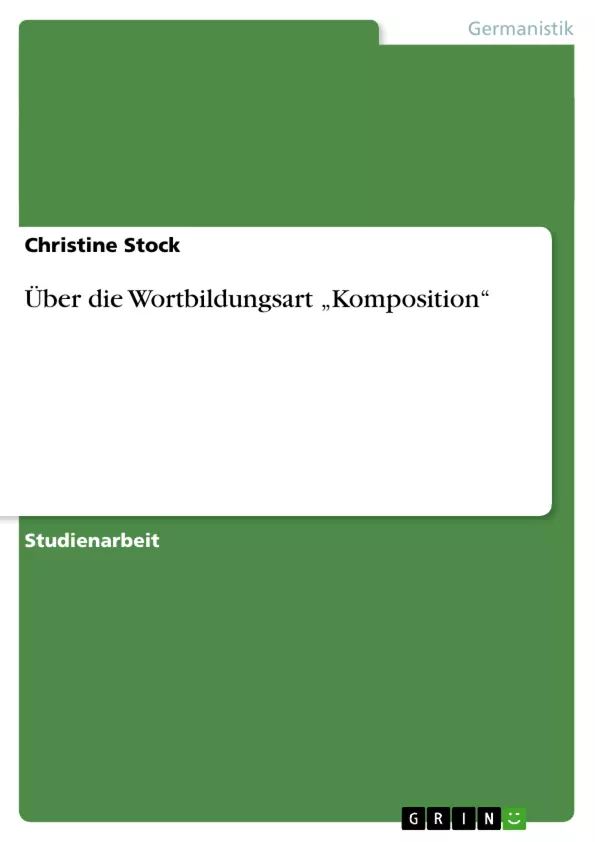Menschen verbringen die meiste Zeit ihres Lebens damit, sich Gedanken zu machen: Gedanken über sich selbst, über Mitmenschen, über Erlebnisse und darüber, wie sie das, was sie denken, zum Ausdruck bringen können. Sprache scheint meist das geeignetste Ausdrucksmittel, Bewusstseinsinhalte und Gefühle zu formulieren und anderen mitzuteilen. Obwohl Sprache eine so tragende Rolle im gesellschaftlichen Leben spielt, unterschätzen auch heute noch viele Menschen ihre Wichtigkeit und Macht.
Die Bedeutung von Sprache bezieht sich nicht nur auf das Erlernen grammatikalischer und lexikalischer Strukturen, sondern fungiert vor allem als bedeutendes Verständigungsmittel zwischenmenschlicher Beziehungen und unterschiedlicher Kulturen. Gerade in Zeiten voranschreitender Globalisierung, wie wir sie heute erleben, ist es wichtig, sich an interkultureller Kommunikation beteiligen und Gemeintes in passende Worte kleiden zu können. Das Sprachsystem ist eine wichtige Grundvoraussetzung für eine funktionierende Gesellschaft.
Die deutsche Sprache ist kein statisches Gebilde und ihre Gemeinschaft kann und muss ihren Sprachwortschatz ständig an neue Ausdrucksbedürfnisse und geänderte Lebensumstände anpassen. Somit ist der Wortschatz der deutschen Sprache geprägt von einem Verschwinden und Aufkommen neuer Wörter. In der deutschen Wortbildungslehre wird neben strukturellen und morphologischen Merkmalen der Wortbildungstypen zwischen den Wortbildungsarten Komposition, Derivation, Konversion und Reduktion unterschieden.
Ich möchte mich in dieser Arbeit damit beschäftigen, wie mit Hilfe der Komposition Morpheme und Lexeme zu komplexeren Wörtern verknüpft werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Klärung begrifflicher Einheiten der Wortbildung
- 3. Die Wortbildungsart „Komposition“
- 3.1 Das Determinativkompositum
- 3.2 Das Kopulativkompositum
- 3.3 Das Possessivkompositum
- 4. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutsche Wortbildung, insbesondere die Komposition als Methode der Wortbildung. Das Hauptziel ist es, die Mechanismen zu erläutern, wie Morpheme und Lexeme durch Komposition zu komplexeren Wörtern verbunden werden. Die Arbeit beleuchtet die begrifflichen Grundlagen der Wortbildung und analysiert verschiedene Arten von Komposita.
- Begriffliche Klärung von Morphemen und Lexemen
- Analyse der Komposition als Wortbildungsart
- Unterscheidung verschiedener Kompositatypen (Determinativ-, Kopulativ- und Possessivkomposita)
- Die Rolle der Wortbildung im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und Sprachentwicklung
- Die Bedeutung von Wortbildung für den Ausbau des deutschen Wortschatzes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wortbildung ein und betont die Bedeutung von Sprache als Ausdrucksmittel und Verständigungsinstrument. Sie veranschaulicht die Dynamik des deutschen Wortschatzes, der sich ständig an neue Bedürfnisse anpasst, und verweist auf den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und sprachlicher Innovation. Der Bezug auf Tucholskys Beschreibung des „Tuns von Birkenblättern“ verdeutlicht die Abhängigkeit von Wortbildungsprozessen von kulturellen und gesellschaftlichen Kontexten. Die Arbeit kündigt die Fokussierung auf die Komposition als Wortbildungsart an.
2. Klärung begrifflicher Einheiten der Wortbildung: Dieses Kapitel legt die begrifflichen Grundlagen für das Verständnis der Wortbildung. Es definiert den Begriff des Morphems als kleinste bedeutungstragende Einheit und unterscheidet zwischen freien und gebundenen Morphemen. Freie Morpheme, auch als Wurzeln bezeichnet, können eigenständig als Wörter auftreten, während gebundene Morpheme nur in Verbindung mit anderen Morphemen Bedeutung tragen. Die Ausführungen beleuchten die Bedeutung dieser Unterscheidung für die Analyse der Wortbildungsprozesse und die Struktur von Wörtern. Das Kapitel bereitet den Boden für die detaillierte Auseinandersetzung mit der Komposition im folgenden Kapitel.
Schlüsselwörter
Wortbildung, Komposition, Morphem, Lexem, Determinativkompositum, Kopulativkompositum, Possessivkompositum, deutsche Sprache, Sprachwandel, gesellschaftliche Entwicklung, Sprachdynamik
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Deutsche Wortbildung - Fokus Komposition
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der deutschen Wortbildung, insbesondere mit der Komposition als Methode der Wortbildung. Sie analysiert die Mechanismen der Verbindung von Morphemen und Lexemen zu komplexeren Wörtern und untersucht verschiedene Arten von Komposita.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Klärung begrifflicher Einheiten der Wortbildung, 3. Die Wortbildungsart „Komposition“ (mit Unterkapiteln zu Determinativ-, Kopulativ- und Possessivkomposita) und 4. Schlussbemerkung. Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Mechanismen der Wortbildung durch Komposition zu erläutern. Die Themenschwerpunkte liegen auf der begrifflichen Klärung von Morphemen und Lexemen, der Analyse der Komposition als Wortbildungsart, der Unterscheidung verschiedener Kompositatypen (Determinativ-, Kopulativ- und Possessivkomposita), der Rolle der Wortbildung im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und Sprachentwicklung sowie der Bedeutung von Wortbildung für den Ausbau des deutschen Wortschatzes.
Was wird im Kapitel „Klärung begrifflicher Einheiten der Wortbildung“ behandelt?
Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis der Wortbildung, indem es Morpheme (kleinste bedeutungstragende Einheiten) definiert und zwischen freien und gebundenen Morphemen unterscheidet. Es erklärt die Bedeutung dieser Unterscheidung für die Analyse von Wortbildungsprozessen und die Struktur von Wörtern.
Welche Arten von Komposita werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt drei Arten von Komposita: Determinativkomposita, Kopulativkomposita und Possessivkomposita. Jedes dieser Kompositatyps wird im dritten Kapitel separat analysiert.
Welche Rolle spielen gesellschaftliche Veränderungen und Sprachentwicklung in der Arbeit?
Die Arbeit betrachtet die Wortbildung, insbesondere die Komposition, im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und Sprachentwicklung. Es wird der Zusammenhang zwischen sprachlicher Innovation und gesellschaftlichen Bedürfnissen hervorgehoben. Die Dynamik des deutschen Wortschatzes wird als ein wichtiger Aspekt betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wortbildung, Komposition, Morphem, Lexem, Determinativkompositum, Kopulativkompositum, Possessivkompositum, deutsche Sprache, Sprachwandel, gesellschaftliche Entwicklung, Sprachdynamik.
Wie ist die Einleitung aufgebaut?
Die Einleitung führt in die Thematik der Wortbildung ein, betont die Bedeutung von Sprache und verdeutlicht die Dynamik des deutschen Wortschatzes im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie veranschaulicht dies anhand von Tucholskys Beschreibung des „Tuns von Birkenblättern“ und kündigt die Fokussierung auf die Komposition an.
- Quote paper
- Christine Stock (Author), 2005, Über die Wortbildungsart „Komposition“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74087