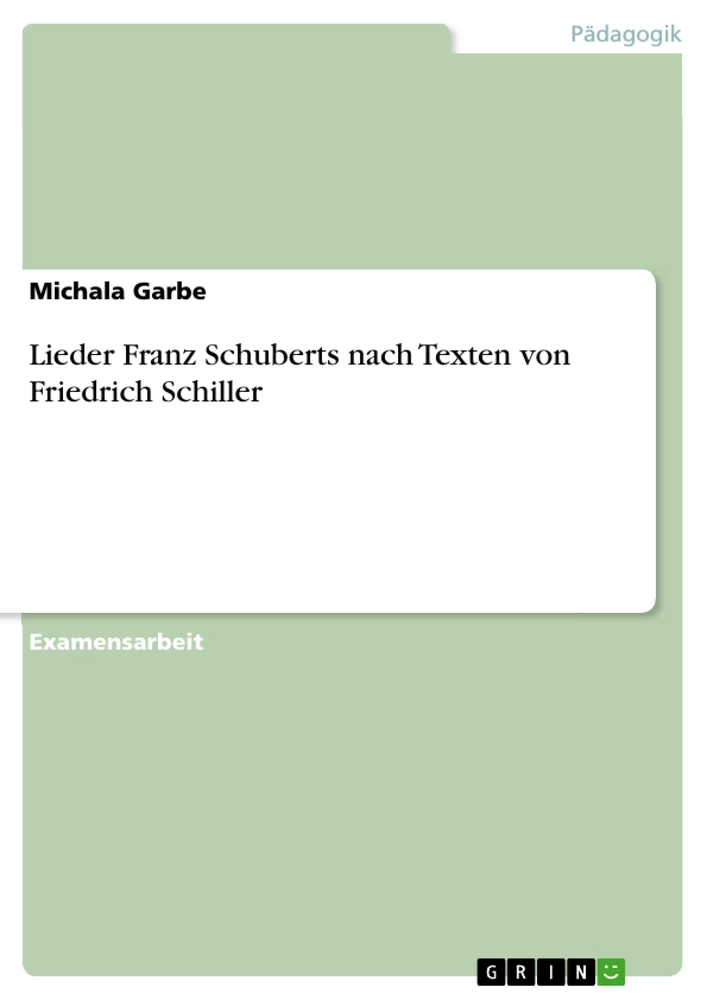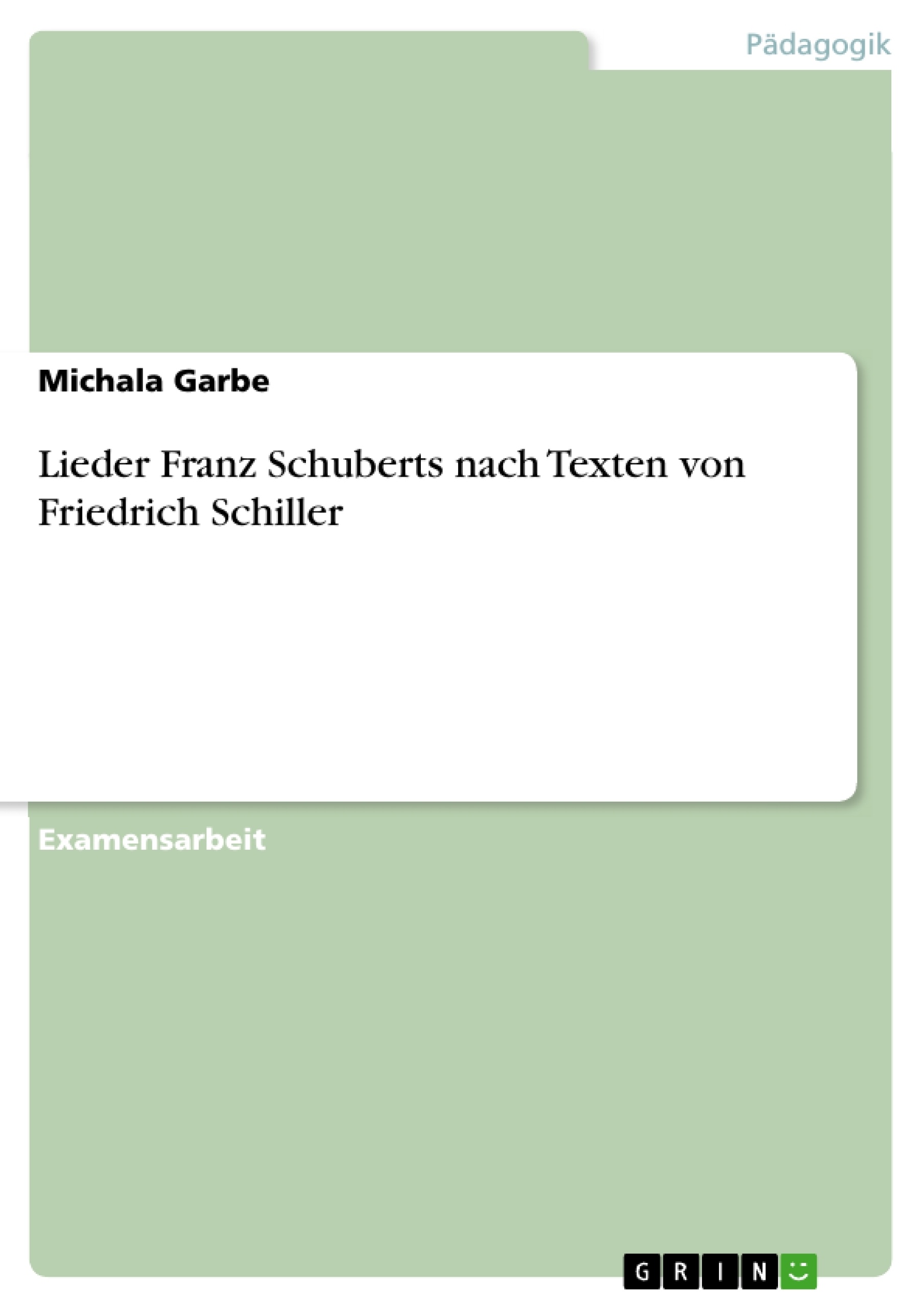Franz Schubert und das Lied sind in der europäischen Musikgeschichte untrennbar miteinander verknüpft. Die als tiefsinnig und ausdrucksstark empfundenen Lieder erfreuen sich bis heute ungebrochener Beliebtheit. Vertonungen von Texten Friedrich Schillers je- doch gehören zu den weitgehend unbekannten Liedern Schuberts, nur sehr vereinzelt sind sie im Konzertsaal zu hören. Wie kommt es, dass zwei wichtige Vertreter der Weimarer und der späten Wiener Klassik in der Synthese nicht zu einem solchen Bekanntheitsgrad gelangen konnten wie jeder Künstler für sich?
Seine über 600 Vokalkompositionen hat Schubert vorrangig nach Texten von Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller geschrieben . Schuberts Goethe-Lieder, an erster Stelle Gretchen am Spinnrade und der Erlkönig, gehören zu seinen bekanntesten Lied- kompositionen, während die 33 Lieder nach Texten von Schiller nur selten veröffentlicht wurden und Anerkennung fanden. Die ersten Lieder Schuberts, als Opus 1 bis 3 im Druck erschienen, sind sechs Vertonungen Goethescher Texte, während die Schiller-Lieder mit der Gruppe aus dem Tartarus, op. 24,1, sehr spät erstmalig in seinem Opus repräsentiert sind. Insgesamt sind nur zwölf Schiller-Lieder zu Schuberts Lebzeiten veröffentlicht worden . Ein Tagebucheintrag Schuberts vom 13. Juni 1816 lässt die allgemeine Vorliebe seiner Zeitgenossen für Goethevertonungen erahnen: „Ich spielte Variationen von Beethoven, sang Göthe’s rastlose Liebe u. Schillers Amalia. Ungetheilter Beyfall ward jenem, diesem minderer.“ So kann geschlussfolgert werden, dass die Textauswahl für Schubert maßgebenden Einfluss auf Anlage und Erfolg der daraus entstehenden Komposition hatte. Umgekehrt könnte allerdings auch der mäßige Erfolg als Ursache für die regressive Beschäftigung Schuberts mit Schiller-Texten zu sehen sein. [...] Im Zentrum dieser Arbeit soll nicht das Verbindende zwischen Dichter und Komponist stehen, sondern die Veränderung der kompositorischen Vorgehensweise Schuberts durch die Auseinandersetzung mit den Texten Schillers. Die Schiller-Lieder repräsentieren sowohl Schuberts erste Kompositionsversuche als auch den Beginn seines Spätwerks. Somit lassen sich stilistische Entwicklungen Schuberts, die durch die Beschäftigung mit Schillertexten ausgelöst worden sein könnten, über den Zeitraum von 15 Jahren exemplarisch nachvollziehen. Häufig wird davon ausgegangen, dass Schubert mit Gretchen am Spinnrade am 14. Oktober 1814 ein plötzlicher Durchbruch zum neuen Ideal der roman- tischen Liedästhetik gelungen ist . Das scheint jedoch nicht der Fall. Vielmehr zeugen die über vielen Liedkompositionen vor diesem Datum von einer intensiven Auseinandersetzung Schuberts mit tradierten und sich neu ausprägenden Formen sowie mit ästhetischen Vorstellungen. Die Umsetzung der textlichen Vorlagen in seinen Schiller-Liedern, den allmählichen Wandel der Begleitformen und den veränderten Umgang mit Harmonik werde ich mit dieser Arbeit untersuchen und versuchen nachzuzeichnen. – Mein Interesse für diese Kompositionen wurde außerdem durch die Tatsache geweckt, dass die Gedichte und Balladen Schillers, von ihrer strophischen Anlage abgesehen, in der Regel nicht für eine Vertonung geeignet erscheinen . Die überwiegend unregelmäßige Syntax, Verschiebungen der Betonungsakzente und ihr ausgedehnter Umfang mussten Schubert zu neuen Wegen und Lösungen in der musikalischen Umsetzung geradezu herausfordern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematik und Forschungsstand
- Methodik der Untersuchungen
- Musikalische Lyrik zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- Kompositorische Praxis
- Das Kunstlied
- Vergleichende Analysen
- Der Dichter
- Der Komponist
- Liedauswahl
- Eine Leichenfantasie
- Des Mädchens Klage
- Die Götter Griechenlandes
- Die Begleitung
- Begleitung mit Melodieführung
- Begleitung als harmonische Stütze
- Eigenständige Begleitung
- Vor-, Zwischen- und Nachspiele
- Harmonik
- Kompositorische Stationen in den Schiller-Liedern
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Liedvertonungen von Friedrich Schillers Gedichten durch Franz Schubert. Sie analysiert, wie Schuberts kompositorische Vorgehensweise durch die Auseinandersetzung mit den Schiller-Texten beeinflusst wurde. Die Arbeit betrachtet dabei sowohl frühe als auch spätere Werke Schuberts und versucht, stilistische Entwicklungen im Laufe von 15 Jahren aufzuzeigen.
- Die Herausforderungen, die Schuberts Vertonung von Schillers Gedichten stellte
- Die Entwicklung der Begleitung in Schuberts Schiller-Liedern
- Der Umgang mit Harmonik in den Kompositionen
- Schuberts stilistische Entwicklung anhand der Schiller-Lieder
- Der Vergleich verschiedener Lieder und deren musikalische Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Thematik der Hausarbeit und den Forschungsstand zu Schuberts Schiller-Liedern. Sie stellt die Frage, warum diese Lieder im Vergleich zu den Goethe-Vertonungen weniger bekannt sind und erläutert die Besonderheiten der Liedkomposition zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Das Kapitel 2 bietet eine Einführung in Schuberts kompositorische Praxis und behandelt die Entwicklung des Kunstliedes im Kontext seiner Zeit.
Das Kapitel 3 widmet sich vergleichenden Analysen ausgewählter Schiller-Lieder. Es untersucht die Rolle des Dichters und des Komponisten, die spezifischen Eigenschaften der Lieder sowie die musikalische Gestaltung der Begleitung, der Vor-, Zwischen- und Nachspiele sowie der Harmonik.
Das Kapitel 4 beleuchtet die kompositorischen Stationen in Schuberts Schiller-Liedern und analysiert die Entwicklung der kompositorischen Vorgehensweise.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die musikalische Analyse der Lieder Franz Schuberts nach Texten von Friedrich Schiller. Die Analyse bezieht sich auf die kompositorische Praxis des 19. Jahrhunderts, die Entwicklung des Kunstliedes, die Rolle des Dichters und des Komponisten sowie die musikalische Gestaltung der Begleitung, der Vor-, Zwischen- und Nachspiele und der Harmonik.
- Arbeit zitieren
- Michala Garbe (Autor:in), 2006, Lieder Franz Schuberts nach Texten von Friedrich Schiller, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74101