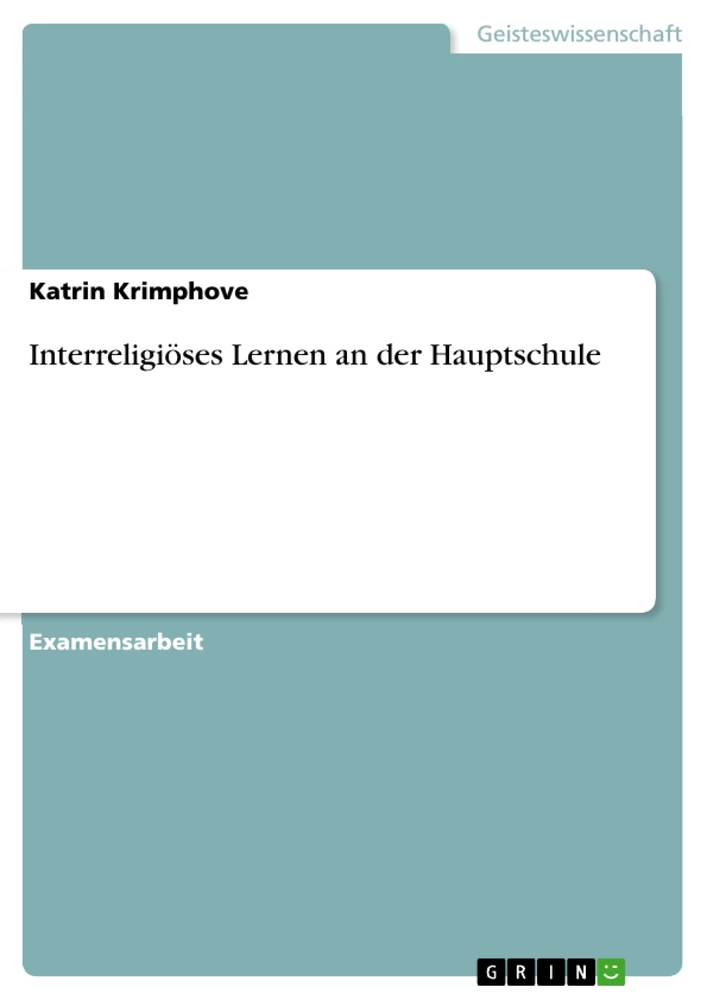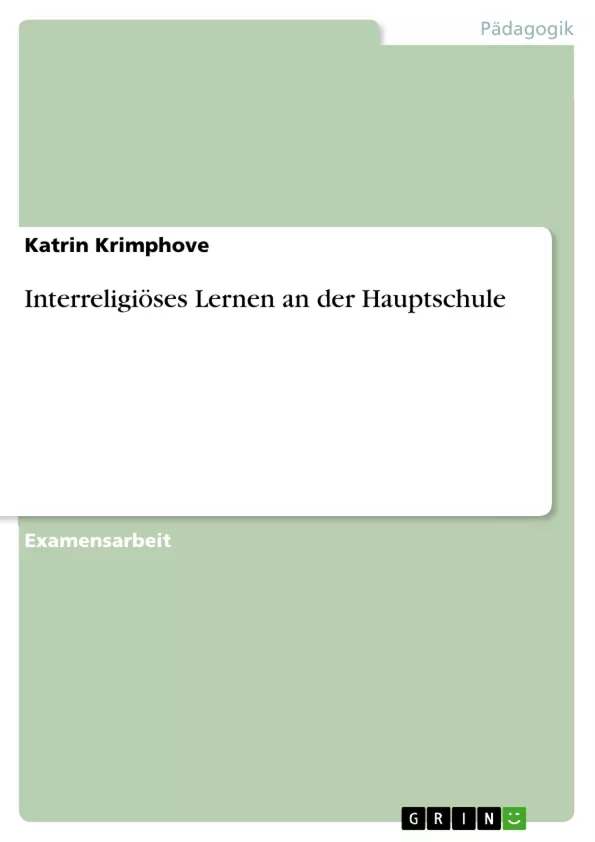Die deutsche Gesellschaft, insbesondere in einer Arbeiterstadt wie Stolberg, ist schon lange nicht mehr monokulturell oder monoreligiös. Mit der zunehmenden Migration siedelten sich insbesondere türkische Gastarbeiter und Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien an. Hinzu kamen viele Flüchtlinge aus Marokko sowie einzelne Familien aus anderen Ländern. Die Propst-Grüber Gemeinschaftshauptschule wird von Schülern zahlreicher Nationalitäten besucht. Diese sprechen verschiedene Muttersprachen und haben verschiedene Religionszugehörigkeiten. Die Schule reagiert auf diese Zusammensetzung mit speziellen muttersprachlichen Angeboten in türkischer, albanischer und arabischer Sprache sowie mit Veranstaltungen, die dem multikulturellen Charakter der Schule gerecht werden. Mit einem Religionen-Workshop im Rahmen der Projekttage wurde der Versuch unternommen, neben der kulturellen auch die religiöse Dimension anzusprechen.
Viele deutsche Schüler besuchen mittlerweile die Schule ohne oder mit geringer religiöser Vorbildung. Ihre türkischen Mitschüler hingegen tragen ihren Glauben relativ offen nach außen. Während es insbesondere unter deutschen Jugendlichen „out“ ist, religiös zu sein, die Kirche zu besuchen oder an Gott zu glauben ist für islamische Schüler in der Regel der bekennende Glaube eine wichtige Voraussetzung für die Anerkennung in Familie und Freundeskreis. Durch das offene Praktizieren religiöser Riten wie des Fastens im Ramadan oder des Tragens von Kopftüchern ist manchem deutschen Schüler der Islam bekannter als das Christentum.
Der Religionen-Workshop hatte sich das Ziel gesetzt, die Schüler zum Nachdenken über die eigene und über andere Religionen anzuregen. Durch den knapp bemessenen Zeitraum von drei Schultagen konnten zwar nur Anstöße vermittelt werden. Diese sollten aber als Anregung dienen, sich mit den Religionen weiter auseinander zu setzen und auf die Dauer mit dem Wissen über die eigene Religion zur Toleranz gegenüber anderen Religionen zu gelangen.
In dieser zweiten Staatsarbeit werde ich zunächst kurz einige theoretische und theologische Hintergründe zum interreligiösen Lernen darstellen. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Darstellung von Planung und Durchführung des Religionen-Workshops sowie die abschließende Reflexion des Workshops unter verschiedenen Aspekten.
Inhaltsverzeichnis
-
- Einleitung
- Inhaltsverzeichnis
- Theoretische und theologische Aspekte interreligiösen Lernens
- Religionen
- Gesellschaft im Wandel – vom konfessionellen Milieu zur pluralistischen Gesellschaft
- Das Missionsverständnis der katholischen Kirche im Verhältnis zum interreligiösen Dialog
- Die Stellung der katholischen Kirche zum interreligiösen Lernen nach dem 2. Vatikanischen Konzil
- Leitlinien interreligiösen Lernens
- Interreligiöser Dialog als neuer Zugang zur eigenen Religion
- Praktische Durchführung
- Vorüberlegungen, Rahmen und Planung des Workshops
- Entstehungsgeschichte des Workshops
- Planungselemente
- Geplante Vorgehensweise
- Rechtliche Bestimmungen zur Durchführung von Unterrichtsgängen
- Zusammensetzung der Gruppe (Bedingungsfeld)
- Durchführung der Exkursionen
- Besuch der Bila-Moschee am Aachener Westbahnhof
- Besuch des Aachener Doms
- Besuch des Zentrums für tibetischen Buddhismus in Aachen
- Nachbereitung und interreligiöser Dialog
- Reflexion des Besuchs in der Moschee
- Reflexion der Domführung
- Reflexion des Besuchs im buddhistischen Zentrum
- Interreligiöser Dialog Islam - Christentum
- Vorbereitung und Gestaltung der Präsentation
- Präsentation im „Zelt der Religionen“
- Reflexion des Workshops
- Grenzen interreligiöser Erziehung
- Chancen der interreligiösen Erziehung
- Reflexion unter Berücksichtigung theoretischer Aspekte
- Zusammenfassung und abschließende Betrachtung
- Literaturangaben
- Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Planung, Durchführung und Reflexion eines „Religionen-Workshops“, der im Rahmen der Projekttage 2002 an der *** GHS *** Stolberg durchgeführt wurde. Das Ziel des Workshops war es, Schüler zum Nachdenken über die eigene und über andere Religionen anzuregen und die Chancen und Grenzen interreligiöser Erziehung an der Hauptschule zu beleuchten.
- Theoretische und theologische Aspekte interreligiösen Lernens
- Praktische Durchführung des Religionen-Workshops
- Reflexion des Workshops unter Berücksichtigung theoretischer Aspekte
- Chancen und Grenzen interreligiöser Erziehung
- Zusammensetzung der Gesellschaft im Wandel
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit den theoretischen und theologischen Aspekten interreligiösen Lernens. Es werden verschiedene Religionen betrachtet, die Entwicklung der Gesellschaft vom konfessionellen Milieu zur pluralistischen Gesellschaft, das Missionsverständnis der katholischen Kirche und die Stellung der katholischen Kirche zum interreligiösen Lernen nach dem 2. Vatikanischen Konzil beleuchtet. Des Weiteren werden Leitlinien interreligiösen Lernens sowie der interreligiöse Dialog als neuer Zugang zur eigenen Religion diskutiert.
Der zweite Teil der Arbeit beschreibt die praktische Durchführung des Religionen-Workshops. Er beinhaltet die Vorüberlegungen, die Planung und die Durchführung der Exkursionen zu verschiedenen Religionsstätten, wie der Bila-Moschee, dem Aachener Dom und dem Zentrum für tibetischen Buddhismus. Des Weiteren wird die Nachbereitung und der interreligiöse Dialog zwischen den Schülern sowie die Präsentation der Ergebnisse im „Zelt der Religionen“ detailliert dargestellt.
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der Reflexion des Workshops. Es werden die Grenzen und Chancen interreligiöser Erziehung beleuchtet und die Ergebnisse der Arbeit im Lichte der zuvor dargestellten theoretischen Aspekte reflektiert.
Schlüsselwörter
Interreligiöses Lernen, Religionen, multikulturelle Gesellschaft, Projekttage, Hauptschule, Toleranz, Mission, Dialog, katholische Kirche, Zweites Vatikanisches Konzil, Bila-Moschee, Aachener Dom, Zentrum für tibetischen Buddhismus, Präsentation, Reflexion, Chancen, Grenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel interreligiösen Lernens an der Hauptschule?
Ziel ist es, Schüler zur Reflexion über die eigene und fremde Religionen anzuregen und durch Wissen gegenseitige Toleranz zu fördern.
Welche Religionsstätten wurden im Rahmen des Workshops besucht?
Die Schüler besuchten die Bila-Moschee, den Aachener Dom und ein Zentrum für tibetischen Buddhismus.
Wie unterscheidet sich die religiöse Praxis zwischen deutschen und türkischen Schülern?
Während viele deutsche Jugendliche wenig religiöse Vorbildung haben, praktizieren islamische Schüler ihren Glauben oft offener (z. B. Fasten im Ramadan).
Welche Rolle spielt die katholische Kirche beim interreligiösen Dialog?
Die Arbeit beleuchtet die positive Stellung der Kirche zum Dialog seit dem 2. Vatikanischen Konzil und dessen Bedeutung für eine pluralistische Gesellschaft.
Was sind die Grenzen interreligiöser Erziehung?
Zeitliche Einschränkungen (z. B. nur drei Projekttage) und tief verwurzelte Vorurteile können die Wirkung der Erziehung begrenzen.
- Quote paper
- Katrin Krimphove (Author), 2002, Interreligiöses Lernen an der Hauptschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7414