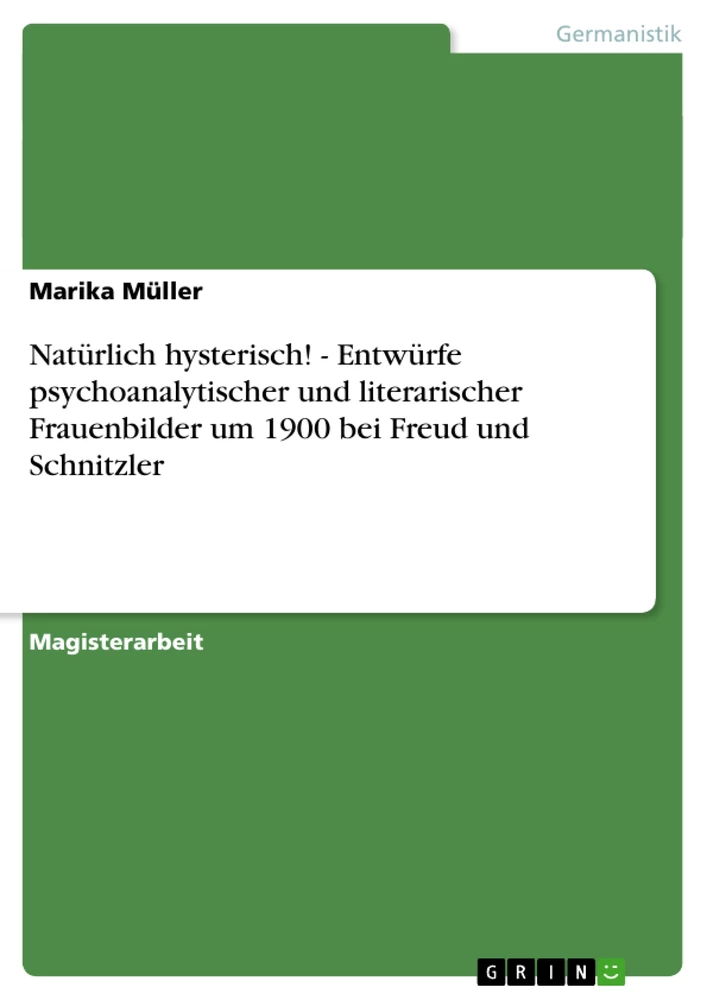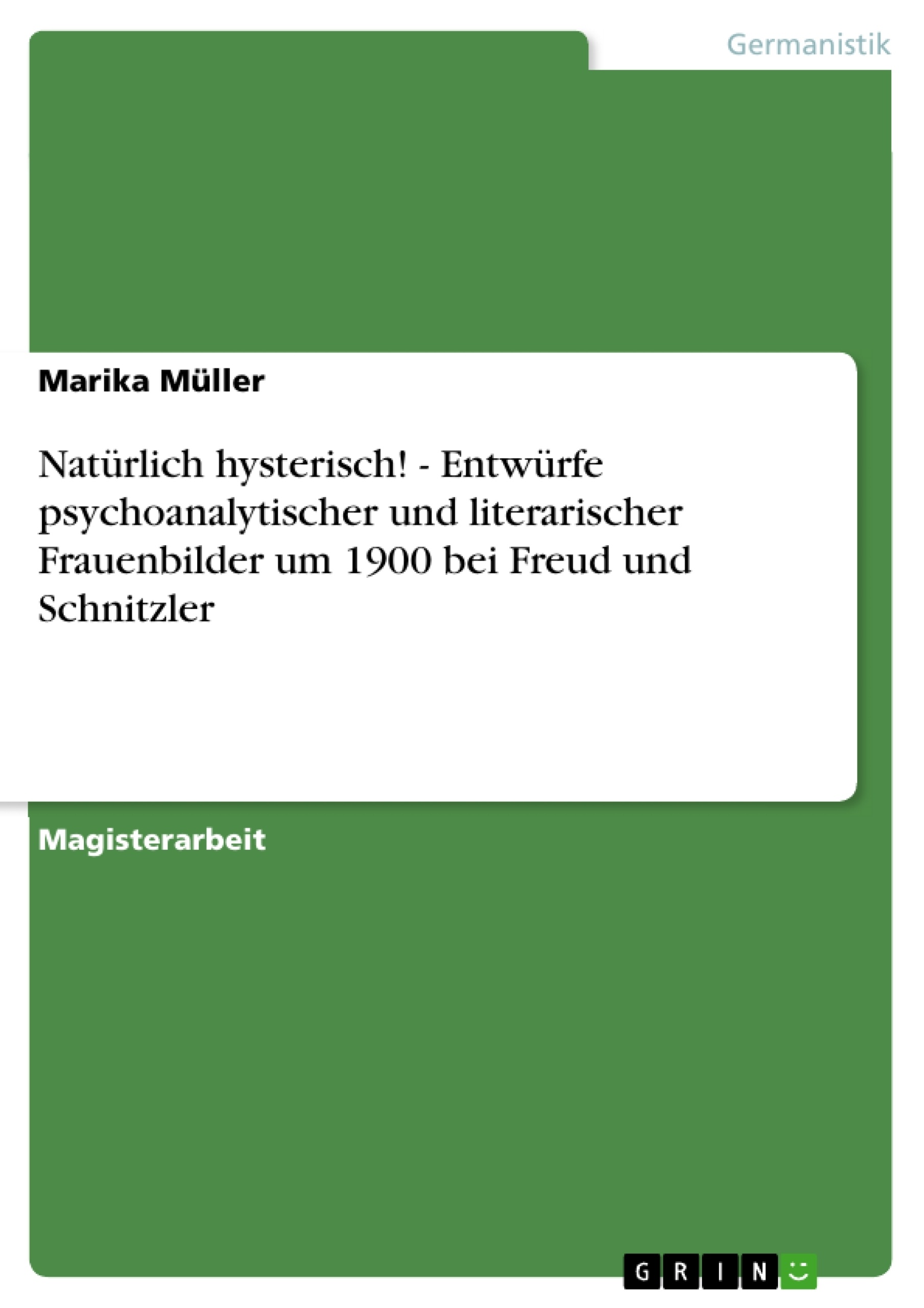Der Begriff Hysterie im historischen und kulturellen Kontext –
Einleitung
Die Hysterikerin erinnert in ihren Anfällen und Leiden
an eine weibliche Sexualität und Körperlichkeit,
die die „normale Frau“ vergessen musste.
Katrin Schmersahl untersucht in ihrer interdisziplinären Studie Medizin und Geschlecht von 1998 die Konstruktion der Kategorie Geschlecht in den wissenschaftlichen–medizinischen Forschungsbereichen des 19. Jahrhunderts. Die Diagnose Hysterie, so schreibt sie, spielte von der Antike bis zur Aufklärung eine untergeordnete Rolle und erst im 19. Jahrhundert kam ihr zentrale Bedeutung zu (Schmersahl, 216/217). Zudem problematisiert sich durch die Geschichte der beschriebenen hysterischen Krankheitsbilder die Furcht des Mannes vor einem selbständigen Innenleben der Frau. „[G]e-ordneter Geschlechtsverkehr“ (Lamott, 83), der Zugang zur Frau und ihrer Fruchtbarkeit garantiert, wird oft als Heilmittel empfohlen.
In den altägyptischen und antiken Schriftstücken wird die Hysterie als eine Erkrankung der weiblichen Geschlechtsorgane vorgestellt. Schon die Verfasser des Kahun–Papyrus (um 2000 v. Chr.) und des Ebers–Papyrus (um 1550 v. Chr.) beschreiben hysterische Symptome und vermeinen die Veränderung der Position der Gebärmutter als Krankheitsursache zu erkennen (Kronberger, 34). Hippokrates (ca. 460 – ca. 350 v. Chr.) benennt die Krankheit Hysterie, da er sie auf die im weiblichen Körper ‚wandernde’ Gebärmutter(2) zurückführt. Er empfiehlt Schwangerschaft, die die Gebärmutter an ihren natürlichen Ort fixiert, als Heilmittel für die hysterische Erkrankung. Im Mittelalter gilt die Krankheit als „Besessenheit“, die Bewusstseinsspaltung als die bedeutendste Komponente des heutigen Hysteriekonzepts wird bereits beschrieben (Kronberger, 37). Mit der fortschreitenden Erforschung von geistigen Erkrankungen im 17. Jahrhundert verlagert sich die Krankheitsursache in den Kopf.
[...]
_____
(1) Kronberger Die unerhörten Töchter, 12.
(2) „Hystera“ ist griechisch und bedeutet „Gebärmutter“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Begriff Hysterie im historischen und kulturellen Kontext – Einleitung
- 2. Das Krankheitsbild „Hysterie“ literarisch
- 2.1. Die Studien über Hysterie - Anfänge der Psychoanalyse
- 2.2. Freud als wissenschaftlicher Interpret in seinen frühen Hysteriestudien
- 2.3. Schnitzler als „Analytiker“ der Wiener Gesellschaft des Fin de siècle
- 3. Freuds Fallbeispiel Frl. Elisabeth von R. und Schnitzlers Erzählung Frau Berta Garlan – Bilder hysterischer Frauenfiguren
- 3.1. Einführung in das „Rätsel der Weiblichkeit“
- 3.2. Bürgerliches Elternhaus und Alltagsmonotonie
- 3.3. Ehe, Liebe, Sexualität
- 3.4. Inneres Konfliktpotenzial
- 3.5. Facetten von Hysterie: Symptombilder, Bewusstseinsbereiche, Träume
- 3.6. Frau als Objekt und Brüche durch weibliches Aufbegehren
- 4. Zum Vergleich: der „hysterische“ Anfall von Schnitzlers Fräulein Else
- 5. „Natürlich hysterisch!“ – die Unausweichlichkeit eines frauenspezifischen Krankheitsbildes – Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Darstellung von Frauenbildern um 1900, insbesondere im Kontext der Hysterie, bei Sigmund Freud und Arthur Schnitzler. Ziel ist es, die Konstruktionen des Krankheitsbildes Hysterie in medizinischer und literarischer Hinsicht zu analysieren und deren geschlechtsspezifische Konnotationen aufzuzeigen.
- Der historische und kulturelle Kontext des Hysterie-Begriffs
- Literarische und psychoanalytische Darstellungen von Hysterie
- Vergleichende Analyse von Freuds und Schnitzlers Frauenfiguren
- Die gesellschaftlichen Bedingungen und Auswirkungen der Hysteriediagnose
- Das Konzept des „hysterischen Charakters“ und seine geschlechtsspezifische Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Begriff Hysterie im historischen und kulturellen Kontext – Einleitung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Hysterie-Begriffs, von der Antike bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Es zeigt die Wandelnde Auffassung von Hysterie als körperliche, geistige und schließlich psychische Erkrankung, stets eng verknüpft mit der Weiblichkeit und den gesellschaftlichen Vorstellungen von Frau-Sein. Der Fokus liegt auf der ambivalenten Natur des Krankheitsbildes und den sich widersprechenden medizinischen und gesellschaftlichen Interpretationen. Die Autorin verweist auf die Problematik der Diagnostik und die damit verbundene Schwierigkeit, statistische Ergebnisse verlässlich zu interpretieren. Die Vielfältigkeit der Symptome und Therapien unterstreicht die Anpassungsfähigkeit des Krankheitskonzepts an kulturelle Gegebenheiten.
2. Das Krankheitsbild „Hysterie“ literarisch: Dieses Kapitel analysiert die literarische Darstellung des Krankheitsbildes Hysterie, indem es die Anfänge der Psychoanalyse, Freuds Rolle als wissenschaftlicher Interpret seiner frühen Hysteriestudien und Schnitzlers analytische Perspektive auf die Wiener Gesellschaft des Fin de Siècle gegenüberstellt. Es legt den Grundstein für den anschließenden Vergleich der Fallbeispiele von Freud und Schnitzlers literarischen Werken.
3. Freuds Fallbeispiel Frl. Elisabeth von R. und Schnitzlers Erzählung Frau Berta Garlan – Bilder hysterischer Frauenfiguren: Dieses Kapitel vergleicht Freuds Fallstudie von Fräulein Elisabeth von R. mit Schnitzlers Erzählung über Frau Berta Garlan. Es analysiert die Darstellung der Frauenfiguren, ihre Lebensumstände, ihre psychischen Konflikte und die Manifestation ihrer „Hysterie“ in verschiedenen Symptombildern. Die Kapitel untersuchen die Rolle von gesellschaftlichen Normen, familiären Strukturen und der Sexualität in der Entstehung und Ausprägung der Krankheitssymptome. Der Einfluss des gesellschaftlichen Drucks auf die Frauen und deren Reaktionen auf diesen Druck werden detailliert dargestellt.
4. Zum Vergleich: der „hysterische“ Anfall von Schnitzlers Fräulein Else: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse des „hysterischen“ Anfalls von Schnitzlers Fräulein Else und stellt ihn in einen Vergleich zu den vorher analysierten Fallstudien. Es vertieft die Analyse der Rolle der weiblichen Sexualität und des gesellschaftlichen Drucks auf die Darstellung des Krankheitsbildes Hysterie.
Schlüsselwörter
Hysterie, Psychoanalyse, Literatur, Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Frauenbilder, Fin de Siècle, Wiener Gesellschaft, Sexualität, Weiblichkeit, Krankheitskonzept, Gesellschaftlicher Druck, Fallstudie, literarische Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Darstellung von Frauenbildern um 1900 im Kontext der Hysterie bei Freud und Schnitzler
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Darstellung von Frauenbildern um 1900, insbesondere im Kontext der Hysterie, bei Sigmund Freud und Arthur Schnitzler. Sie analysiert die Konstruktionen des Krankheitsbildes Hysterie in medizinischer und literarischer Hinsicht und zeigt deren geschlechtsspezifische Konnotationen auf.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den historischen und kulturellen Kontext des Hysterie-Begriffs, literarische und psychoanalytische Darstellungen von Hysterie, einen Vergleich der Frauenfiguren bei Freud und Schnitzler, die gesellschaftlichen Bedingungen und Auswirkungen der Hysteriediagnose sowie das Konzept des „hysterischen Charakters“ und seine geschlechtsspezifische Bedeutung.
Welche Autoren und Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Werke von Sigmund Freud, insbesondere seine Fallstudie von Fräulein Elisabeth von R., und die Werke von Arthur Schnitzler, u.a. die Erzählung "Frau Berta Garlan" und das Drama "Fräulein Else". Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Darstellung von Frauenfiguren und deren "hysterischen" Symptomen in beiden Kontexten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 beleuchtet den historischen Kontext der Hysterie. Kapitel 2 analysiert die literarische Darstellung der Hysterie bei Freud und Schnitzler. Kapitel 3 vergleicht Freuds Fallbeispiel mit Schnitzlers "Frau Berta Garlan". Kapitel 4 analysiert den "hysterischen" Anfall in Schnitzlers "Fräulein Else". Kapitel 5 bietet Schlussbemerkungen zur Unausweichlichkeit eines frauenspezifischen Krankheitsbildes.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analysemethode, die medizinische und literarische Texte verbindet. Sie untersucht die Darstellung von Frauenfiguren und deren "Hysterie" im Kontext der gesellschaftlichen Normen, familiären Strukturen und Sexualität der damaligen Zeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hysterie, Psychoanalyse, Literatur, Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Frauenbilder, Fin de Siècle, Wiener Gesellschaft, Sexualität, Weiblichkeit, Krankheitskonzept, Gesellschaftlicher Druck, Fallstudie, literarische Analyse.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine detaillierte Analyse der Konstruktion des Hysterie-Konzepts in medizinischer und literarischer Hinsicht. Sie zeigt auf, wie die Diagnose "Hysterie" geschlechtsspezifisch konnotiert war und welche Rolle gesellschaftliche Normen und Erwartungen bei der Entstehung und Ausprägung der Symptome spielten. Der Vergleich der Fallbeispiele ermöglicht es, die Vielschichtigkeit des Krankheitsbildes und seine kulturelle Einbettung zu verdeutlichen.
- Citation du texte
- MA Marika Müller (Auteur), 2005, Natürlich hysterisch! - Entwürfe psychoanalytischer und literarischer Frauenbilder um 1900 bei Freud und Schnitzler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74176