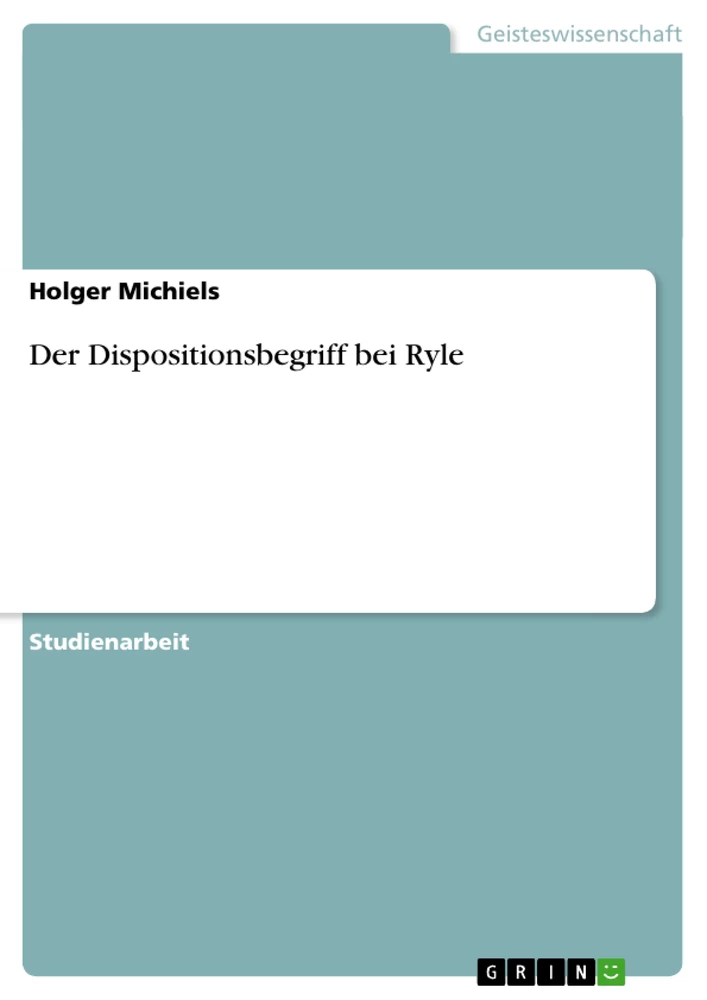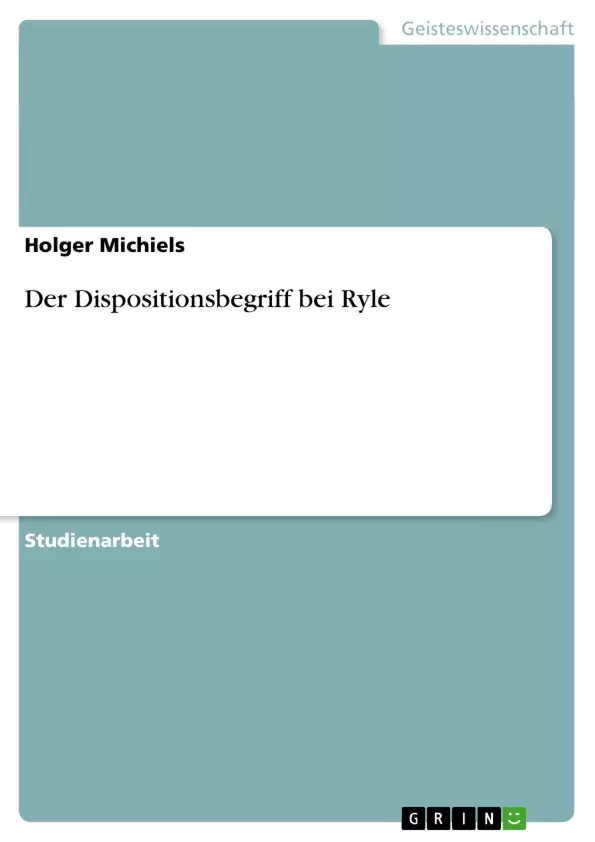Es gibt nicht gerade viele Schlagwörter, die ihren Weg aus der philosophischen Fachwelt in die Alltagssprache auch unphilosophischer Naturen gefunden haben. Gilbert Ryles griffige Formulierung vom ‚Gespenst in der Maschine‘ gehört sicherlich dazu, was umso mehr verwundern muß, da sich sein Hauptwerk um ein Thema dreht, das der Durchschnittsbürger eher stillschweigend voraussetzt: der Verbindung von Körper und Geist. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Ryles Dispositionsbegriff in seinem 1949 erschienen Hauptwerk ‚The Concept of Mind‘.
Die vorliegende Arbeit besteht aus drei Teilen. Jedes Hauptkapitel beschäftigt sich mit einer Teilfrage. Im Mittelpunkt steht dabei die Hauptfrage, wie Dispositionen intelligentes Verhalten erklären können. Im ersten Kapitel geht es darum, welche Thesen die Zwei-Welten- Lehre vertritt und was Ryle daran kritisiert. Der zweite Abschnitt hat Ryles eigene Theorie zum Gegenstand. Es wird gefragt, was Dispositionen sind, wie sie sich im normalen Sprachgebrauch zeigen und wie sie sich von Vorgangswörter unterscheiden lassen.
Im letzten Teil versuchen wir abschließend eine Kritik an Ryles Dispositionsbegriff. Hierbei gehen wir zuerst der Frage nach, ob sich intelligente (mehrspurige) und nicht-intelligente (einspurige) Verhaltensweisen zufriedenstellend voneinander trennen lassen, oder ob nicht die natürliche Vagheit aller Sprache dem Dispositionsansatz ein Stück Erklärungskraft nimmt. Zuletzt beschäftigen wir uns mit der Frage, ob es ausreicht, wenn sich Ryle bei der Erklärung von dispositionalen Sachverhalten auf die Manifestation-Disposition-Dualität beschränkt, oder ob nicht doch der Rückgriff auf weitere, kausale Gründe notwendig erscheint. Im Hinblick auf den Untersuchungsstil liesse sich der Ablauf der vorliegenden Arbeit auch so beschreiben: Zuerst kommt das ‚Dogma‘ und Ryles Kritik daran, dann folgt Ryles Gegentheorie und schließlich eine Kritik an dieser Theorie. Der Untersuchungsductus wechselt also von deskriptiv und destruktiv (Kapitel 1) zu konstruktiv (Kapitel 2) zu destruktiv (Kapitel 3). Kein Gegenstand dieser Arbeit soll die in der deutschsprachigen Rezeption vor allem von Röd und Savigny diskutierte Frage sein, ob Ryles Bezeichnung des Körper-Geist-Dualismus als ‚Descartes Mythos‘ philosophiegeschichtlich gerechtfertigt ist oder nicht.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Ryles Darstellung des ,Dogmas' und seine Kritik
- 1.1 ,Die offizielle Doktrin'
- 1.1.1 Der Kategorienfehler
- 1.1.2 Wie kam es zum Kategorienfehler?
- 1.2 Die ,intellektualistische Legende'
- 1.2.1 Ryles Einwand gegen die ,intellektualistische Legende'
- 2. Ryles Gegentheorie
- 2.1 Intelligenz-Prädikate
- 2.2 Was ist eine Disposition?
- 2.2.1 Dispositions- und Vorgangswörter
- 2.2.2 Dispositionstypen
- 2.2.2.1 Einspurige und mehrspurige Dispositionen
- 2.2.2.2 Eigenschaften und Fertigkeiten
- 2.2.2.3 Erworbene und nicht erworbene Dispositionen
- 2.3 Zusammenfassung
- 3. Kritik an Ryles Dispositionsbegriff
- 3.1 Vagheit mehrspuriger Dispositionen
- 3.2 Dispositionen vs. kausale Ursachen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Ryles Dispositionsbegriff, wie er in seinem 1949 erschienenen Werk „The Concept of Mind“ dargestellt wird. Ziel ist es, zu analysieren, wie Dispositionen intelligentes Verhalten erklären können. Die Arbeit setzt sich mit Ryles Kritik an der traditionellen „Zwei-Welten-Lehre“ auseinander und beleuchtet seine eigene Theorie von Dispositionen. Dabei werden verschiedene Arten von Dispositionen sowie deren Verhältnis zu Vorgangswörtern untersucht. Schließlich wird Ryles Dispositionsbegriff kritisch beleuchtet, indem die Vagheit mehrspuriger Dispositionen und die Frage nach kausalen Ursachen hinterfragt werden.
- Ryles Kritik am „Dogma“ der Zwei-Welten-Lehre
- Die Rolle von Dispositionen bei der Erklärung von intelligentem Verhalten
- Unterscheidung zwischen Dispositions- und Vorgangswörtern
- Arten von Dispositionen (einspurig, mehrspurig, erworben, nicht erworben)
- Kritische Betrachtung der Vagheit mehrspuriger Dispositionen und deren kausale Erklärungskraft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert Ryles Kritik an der traditionellen Zwei-Welten-Lehre. Dabei wird auf den „Kategorienfehler“ hingewiesen, der zu der Annahme führt, dass mentale Zustände von einer physischen Welt getrennt existieren. Ryles Kritik an der „intellektualistischen Legende“ wird ebenfalls beleuchtet, die mentale Zustände als bloße interne Prozesse beschreibt, die sich durch Sprache erfassen lassen. Das zweite Kapitel stellt Ryles eigene Theorie der Dispositionen vor. Es wird erläutert, wie Dispositionen als prädikative Ausdrücke intelligentes Verhalten erklären können. Die Arbeit geht auf die Unterscheidung zwischen Dispositions- und Vorgangswörtern ein und analysiert verschiedene Arten von Dispositionen, wie z.B. einspurige und mehrspurige Dispositionen. Im letzten Kapitel wird Ryles Dispositionsbegriff kritisch beleuchtet. Es wird argumentiert, dass die Vagheit mehrspuriger Dispositionen problematisch sein kann und dass die Erklärung von Dispositionen möglicherweise kausale Gründe erfordert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Dispositionsbegriff, der von Gilbert Ryle zur Erklärung von intelligentem Verhalten verwendet wird. Die wichtigsten Themen sind der „Kategorienfehler“, die „intellektualistische Legende“, die Unterscheidung zwischen Dispositions- und Vorgangswörtern, sowie die verschiedenen Arten von Dispositionen. Die Arbeit beleuchtet die Schwächen und Stärken von Ryles Ansatz und stellt die Frage nach der ausreichenden Erklärungskraft von Dispositionen im Vergleich zu kausalen Ursachen.
Häufig gestellte Fragen
Was meint Gilbert Ryle mit dem „Gespenst in der Maschine“?
Dies ist Ryles Kritik am Körper-Geist-Dualismus (Descartes' Mythos). Er lehnt die Vorstellung ab, dass der Geist eine separate, unsichtbare Entität ist, die den physischen Körper steuert.
Was ist ein „Kategorienfehler“ nach Ryle?
Ein Kategorienfehler liegt vor, wenn man Begriffe unterschiedlicher logischer Typen so behandelt, als gehörten sie derselben Kategorie an (z. B. den Geist als ein zusätzliches "Teil" zum Körper zu betrachten).
Wie definiert Ryle den Begriff „Disposition“?
Dispositionen sind keine verborgenen Zustände, sondern Tendenzen oder Fähigkeiten, sich unter bestimmten Umständen auf eine gewisse Weise zu verhalten (z. B. "löslich" oder "intelligent").
Was ist der Unterschied zwischen einspurigen und mehrspurigen Dispositionen?
Einspurige Dispositionen äußern sich in einer spezifischen Reaktion (z. B. ein Reflex), während mehrspurige Dispositionen (wie Intelligenz) eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungen umfassen können.
Warum wird Ryles Ansatz kritisiert?
Kritiker bemängeln die Vagheit mehrspuriger Dispositionen und fragen, ob rein dispositionale Erklärungen ohne Rückgriff auf kausale Ursachen im Gehirn ausreichen.
- Quote paper
- Holger Michiels (Author), 2005, Der Dispositionsbegriff bei Ryle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74300