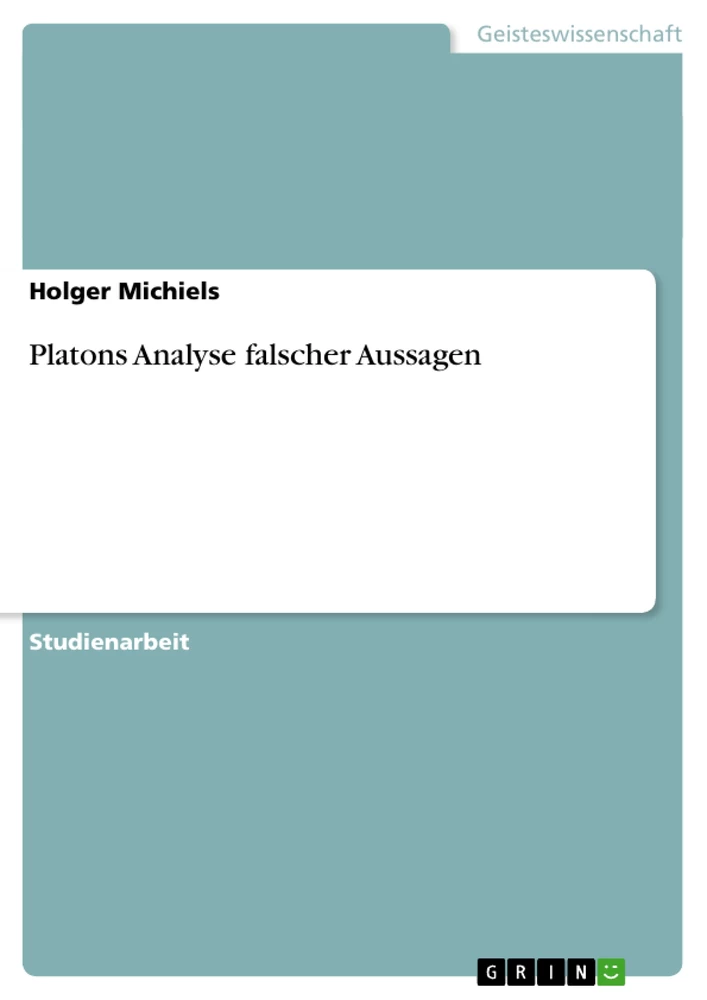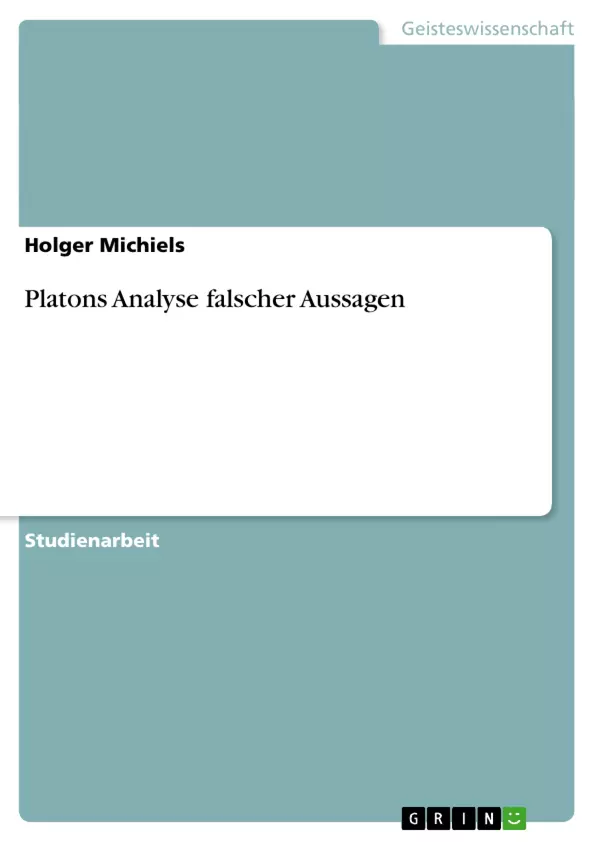In seinem Dialog ‚Sophistes’ sucht Platon die offensive Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Zunft der Sophisten. Die Sophisten waren Wanderlehrer, die im damaligen Griechenland von Stadt zu Stadt zogen und den Menschen ihre Weisheit und Wortfertigkeit gegen Bezahlung feilboten. Sie waren die Spin-Doctors ihrer Zeit und Relativität war ihr Metier: sie konnten mit Hilfe ihrer rhetorischen Fähigkeiten und moralischen Ungebundenheit eine gute Sache schlecht reden und eine schlechte gut. Vielen ihrer Zeitgenossen erschienen sie wie Chamäleone, an denen sich die Geister der Leute schieden: „Diese Männer produzieren sich vor der unwissenden Menge ‚in vielerlei Gestalt’, wenn sie ‚die Städte durchstreifen’ und als echte und nicht nur vorgebliche Philosophen ganz von oben auf das Leben der Menschen unten in den Niederungen hinabschauen. Manchem scheinen sie als reine Nichtsnutze, anderen höchster Ehren wert zu sein; manchmal treten sie als Politiker auf, manchmal als Sophisten...“. Derartig vielseitig veranlagt und tätig waren die Sophisten also schwierige Patienten, deren Enttarnung als Meister der Worthülse nicht ohne größere Anstrengungen zu bewerkstelligen war.
Wohl aus diesem Grund hat Platon im ‚Sophistes’ seine Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Sophismus ungewöhnlich breit und systematisch angelegt. Er nähert sich dem Thema auf zwei Wegen, nämlich zum einen mit einer begrifflichen Bestimmung der Person des Sophisten am Anfang und dann wieder am Ende des Dialogs und zum anderen mit einer Auseinandersetzung mit der sophistischen Lehre selbst, die in den Zwischenabschnitten erfolgt.
Im folgenden möchte ich mit einem dieser Abschnitte beschäftigen, der als der Höhepunkt des Dialogs bezeichnet werden kann, da er – nach langer Vorbereitung – die direkte Antwort Platons auf die sophistische Vermischung von Sein und Schein in Wort und Rede enthält.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Warum prädikative Sätze?
- 2. Absolutes Nichtsein
- 2.1 Die sophistische Position
- 2.2 Platons Position
- 3. Locus von Wahr- und Falschheit
- 4. Relatives Nichtsein
- 5. Analyse der falschen Rede
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Platons Analyse falscher Aussagen im Dialog „Sophistes“. Ziel ist es, Platons Position zu falscher Rede im Kontext seiner Metaphysik des Seins und Nichtseins zu verstehen und diese von der sophistischen Auffassung abzugrenzen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, wie eine Aussage laut Platon falsch sein kann, ohne unmöglich zu sein.
- Platons Auseinandersetzung mit dem Sophismus
- Der Unterschied zwischen absolutem und relativem Nichtsein in Platons Metaphysik
- Die Rolle prädikativer Sätze in Platons Analyse falscher Aussagen
- Die sophistische Position zur Möglichkeit falscher Aussagen
- Platons Lösung des Problems der Möglichkeit falscher Aussagen
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext von Platons „Sophistes“ dar, indem sie die Sophisten als Wanderlehrer und Meister der Rhetorik beschreibt, die mit ihrer Relativität eine gute Sache schlecht und eine schlechte gut reden konnten. Platon wendet sich in seinem Dialog systematisch mit einer begrifflichen Bestimmung des Sophisten und einer Auseinandersetzung mit dessen Lehre diesem Phänomen zu. Die Arbeit konzentriert sich auf Platons Analyse falscher Aussagen in Kapitel V (262e-263d) als Anwendung seiner Partizipations-Metaphysik und untersucht, wie eine Aussage laut Platon falsch sein kann, ohne unmöglich zu sein.
1. Warum prädikative Sätze?: Dieses Kapitel würde sich mit der Begründung Platons befassen, warum er sich in seiner Analyse auf prädikative Sätze konzentriert. Es würde die spezifischen Eigenschaften prädikativer Sätze untersuchen, die sie für Platons Analyse von Wahr- und Falschheit besonders geeignet machen. Der Fokus läge darauf, warum andere Satzarten für Platons Argumentation weniger relevant sind oder warum sie aus seiner Perspektive nicht dieselbe Problematik aufwerfen.
2. Absolutes Nichtsein: Dieses Kapitel behandelt Platons Unterscheidung zwischen absolutem und relativem Nichtsein und vergleicht Platons Position mit der der Sophisten. Es analysiert die sophistische Sichtweise auf das Nichtsein und zeigt auf, wo und warum sich Platons Auffassung entscheidend von ihr unterscheidet. Die verschiedenen Aspekte des Seins und Nichtseins würden im Detail beleuchtet und in Bezug zueinander gesetzt werden, um die Grundlage für Platons Analyse falscher Aussagen zu schaffen.
3. Locus von Wahr- und Falschheit: Hier würde die Arbeit die Struktur von Subjekt-Prädikat-Sätzen untersuchen und die Bedingungen analysieren, die eine Aussage wahr oder falsch machen. Es würde die Beziehung zwischen dem Subjekt, dem Prädikat und dem Sein beleuchtet, um die Grundlagen für die Beurteilung der Wahrheit oder Falschheit einer Aussage zu erarbeiten. Die Kapitel würde die Rolle der Partizipation in Platons Metaphysik erläutern und deren Bedeutung für die Wahrheitsbestimmung von Aussagen hervorheben.
4. Relatives Nichtsein: Dieses Kapitel erläutert Platons Auffassung von Sein als Anderssein (relatives Nichtsein) im Detail. Es würde verschiedene Beispiele aus dem "Sophistes" heranziehen, um Platons Konzept zu verdeutlichen. Der Fokus liegt darauf, wie das Verständnis von relativem Nichtsein zum Verständnis von falschen Aussagen beiträgt und wie es Platons Argumentation in Bezug auf die Möglichkeit falscher Aussagen stützt.
5. Analyse der falschen Rede: Dieses Kapitel präsentiert Platons Analyse falscher Aussagen. Es synthetisiert die vorherigen Kapitel, um eine Antwort auf die Leitfrage zu geben: Wie kann eine Aussage laut Platon falsch sein, ohne unmöglich zu sein? Das Kapitel würde Platons Lösung des Problems der Möglichkeit falscher Aussagen darlegen und die Bedeutung seiner Metaphysik des Seins und Nichtseins für sein Verständnis von Wahrheit und Falschheit hervorheben.
Schlüsselwörter
Platon, Sophistes, falsche Aussage, Wahrheitsbegriff, Sein, Nichtsein, absolutes Nichtsein, relatives Nichtsein, Prädikatsatz, Sophismus, Partizipationsmetaphysik, ontologische Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Platons Analyse falscher Aussagen im Sophistes
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Platons Auseinandersetzung mit falschen Aussagen im Dialog „Sophistes“. Im Fokus steht das Verständnis von Platons Position im Kontext seiner Metaphysik des Seins und Nichtseins, insbesondere im Vergleich zur sophistischen Auffassung. Die zentrale Frage lautet: Wie kann eine Aussage nach Platon falsch sein, ohne unmöglich zu sein?
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Platons Auseinandersetzung mit dem Sophismus, die Unterscheidung zwischen absolutem und relativem Nichtsein in Platons Metaphysik, die Rolle prädikativer Sätze in Platons Analyse falscher Aussagen, die sophistische Position zur Möglichkeit falscher Aussagen und schließlich Platons Lösung des Problems der Möglichkeit falscher Aussagen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 0 (Einleitung) stellt den Kontext des Sophistes und die Problematik der sophistischen Relativität dar. Kapitel 1 ("Warum prädikative Sätze?") begründet Platons Fokus auf prädikative Sätze. Kapitel 2 ("Absolutes Nichtsein") vergleicht Platons und die sophistische Position zum Nichtsein. Kapitel 3 ("Locus von Wahr- und Falschheit") untersucht die Struktur von Subjekt-Prädikat-Sätzen und die Bedingungen von Wahrheit und Falschheit. Kapitel 4 ("Relatives Nichtsein") erläutert Platons Konzept des relativen Nichtseins. Kapitel 5 ("Analyse der falschen Rede") präsentiert Platons Analyse falscher Aussagen und beantwortet die zentrale Forschungsfrage.
Wie unterscheidet sich Platons Position zur falschen Rede von der sophistischen Position?
Die Arbeit vergleicht explizit Platons Position mit der der Sophisten hinsichtlich des Nichtseins und der Möglichkeit falscher Aussagen. Sie zeigt auf, wo und warum sich Platons Auffassung entscheidend von der sophistischen unterscheidet, indem sie die jeweiligen Argumentationen und zugrundeliegenden metaphysischen Annahmen kontrastiert.
Welche Rolle spielt die Metaphysik des Seins und Nichtseins in Platons Analyse?
Platons Metaphysik des Seins und Nichtseins bildet die Grundlage seiner Analyse falscher Aussagen. Die Unterscheidung zwischen absolutem und relativem Nichtsein ist zentral für sein Verständnis von Wahrheit und Falschheit. Die Arbeit erläutert die Bedeutung der Partizipationsmetaphysik für Platons Wahrheitsbestimmung.
Welche Bedeutung haben prädikative Sätze in Platons Analyse?
Platon konzentriert seine Analyse auf prädikative Sätze, da deren spezifische Eigenschaften sie für die Untersuchung von Wahr- und Falschheit besonders geeignet erscheinen lassen. Die Arbeit untersucht, warum andere Satzarten für Platons Argumentation weniger relevant sind.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Platon, Sophistes, falsche Aussage, Wahrheitsbegriff, Sein, Nichtsein, absolutes Nichtsein, relatives Nichtsein, Prädikatsatz, Sophismus, Partizipationsmetaphysik, ontologische Analyse.
- Citar trabajo
- Holger Michiels (Autor), 2003, Platons Analyse falscher Aussagen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74301