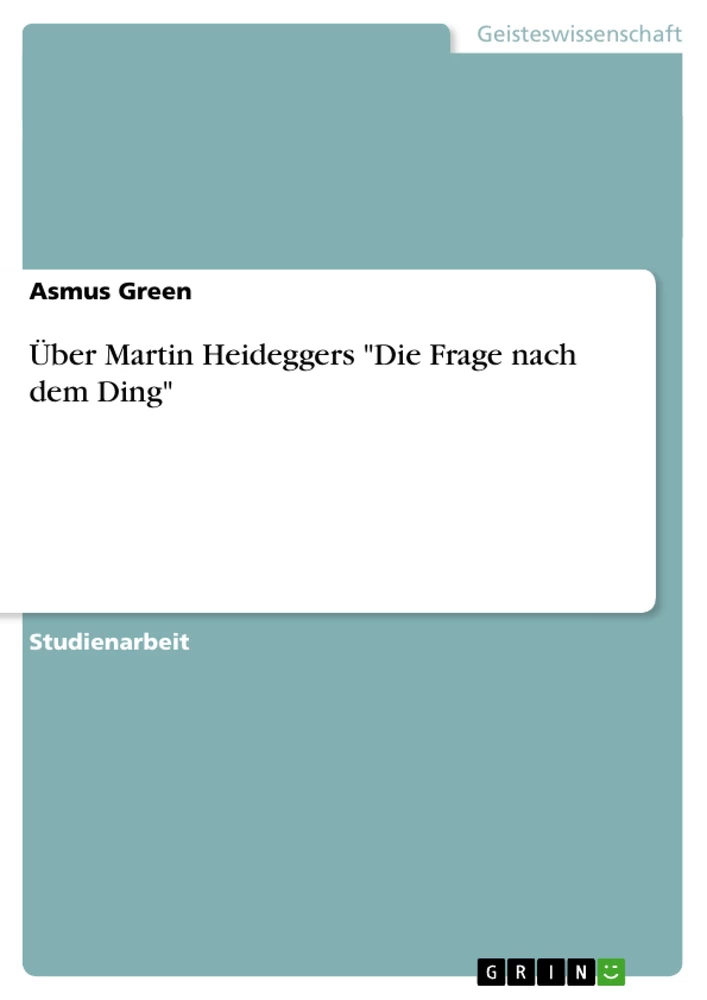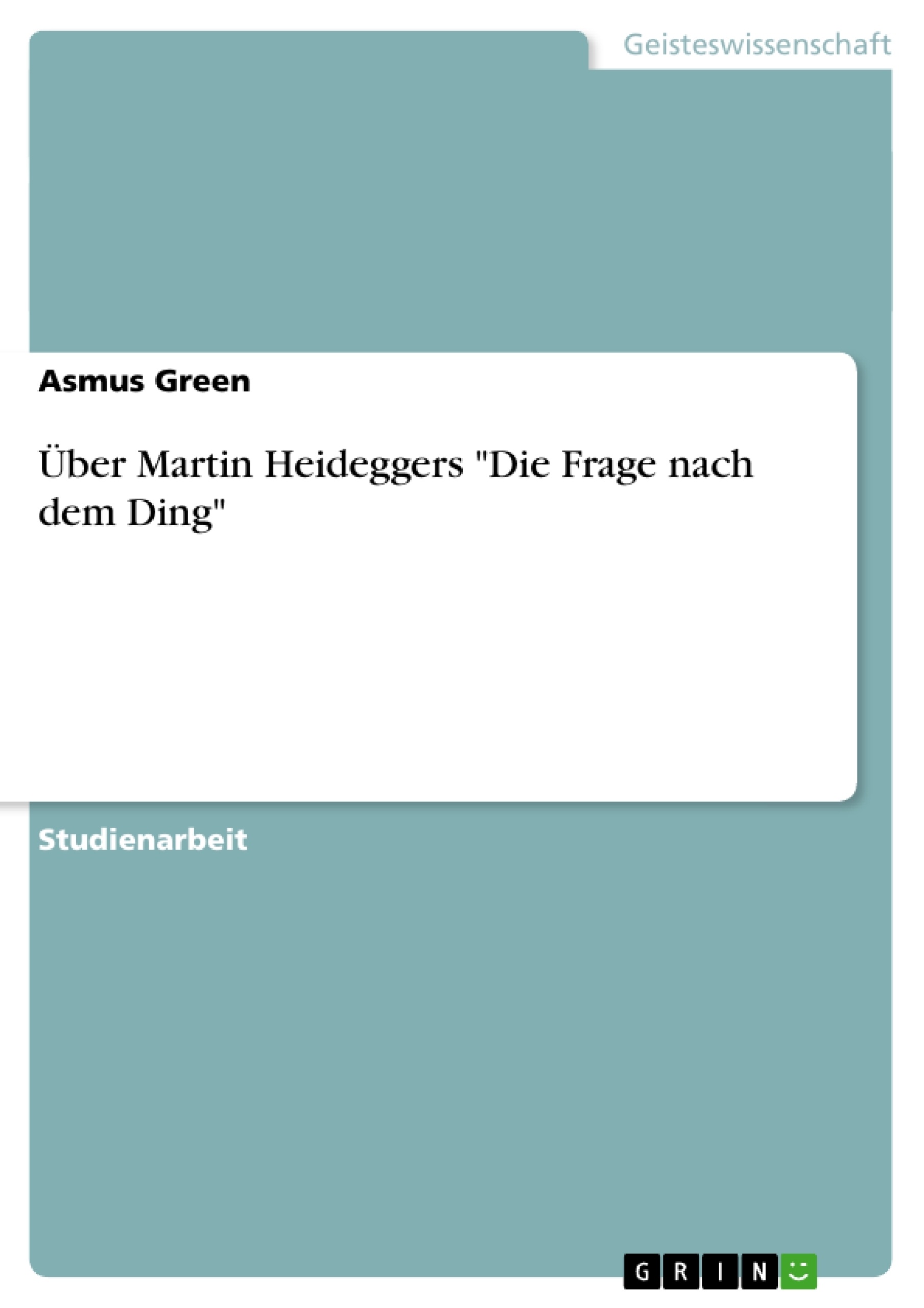In seiner Vorlesung gibt Heidegger zunächst einen knappen geschichtlichen Überblick über die Dingfrage und die Metaphysik von der griechischen Antike bis zur frühen Neuzeit, um sich dann im Hauptteil der Dingfrage anhand von Immanuel Kants Hauptwerk, der “Kritik der reinen Vernunft” zu nähern. Die Frage nach dem Ding, die Heidegger im Titel des vorliegenden Buches und im ersten Teil seiner Vorlesung stellt und vorstellt, fragt nicht nach der Beschaffenheit eines bestimmten Dinges wie z. B. der Zoologe sich um die Beschaffenheit eines bestimmten Tieres kümmert, sondern nach der Beschaffenheit eines bestimmten Dinges als Ding. Gemeint ist also die Frage nach dem Dinghaften der Dinge und damit auch nach dem, was die Dinge in ihrer Dinghaftigkeit be-dingt. Dieses die Dinge Bedingende muss selbst un-bedingt sein, also die Dinge in ihrem Sein beeinflussen und selbst durch nichts beeinflusst sein. Der Zusammenhang mit der “Kritik der reinen Vernunft” besteht in der Antwort auf die Dingfrage: Das die Dinge Be-dingende, was den Dingen ihre Dingheit verleiht, sind die Grundsätze der reinen Vernunft, die Kant in seinem Hauptwerk vorstellt. Die “Kritik der reinen Vernunft” antwortet also auf die Dingfrage, weswegen Heidegger sie zum Hauptbestandteil seiner Vorlesung macht.
Um die Frage nach dem Ding anhand der “Kritik der reinen Vernunft” zu beantworten, legt Heidegger das zweite Hauptstück der transzendentalen Analytik aus, das “System aller Grundsätze des reinen Verstandes”.
Diese Arbeit soll die Argumentationsstruktur des von Heidegger ausgewählten “Hauptstückes” der “Kritik der reinen Vernunft” wiedergeben und aufzeigen, wie das vorgestellt wird, was die Dinge in ihrer Dingheit bedingt, wie das “System aller Grundsätze des reinen Verstandes” sich auf die Dingheit der Dinge auswirkt.
Die Aufgabe und das Ziel der “Kritik der reinen Vernunft” von Kant ist eine Kritik des menschlichen Vernunftvermögens überhaupt im Sinne einer Umgrenzung seines Potentials und seiner Möglichkeiten. Anlass dieser Kritik ist das Anliegen, klären zu wollen, welche Erkenntnisse überhaupt vom menschlichen Verstand auf sicherem Wege gewonnen werden können, darüber hinaus und damit einhergehend, ob eine Metaphysik als Wissenschaft möglich ist und inwiefern sie möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangsfrage: Wie ist eine Metaphysik möglich?
- Das Mathematische als Grundgedanke der “Kritik der reinen Vernunft”
- Der Satz vom Widerspruch als Grundsatz aller analytischen Urteile
- Erkenntnis als Denken und Anschauung
- Neuer Urteilsbegriff
- Weitere Eigenschaften des neuen Urteilsbegriffes
- Systematische Vorstellung aller synthetischen Grundsätze des reinen Verstandes
- Die Axiome der Anschauung
- Die Antizipationen der Wahrnehmung
- Die Analogien der Erfahrung
- Die Postulate des empirischen Denkens überhaupt
- Kreisgang der Beweise/Oberster Grundsatz der synthetischen Urteile: Das Zwischen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Argumentationsstruktur von Heideggers Analyse des zweiten Hauptstücks der transzendentalen Analytik in Kants "Kritik der reinen Vernunft" darzulegen. Dabei soll aufgezeigt werden, wie Heidegger das System der Grundsätze des reinen Verstandes als die Grundlage für die Dinghaftigkeit der Dinge darstellt.
- Das Mathematische als Grundlage der Erkenntnis
- Die Frage nach der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori
- Das System der Grundsätze des reinen Verstandes als Bedingung für die Dinghaftigkeit
- Die Kritik des menschlichen Vernunftvermögens und die Möglichkeit der Metaphysik
- Die Rolle von Urteilen in der Erkenntnis von Dingen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Buch "Die Frage nach dem Ding" und seine Entstehungsgeschichte vor und erläutert Heideggers Ziel, Kants "Kritik der reinen Vernunft" zur Beantwortung der Dingfrage zu nutzen.
- Ausgangsfrage: Wie ist eine Metaphysik möglich?: In diesem Kapitel wird die Frage nach der inneren Möglichkeit einer Metaphysik als Wissenschaft behandelt. Es wird betont, dass Metaphysik auf Erkenntnissen a priori beruhen muss, die in synthetischen Urteilen formuliert werden.
- Das Mathematische als Grundgedanke der “Kritik der reinen Vernunft”: Hier wird der Gedanke des Mathematischen als Grundhaltung der Erkenntnisgewinnung vorgestellt, bei der die Erkenntnis vom Objekt nicht einfach abgelesen, sondern vom Erkennenden konstruiert wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Metaphysik, "Kritik der reinen Vernunft", Immanuel Kant, Martin Heidegger, Dingfrage, System der Grundsätze des reinen Verstandes, synthetische Urteile a priori, Mathematisches, Erkenntnis, Dinghaftigkeit, transzendentale Analytik, Vernunftvermögen.
- Arbeit zitieren
- Asmus Green (Autor:in), 2007, Über Martin Heideggers "Die Frage nach dem Ding", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74376