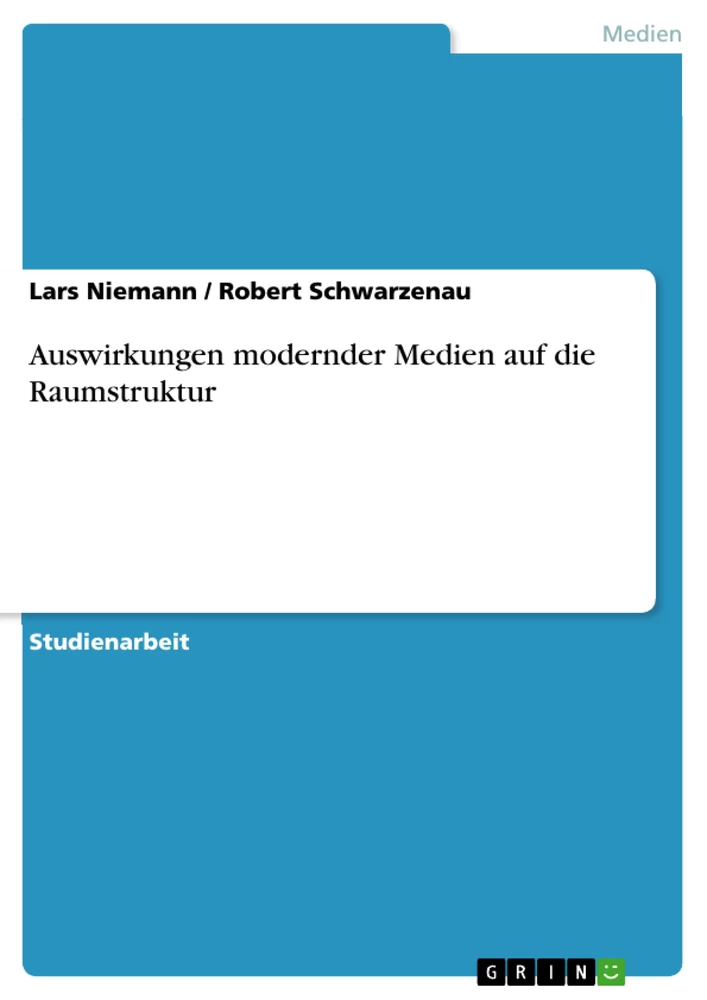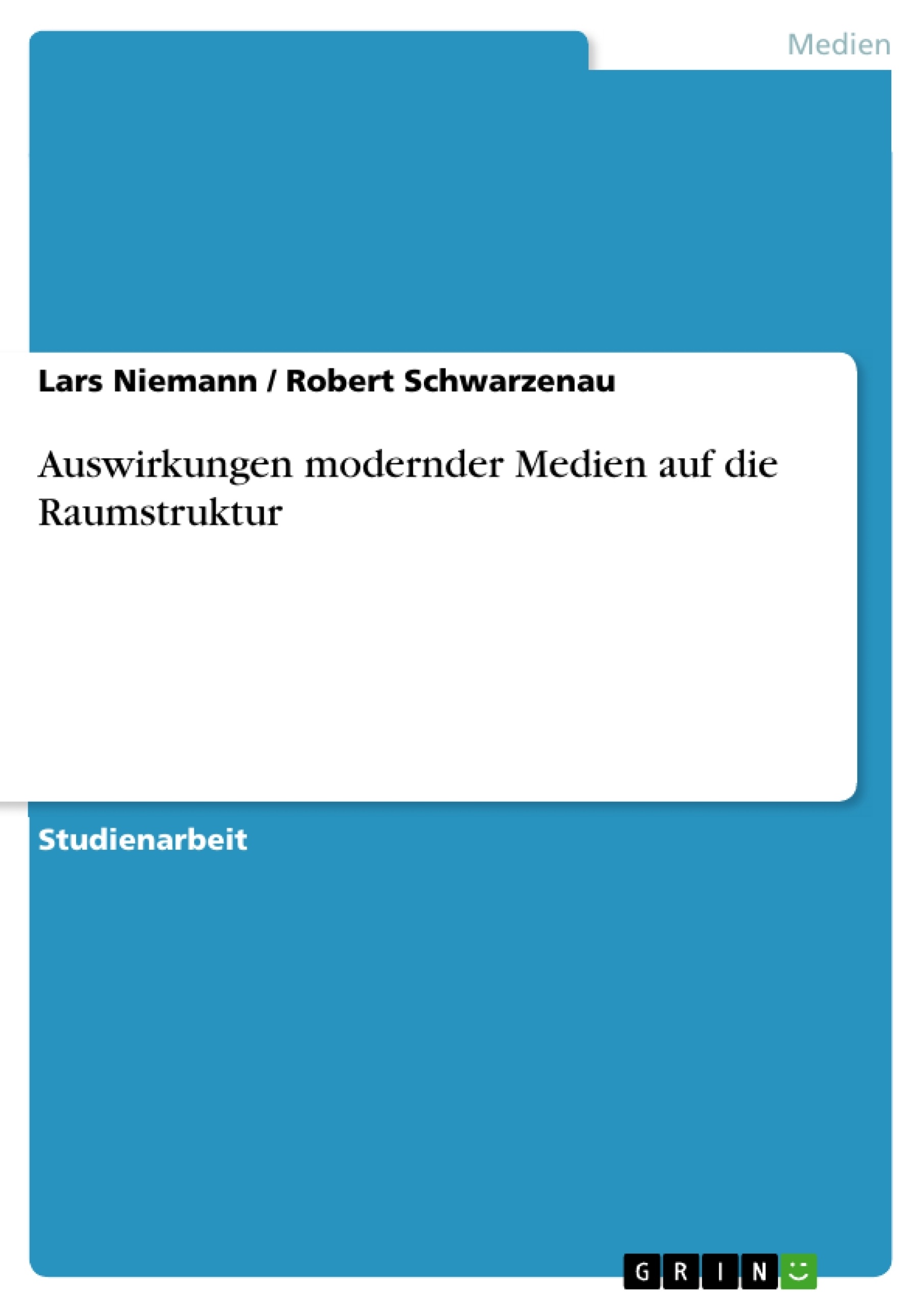Einführung
Der Begriff des Teledorfes hat eine starke Aktualität.
Allerorten werden Teledorf-Projekte ins Leben gerufen,
meist kombiniert mit Telearbeit und Telelernen. Diese
Projekte, so meint man, lösen Probleme der Umstrukturierung
und Strukturschwäche in Städten, Gemeinden
und Regionen.
Doch was sind Teledörfer?
a) Das Teledorf ist eine Entwicklungsstrategie, keine
„Sache“. Gemeinschaft von Menschen, Firmen, Schulen
etc. , die untereinander vernetzt sind und die globalen
Informationsquellen nutzen. (Keith Nelson Ph.D.
1998)
b) Das Teledorf ist eine kombinierte Entwicklung von
Wohn- und Arbeitsraum, basierend auf Telekommunikationstechnologien.
Teledörfer sind also laut Definition keine rein räumlichen
Gebilde, sondern ein Konstrukt aus Entwicklungsstrategie
und baulichem Bezug.
Diese Ausarbeitung setzt sich mit dem Thema Teledorf
in verschiedener Weise auseinander. Anhand von Beispielen
gebauter und sich in Bau befindlicher Projekte,
die unter der Überschrift Teledorf durchgeführt werden,
wird ein Versuch der Klassifizierung gemacht. Nach
allgemeingültigen Rückschlüssen wird dann die Problematik
des Teledorf-Gedankens auf Brandenburg
übertragen, sowie Kernpunkte und resultierende
Möglichkeiten diskutiert. Die Arbeit kann keine
Antworten auf Entwicklungsfragen geben, wohl aber
wertvolle Hinweise liefern, die in Zukunft bei der
Auseinandersetzung mit der telematischen Entwicklung
im Raum von entscheidender Bedeutung sein werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Umsetzungen der Theorien und Programme in der Praxis
- Teledorf als Reaktion auf Strukturschwäche
- Retzstadt, Bayern
- Norderstedt, Schleswig-Holstein
- Teledorf als Bestandteil neuer Planung
- ParcBIT, Spanien/Mallorca
- Klosterforst, Schleswig-Holstein
- Teledorf als Wiederentstehung verlorener Orte
- Colletta di Castelbianco, Italien
- Fazit und These für Brandenburg
- Konflikt der virtuellen Welt und des realen Raumes
- IT-Regionalkarte für Brandenburg als Entwicklungsstrategie
- Begriffsklärung Teledorf
- Initiative Bayern Online
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umsetzung des Konzepts "Teledorf" in verschiedenen Regionen und analysiert dessen Rolle als Reaktion auf strukturelle Schwächen im ländlichen Raum und als Bestandteil neuer Stadtplanungsstrategien. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Chancen dieser Entwicklung anhand konkreter Beispiele.
- Teledorf als Strategie zur Bekämpfung von Strukturschwäche in ländlichen Gebieten
- Analyse der Rolle von Telekommunikationstechnologien in der Raumstruktur
- Bewertung verschiedener Teledorf-Projekte hinsichtlich ihrer Umsetzung und Nachhaltigkeit
- Übertragbarkeit des Teledorf-Konzepts auf die Region Brandenburg
- Der Konflikt zwischen virtueller und realer Welt im Kontext von Teledörfern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Teledörfer ein und erläutert den Forschungsansatz der Arbeit. Sie definiert den Begriff des Teledorfes und beschreibt die methodische Vorgehensweise, anhand von Fallstudien verschiedene Projekte zu analysieren und Schlussfolgerungen für Brandenburg zu ziehen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung von Teledörfern als Entwicklungsstrategie und nicht als rein räumliches Phänomen. Die Arbeit verspricht keine endgültigen Antworten, sondern wertvolle Hinweise für zukünftige Entwicklungen im Bereich der Telematik.
Umsetzungen der Theorien und Programme in der Praxis: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Umsetzungen des Teledorf-Konzepts. Es analysiert exemplarisch verschiedene Projekte in unterschiedlichen Kontexten und Regionen, um die Vielfalt und die Herausforderungen bei der Umsetzung aufzuzeigen. Dabei werden sowohl erfolgreiche als auch weniger erfolgreiche Beispiele beleuchtet, um ein differenziertes Bild der Möglichkeiten und Grenzen des Konzepts zu liefern.
Teledorf als Reaktion auf Strukturschwäche: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Teledörfer als Antwort auf demografische und wirtschaftliche Herausforderungen in ländlichen Regionen. Anhand der Beispiele Retzstadt und Norderstedt wird gezeigt, wie Telekommunikationstechnologien eingesetzt werden, um den Verlust von Arbeitsplätzen und Funktionen auszugleichen, die Attraktivität der Region zu steigern und neue wirtschaftliche Aktivitäten anzuregen. Der Fokus liegt dabei auf den jeweiligen Strategien, den beteiligten Akteuren und den erzielten Ergebnissen.
Fazit und These für Brandenburg: Dieses Kapitel fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und überträgt die gewonnenen Erkenntnisse auf die spezifischen Gegebenheiten in Brandenburg. Es identifiziert Chancen und Herausforderungen für die Entwicklung von Teledörfern in Brandenburg und formuliert eine These für zukünftige Entwicklungen unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten.
Konflikt der virtuellen Welt und des realen Raumes: Dieses Kapitel beleuchtet den Spannungsfeld zwischen der virtuellen Vernetzung der Teledörfer und der Bedeutung des realen Raumes und der physischen Gemeinschaft. Es untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf die soziale Struktur und die Lebensqualität in den jeweiligen Regionen.
Schlüsselwörter
Teledorf, Telearbeit, Telelernen, Raumstruktur, Strukturschwäche, ländlicher Raum, Stadtentwicklung, Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Bayern Online, Multimediastadt, Breitband, Entwicklungsstrategie, Regionale Entwicklung, Brandenburg.
Häufig gestellte Fragen zu: Umsetzung des Konzepts "Teledorf"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Umsetzung des Konzepts "Teledorf" in verschiedenen Regionen. Sie analysiert dessen Rolle als Reaktion auf strukturelle Schwächen im ländlichen Raum und als Bestandteil neuer Stadtplanungsstrategien. Der Fokus liegt auf der Untersuchung von Teledörfern als Entwicklungsstrategie und nicht als rein räumliches Phänomen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Umsetzung von Teledorf-Konzepten in der Praxis, analysiert die Rolle der Telekommunikationstechnologien in der Raumstruktur, bewertet verschiedene Teledorf-Projekte, untersucht die Übertragbarkeit des Konzepts auf Brandenburg und beleuchtet den Konflikt zwischen virtueller und realer Welt im Kontext von Teledörfern. Konkrete Beispiele aus verschiedenen Regionen (Bayern, Schleswig-Holstein, Spanien, Italien) werden vorgestellt.
Welche Regionen und Projekte werden als Fallstudien verwendet?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Teledorf-Projekte in Retzstadt (Bayern), Norderstedt (Schleswig-Holstein), ParcBIT (Spanien/Mallorca), Klosterforst (Schleswig-Holstein) und Colletta di Castelbianco (Italien). Diese dienen dazu, die Vielfalt und Herausforderungen bei der Umsetzung des Konzepts aufzuzeigen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den praktischen Umsetzungen des Konzepts, Kapitel zu Teledörfern als Reaktion auf Strukturschwäche, ein Fazit mit einer These für Brandenburg, ein Kapitel zum Konflikt zwischen virtueller und realer Welt, sowie eine IT-Regionalkarte für Brandenburg als Entwicklungsstrategie, eine Begriffserklärung zu "Teledorf" und Informationen zur Initiative Bayern Online.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht keine endgültigen Antworten, sondern liefert wertvolle Hinweise für zukünftige Entwicklungen im Bereich der Telematik und identifiziert Chancen und Herausforderungen für die Entwicklung von Teledörfern in Brandenburg, unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten. Der Fokus liegt auf der Analyse der verschiedenen Strategien, beteiligten Akteure und erzielten Ergebnisse der untersuchten Projekte.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind Teledorf, Telearbeit, Telelernen, Raumstruktur, Strukturschwäche, ländlicher Raum, Stadtentwicklung, Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Bayern Online, Multimediastadt, Breitband, Entwicklungsstrategie und Regionale Entwicklung.
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Methode, die auf Fallstudien verschiedener Teledorf-Projekte basiert, um die Umsetzung des Konzepts zu analysieren und daraus Schlussfolgerungen für Brandenburg zu ziehen.
- Quote paper
- Lars Niemann (Author), Robert Schwarzenau (Author), 2000, Auswirkungen modernder Medien auf die Raumstruktur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/744