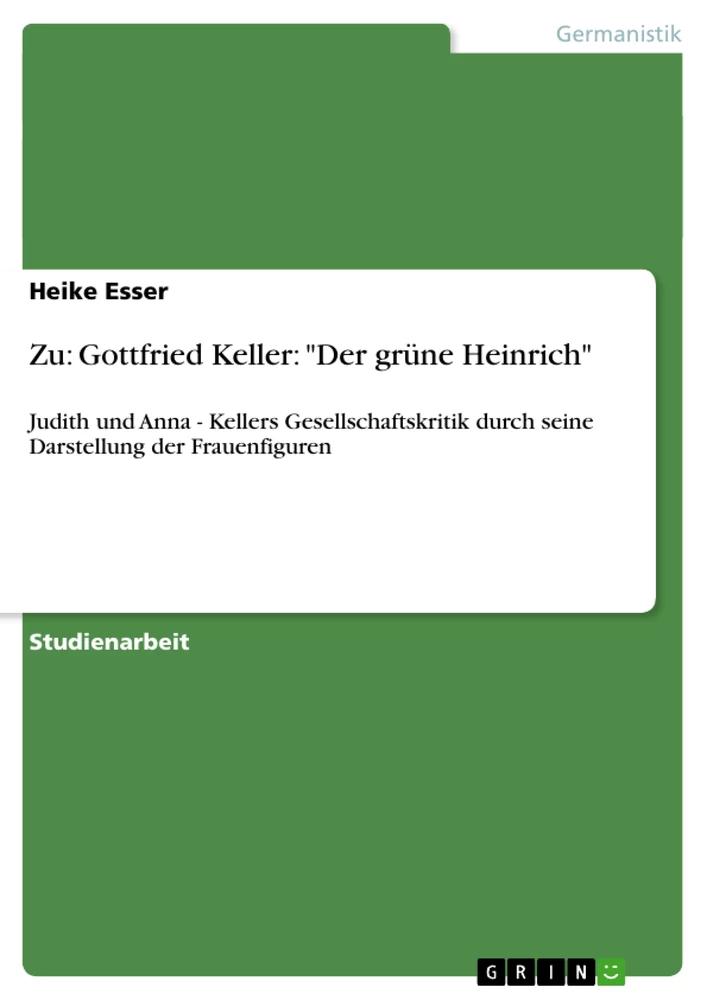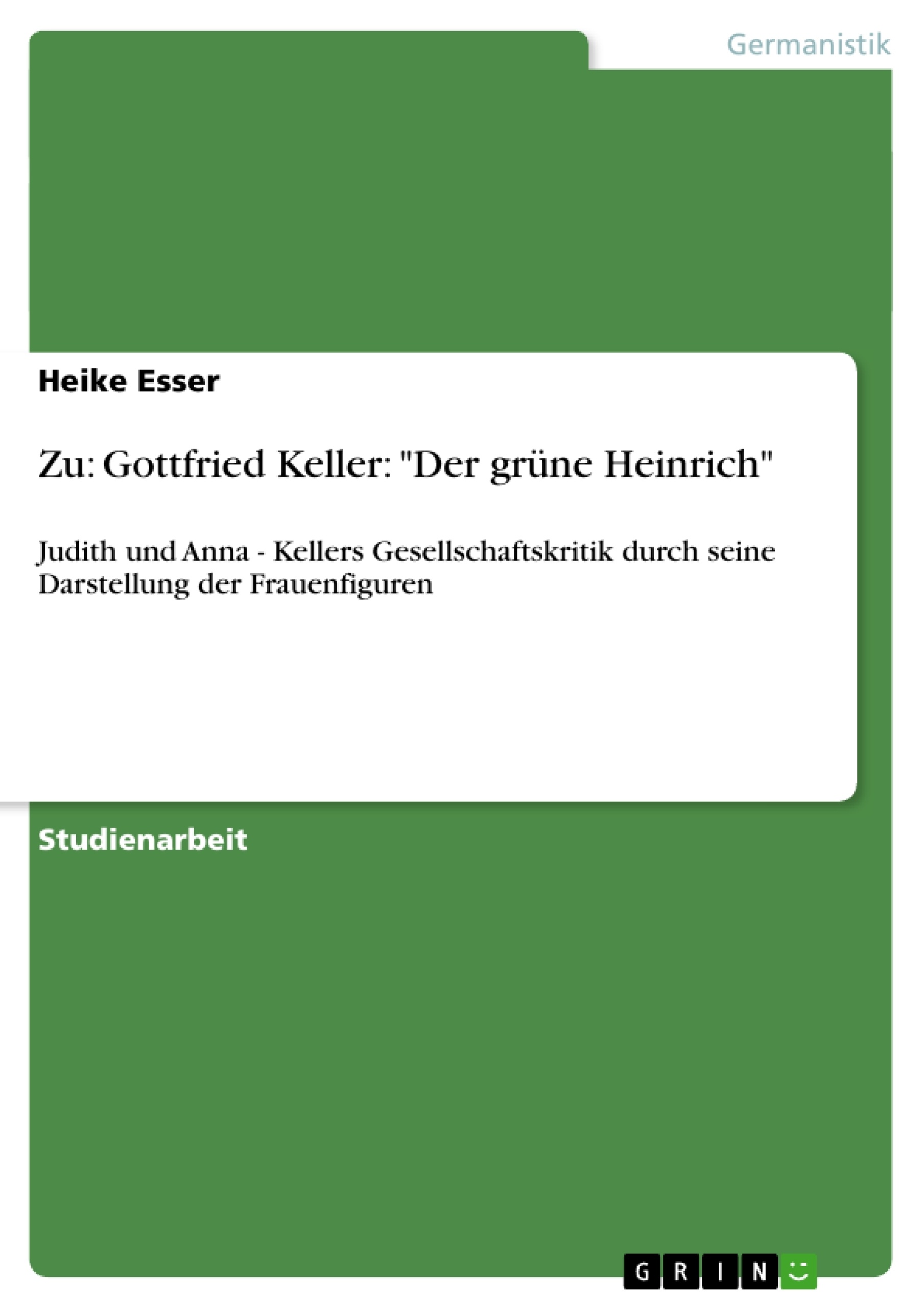Deise Arbeit setzt sich mit Kellers Darstellung der Frauenfiguren Judith und Anna aus dem Roman "Der grüne Heinrich" und der damit verbundenen umfassenden Gesellschaftskritik auseinander, die folgende Facetten aufweist: Kritisiert wird die verkommene gesellschaftliche Verkehrsform, die Zwänge auslösende calvinistische Religiosität, die unreflektierte Erfüllung der Bildungsnorm, die eine Persönlichkeitsentwicklung unterdrückende zeitgenössische Frauenrolle und die die Frauen auf Marktwert und Sexualobjekt reduzierende Geschlechterpolarisierung.
Beide Frauen haben trotz ihrer Verschiedenheit gemeinsam, dass sie beide an dem Versuch, die eigene Persönlichkeit auszuleben, vom sozialen Umfeld gehindert werden. Beide gehen an den repressiven Normen und Konventionen und den zeitgenössischen Geschlechterrollen zu Grunde und zwar jede auf ihre eigene Weise: Anna stirbt und Judith reagiert mit Auswanderung nach Amerika.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die beiden Frauenfiguren und ihr Verhältnis zum sozialen Umfeld, insbesondere zu Heinrich, zum zeitgenössischen Bild der Frauenrolle, zur Auffassung von Religiosität und der Bildungsnorm und die Frage, inwiefern Keller anhand dieser beiden Frauenfiguren Kritik an den genannten Institutionen übt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Römerbeichte – Kritik an den gesellschaftlichen Verkehrsformen
- Kritik an der zeitgenössischen Auffassung von Religiosität
- Kritik an den Geschlechterrollen bzw. dem zeitgenössischen Bild der Frauenrolle
- Anna – Kritik der unreflektierten Erfüllung der Bildungsnormen
- Judith
- Verkörpert Judith die Figur der „Femme fatale“?
- Die „lustige Witwe“ Judith und ihr Verhältnis zum sozialen Umfeld
- Judiths Beziehung zu Heinrich – Eine zum Scheitern verurteilte Liebe
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Gottfried Kellers Roman „Der grüne Heinrich“ (erste Fassung von 1854/55) im Hinblick auf seine Gesellschaftskritik, die insbesondere durch die Darstellung der Frauenfiguren Judith und Anna vermittelt wird. Der Fokus liegt auf der Analyse der Kritik an den zeitgenössischen Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Normen. Die Arbeit beleuchtet, inwiefern Keller den Ansprüchen des Realismus gerecht wird und wie die Figuren als „gedichtete Bilder der Gegensätze“ fungieren.
- Kellers Kritik an gesellschaftlichen Konventionen und Normen
- Die Darstellung der Frauenfiguren Judith und Anna als Spiegelbild gesellschaftlicher Widersprüche
- Analyse der ambivalenten Beziehungen zwischen den Figuren und ihrem sozialen Umfeld
- Die Rolle von Moral und Verantwortung im Kontext gesellschaftlicher Erwartungen
- Kellers Realismus und dessen Darstellung in der Romanhandlung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung definiert den Realismus als künstlerische Transformation und Interpretation der Wirklichkeit, nicht als bloße Abbildung. Sie stellt Kellers „Der grüne Heinrich“ als „Bildungstragödie“ vor und begründet die Wahl der ersten Fassung von 1854/55 als Grundlage der Untersuchung, da Keller hier ungeschönter und freier schreibt. Der Fokus liegt auf der Analyse der Gesellschaftskritik durch die Darstellung Judiths und Annas.
Die Römerbeichte – Kritik an den gesellschaftlichen Verkehrsformen: Dieses Kapitel analysiert Heinrichs Brief an Römer als Akt der Eitelkeit und Rache, der zu Römers geistigem Zusammenbruch führt. Judiths Rolle als lebenskluge Ersatzmutter wird hervorgehoben. Sie konfrontiert Heinrich mit seinem Unrecht und appelliert an seine Moral, im Gegensatz zur gesellschaftlichen Bagatellisierung des Vorfalls. Judiths Kritik an Heinrichs Handeln offenbart eine scharfe Gesellschaftskritik, die das Fehlen von Verantwortungsgefühl und Moral anprangert und sie selbst von der gesellschaftlichen Norm abgrenzt.
Schlüsselwörter
Gottfried Keller, Der grüne Heinrich, Realismus, Gesellschaftskritik, Frauenfiguren, Judith, Anna, Geschlechterrollen, Moral, Verantwortung, zeitgenössische Gesellschaft, Bildungsroman, Bildungstragödie.
Häufig gestellte Fragen zu Gottfried Kellers "Der grüne Heinrich" (Erstausgabe 1854/55)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Gottfried Kellers Roman "Der grüne Heinrich" (erste Fassung von 1854/55) im Hinblick auf seine Gesellschaftskritik, die besonders durch die Darstellung der Frauenfiguren Judith und Anna deutlich wird. Der Fokus liegt auf der Kritik an den zeitgenössischen Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Normen. Untersucht wird auch, inwiefern Keller den Realismus verkörpert und wie die Figuren als „gedichtete Bilder der Gegensätze“ funktionieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Kellers Kritik an gesellschaftlichen Konventionen und Normen, die Darstellung der Frauenfiguren Judith und Anna als Spiegel gesellschaftlicher Widersprüche, die Analyse der ambivalenten Beziehungen zwischen den Figuren und ihrem sozialen Umfeld, die Rolle von Moral und Verantwortung im Kontext gesellschaftlicher Erwartungen und Kellers Realismus und dessen Darstellung in der Romanhandlung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse der "Römerbeichte" und ihrer Kritik an gesellschaftlichen Verkehrsformen, ein Kapitel zur Kritik an der zeitgenössischen Auffassung von Religiosität, ein Kapitel zur Kritik an Geschlechterrollen mit Unterkapiteln zu Anna und Judith (inkl. Analyse von Judiths Rolle als "Femme fatale", ihrer Beziehung zu ihrem sozialen Umfeld und ihrer Beziehung zu Heinrich), und ein Resümee.
Wie wird die Figur Judith dargestellt und analysiert?
Judith wird als lebenskluge Ersatzmutter dargestellt, die Heinrich mit seinem Unrecht konfrontiert und an seine Moral appelliert. Ihre Kritik an Heinrichs Handeln offenbart eine scharfe Gesellschaftskritik. Die Analyse untersucht auch, ob sie die Figur der "Femme fatale" verkörpert, ihr Verhältnis zum sozialen Umfeld und ihre Beziehung zu Heinrich – eine zum Scheitern verurteilte Liebe.
Wie wird die Figur Anna dargestellt und analysiert?
Anna wird im Kontext der Kritik an der unreflektierten Erfüllung von Bildungsnormen analysiert. Die Arbeit untersucht, wie ihre Darstellung die Gesellschaftskritik des Romans unterstützt.
Wie wird der Realismus bei Keller in der Arbeit betrachtet?
Der Realismus wird nicht als bloße Abbildung der Wirklichkeit verstanden, sondern als künstlerische Transformation und Interpretation. Die Arbeit untersucht, inwiefern Kellers "Der grüne Heinrich" diesen Aspekt des Realismus verkörpert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gottfried Keller, Der grüne Heinrich, Realismus, Gesellschaftskritik, Frauenfiguren, Judith, Anna, Geschlechterrollen, Moral, Verantwortung, zeitgenössische Gesellschaft, Bildungsroman, Bildungstragödie.
Warum wurde die Erstausgabe von 1854/55 ausgewählt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Erstausgabe von 1854/55, weil Keller in dieser Fassung ungeschönter und freier schreibt.
Was ist das Fazit der Einleitung?
Die Einleitung stellt Kellers "Der grüne Heinrich" als "Bildungstragödie" vor und begründet die Wahl der ersten Fassung von 1854/55 als Grundlage der Untersuchung. Der Fokus liegt auf der Analyse der Gesellschaftskritik durch die Darstellung Judiths und Annas.
Welche Interpretation der "Römerbeichte" wird in der Arbeit vertreten?
Die "Römerbeichte" wird als Akt der Eitelkeit und Rache Heinrichs analysiert, der zu Römers geistigem Zusammenbruch führt. Judiths Rolle als lebenskluge Ersatzmutter wird hervorgehoben, die Heinrichs Unrecht offenlegt und seine mangelnde Moral kritisiert.
- Quote paper
- Heike Esser (Author), 2005, Zu: Gottfried Keller: "Der grüne Heinrich", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74444