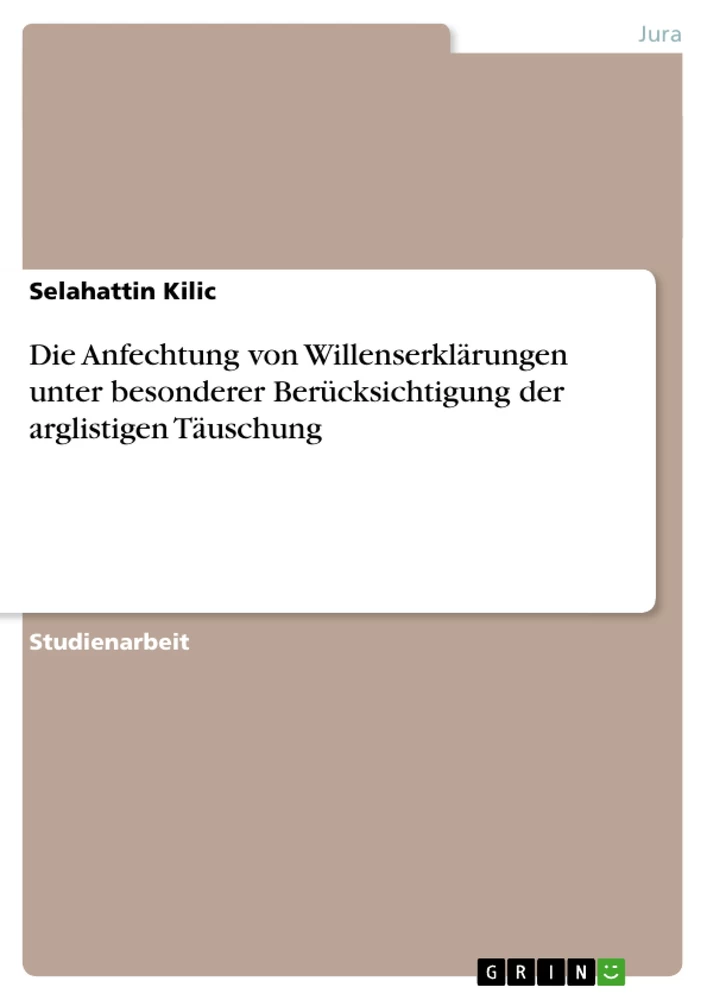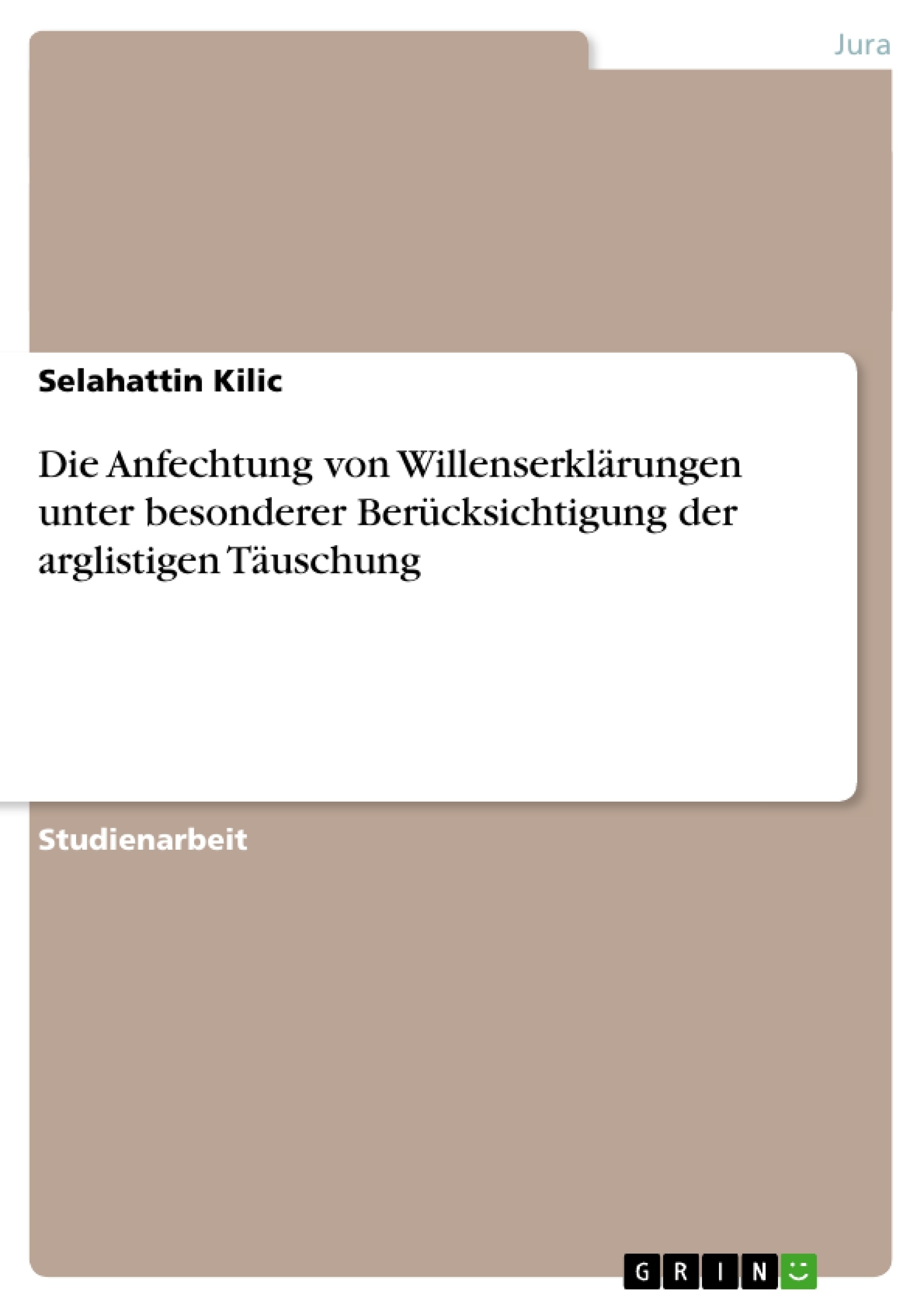Der „Werdegang“ einer Willenserklärung läuft etwa folgendermaßen ab: Aufgrund gewisser Motive gelangt jemand zu dem Willen, eine Bestimmte Rechtsfolge herbeizuführen (Geschäftswille). Um diesen zu realisieren, formuliert er ihn und setzt ihn in ein bestimmtes Erklärungszeichen um, äußert seinen Willen.
Fehler können dabei einmal bei der Willensbildung entstehen, z. B. wenn der Betreffende sich von falschen Motiven hat leiten lassen.
Zum anderen können sie bei der Äußerung des Willens entstehen, d. h. es kann zu einer Diskrepanz zwischen dem Willen und der Erklärung kommen. Das Auseinanderfallen von Wille und Erklärung kann dem Erklärenden bewusst oder unbewusst sein.
Ist eine Willenserklärung fehlerhaft entstanden, steht das Interesse des Erklärenden an der Unwirksamkeit der Willenserklärung (die Willenserklärung ist nicht durch einen entsprechenden Willen gedeckt) dem Interesse des Erklärungsempfängers, sich auf das Erklärte verlassen zu dürfen, gegenüber. Für den Erklärenden spricht das Prinzip der Privatautonomie, für den Empfänger das Prinzip des Vertrauensschutzes.
Ausgehend von den Interessen des Erklärenden ist bei einer Erklärung, die nicht von einem entsprechenden Willen gedeckt ist, die Rechtsfolge der Nichtigkeit möglich (so die früher vertretene Willenstheorie). Geht man dagegen von den Interessen des Empfängers aus, kommt man zur regelmäßigen Wirksamkeit des Erklärten (so die ebenfalls früher vertretene Erklärungstheorie). Neben der generellen Nichtigkeit oder Wirksamkeit der Willenserklärung gibt es noch die Möglichkeit der Vernichtbarkeit durch Anfechtung als Rechtsfolge eines Willensmangels.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Anfechtung (§123 Abs. 1)
- 3. Anfechtung wegen unlauterer Willensbeeinflussung (§123)
- A: Arglistige Täuschung (§123 Abs. 1)
- B: Widerrechtliche Drohung (§123 Abs. 1)
- C: Besonderheiten bei den Rechtsfolgen der Anfechtung (§ 123 Abs. 1)
- D: Konkurrierende Ansprüche/Rechtsbehelfe
- 4. Fall
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Anfechtung von Willenserklärungen im deutschen Recht, insbesondere unter Berücksichtigung der arglistigen Täuschung. Ziel ist es, die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Anfechtung nach §123 BGB zu erläutern und anhand eines Fallbeispiels zu veranschaulichen.
- Anfechtung von Willenserklärungen nach §123 BGB
- Arglistige Täuschung als Grund zur Anfechtung
- Widerrechtliche Drohung als Grund zur Anfechtung
- Rechtsfolgen der Anfechtung
- Konkurrierende Ansprüche und Rechtsbehelfe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung beschreibt den "Werdegang" einer Willenserklärung vom Geschäftswillen bis zur Äußerung. Sie beleuchtet die Problematik des Auseinanderfallens von Willen und Erklärung, sowohl bewusst als auch unbewusst. Die unterschiedlichen Interessen des Erklärenden (Privatautonomie) und des Erklärungsempfängers (Vertrauensschutz) werden gegenübergestellt, um die verschiedenen Rechtsfolgen wie Nichtigkeit und Anfechtbarkeit zu kontextualisieren. Die Einführung skizziert verschiedene Fälle von bewusstem und unbewusstem Auseinanderfallen von Wille und Erklärung und führt in die Thematik der Anfechtung als Rechtsfolge eines Willensmangels ein.
2. Anfechtung gemäß §123 Abs. 1: Dieses Kapitel behandelt die Anfechtung von Willenserklärungen gemäß §123 Absatz 1 BGB, der Fälle von Willensmängeln aufgrund arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Drohung regelt. Es betont den Schutz der rechtsgeschäftlichen Entschließungsfreiheit und den Unterschied zur Irrtumsanfechtung. Die Kapitel definiert die Begriffe Täuschung, Arglist, Drohung und Widerrechtlichkeit, um die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anfechtung nach §123 Abs. 1 BGB präzise darzulegen.
3. Anfechtung wegen unlauterer Willensbeeinflussung: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die detaillierte Analyse der Anfechtung wegen arglistiger Täuschung nach §123 Abs. 1 BGB. Er beschreibt die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anfechtung: widerrechtliche Täuschungshandlung, Irrtum, Abgabe einer Willenserklärung, Kausalität und Arglist. Der Abschnitt erläutert jede Voraussetzung im Detail und differenziert zwischen Täuschungshandlungen durch aktives Tun und Unterlassen. Die Rolle der Widerrechtlichkeit und die Bedeutung der Arglist des Täuschenden werden ausführlich besprochen, einschließlich der Einschränkung nach §123 Abs. 2.
Schlüsselwörter
Anfechtung, Willenserklärung, §123 BGB, arglistige Täuschung, widerrechtliche Drohung, Willensmangel, Rechtsfolgen, Kausalität, Irrtum, Privatautonomie, Vertrauensschutz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Anfechtung von Willenserklärungen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Anfechtung von Willenserklärungen im deutschen Recht, insbesondere im Hinblick auf arglistige Täuschung gemäß § 123 BGB. Sie erläutert die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Anfechtung und veranschaulicht diese anhand eines Fallbeispiels.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Anfechtung von Willenserklärungen nach §123 BGB, arglistige Täuschung als Anfechtungsgrund, widerrechtliche Drohung als Anfechtungsgrund, Rechtsfolgen der Anfechtung, und konkurrierende Ansprüche und Rechtsbehelfe. Die Einführung beleuchtet den "Werdegang" einer Willenserklärung und den Interessenausgleich zwischen Privatautonomie und Vertrauensschutz.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Kapitel 1 (Einführung): Beschreibt den Weg einer Willenserklärung vom Geschäftswillen zur Äußerung und den Konflikt zwischen Willen und Erklärung. Kapitel 2 (Anfechtung gemäß §123 Abs. 1): Behandelt die Anfechtung nach §123 Abs. 1 BGB bei arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Drohung. Kapitel 3 (Anfechtung wegen unlauterer Willensbeeinflussung): Analysiert detailliert die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung, inklusive der Voraussetzungen wie Täuschungshandlung, Irrtum, Kausalität und Arglist. Kapitel 4 (Fall): Ein Fallbeispiel zur Veranschaulichung der behandelten Themen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Seminararbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Anfechtung, Willenserklärung, §123 BGB, arglistige Täuschung, widerrechtliche Drohung, Willensmangel, Rechtsfolgen, Kausalität, Irrtum, Privatautonomie, Vertrauensschutz.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel der Seminararbeit ist es, die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Anfechtung von Willenserklärungen nach §123 BGB zu erklären und anhand eines Fallbeispiels zu veranschaulichen. Es geht darum, den Schutz der rechtsgeschäftlichen Entschließungsfreiheit zu verdeutlichen.
Wie werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst?
Die Kapitelzusammenfassungen liefern einen Überblick über die jeweiligen Inhalte und gehen auf die zentralen Punkte jedes Kapitels ein. Sie bieten einen schnellen Zugang zu den wichtigsten Informationen.
Welche Rechtsgrundlage wird im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt im Detail die Rechtsgrundlage des §123 BGB, der die Anfechtung von Willenserklärungen aufgrund von arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Drohung regelt.
- Quote paper
- Diplom Kaufmann Selahattin Kilic (Author), 2006, Die Anfechtung von Willenserklärungen unter besonderer Berücksichtigung der arglistigen Täuschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74522