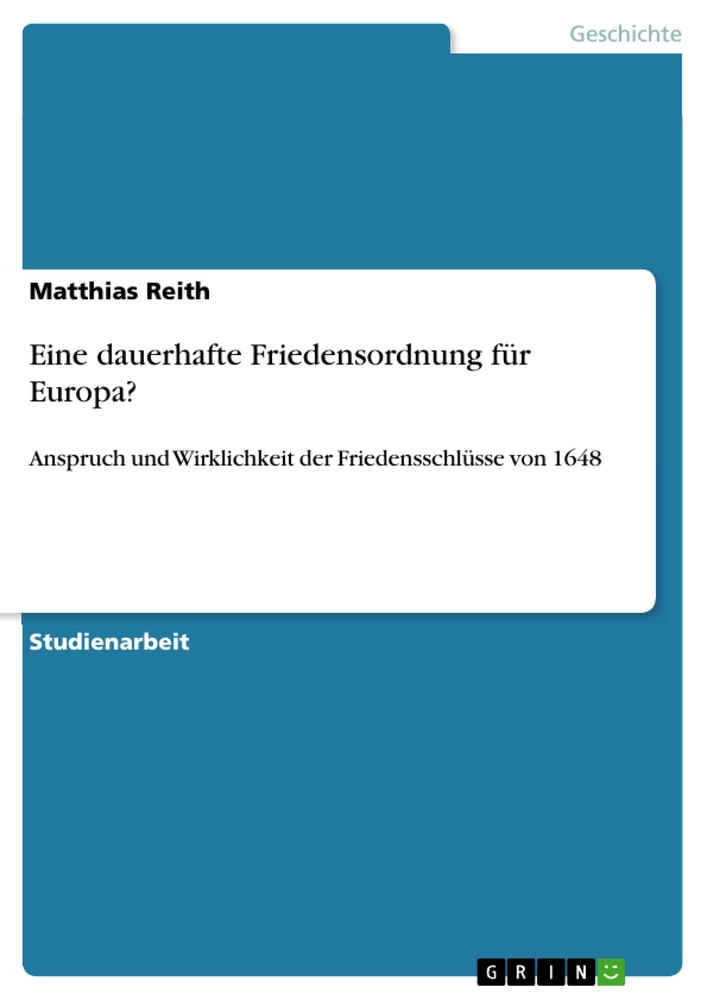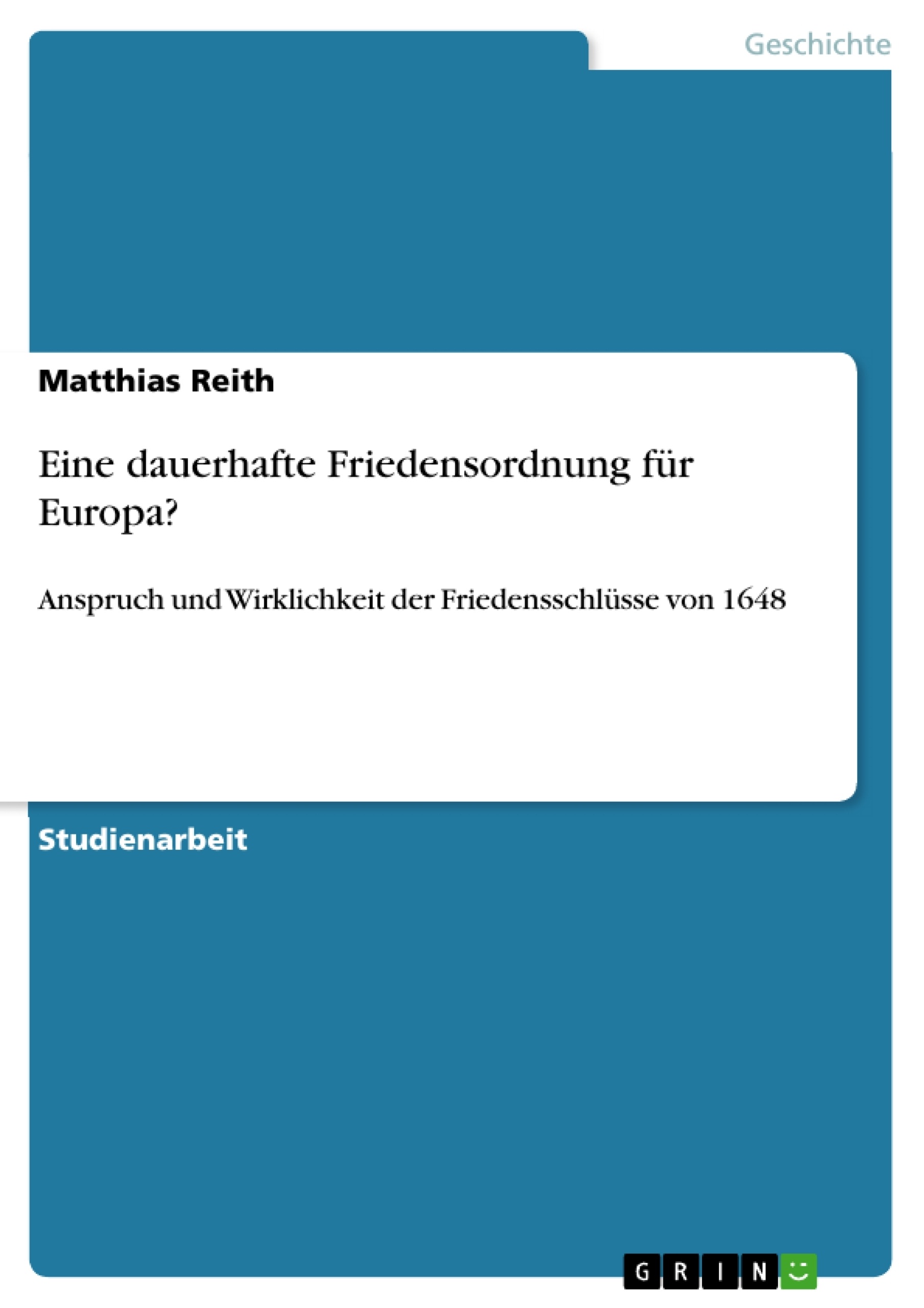Im 30-jähigen Krieg standen sich scheinbar unversöhnliche Gegensätze gegenüber, wobei jeder Standpunkt für sich die alleinige Existenz beanspruchte. Mit dem Westfälischen Frieden verfolgten die Zeitgenossen das Ziel, nicht nur einen Waffenstillstand oder eine kurze Unterbrechung der kriegerischen Handlungen zu erreichen, sondern sie verlangten Rechtsverhältnisse, die eindeutige Positionierungen erlaubten und das Zusammenleben regelten.
In der folgenden Untersuchung wird die Frage gestellt, inwieweit aus den neuen Rechtsverhältnissen eine dauerhafte Friedensordnung für Europa resultierte. Welche Folgen hatten die Verträge von Münster und Osnabrück für die rechtsstaatliche Ordnung im Reich und in Europa.
An erster Stelle einer solchen Fragestellung steht natürlich die Analyse des Vertragswerkes selbst. Bei der Erstellung eines Vertragswerkes in diesem Umfang und mit diesem Stellenwert kann davon ausgegangen werden, dass annähernd jedes Wort sorgfältig ausgewählt wurde und somit einen wichtigen Inhalt vermittelte. Daher ist eine Untersuchung erforderlich, die von der inhaltlichen Bedeutung einzelner Artikel, über die Betrachtung der einzelnen Worte, bis hin zu einem Vergleich mit vorhergehenden Vertragstexten geht.
Ein wichtiger Bestandteil der Analyse der außenpolitischen Verhältnisse in West- und Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts stellt die Betrachtung der Herrschaft Ludwigs XIV. dar. Seine außenpolitischen Ambitionen stehen im Zentrum des zweiten Teils der Untersuchung. Welche Ziele verfolgte die französische Politik und wie wurden diese umgesetzt?
Im dritten Teil folgt die Analyse ausgewählter Friedensverträge aus der Zeit nach 1648. Dabei soll ein Schwerpunkt auf die französischen und kaiserlichen Friedenstraktate gelegt werden. Die Ergebnisse dienen einer differenzierten Klärung der Frage, ob von dem Westfälischen Frieden eine langfristige Wirkung auf das folgende Jahrhundert ausging und wie diese, falls vorhanden, aussah.
Im letzten Teil dieser Arbeit wird die politische Idee des Gleichgewichts der Kräfte in der internationalen Staatenwelt im Zentrum stehen. Oftmals wurde in der Literatur der Ursprung dieses Gedankens im Westfälischen Frieden gesehen. Da diese These bereits widerlegt wurde, soll hier abschließend der eigentliche Zusammenhang zwischen dem Westfälischen Frieden und dem Gedanken der Balance of Power dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Westfälische Frieden und seine friedensstiftenden Elemente
- Die Außenpolitik Ludwigs XIV. (1638-1715)
- Ausgewählte Friedensschlüsse nach 1648.
- Pyrenäenfrieden (7. November 1659)
- Erster Aachener Frieden (2. Mai 1668)
- Frieden von Nimwegen (1678/79)
- Frieden von Rijswijk (1697)
- Friedensschlüsse von Utrecht / Rastatt / Baden (1713/14)
- Die Idee vom Gleichgewicht der Kräfte
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob der Westfälische Frieden eine dauerhafte Friedensordnung für Europa einleitete. Dabei werden die Vertragswerke von Münster und Osnabrück analysiert, die Außenpolitik Ludwigs XIV. untersucht und ausgewählte Friedensverträge des 17. und 18. Jahrhunderts betrachtet.
- Analyse des Vertragswerkes von Münster und Osnabrück
- Bedeutung der einzelnen Artikel und Worte
- Untersuchung der Außenpolitik Ludwigs XIV. und seiner Ziele
- Analyse ausgewählter Friedensverträge nach 1648
- Beurteilung des Einflusses des Westfälischen Friedens auf das folgende Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit dar und erläutert den historischen Hintergrund des 30-jährigen Krieges. Sie hebt die Bedeutung des Westfälischen Friedens für die Rechtsordnung im Reich und in Europa hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
1. Der Westfälische Frieden und seine friedensstiftenden Elemente
Dieses Kapitel analysiert die Vertragswerke von Münster und Osnabrück, die den Westfälischen Frieden markierten. Es beleuchtet die zentralen Ziele der Verträge und die darin enthaltenen Bestimmungen, die den Aufbau einer Friedensordnung im Reich und in Europa anstrebten.
2. Die Außenpolitik Ludwigs XIV. (1638-1715)
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die außenpolitischen Ambitionen Ludwigs XIV. und untersucht seine Ziele und Strategien. Es setzt die französische Außenpolitik in den Kontext der innenpolitischen Ereignisse und der außenpolitischen Machtkonstellationen.
3. Ausgewählte Friedensschlüsse nach 1648.
Dieses Kapitel analysiert ausgewählte Friedensverträge aus der Zeit nach 1648, insbesondere die französischen und kaiserlichen Traktate. Es untersucht, inwieweit diese Verträge dem Westfälischen Frieden folgten und dessen Bestimmungen bestätigten oder widerlegten.
Schlüsselwörter
Westfälischer Frieden, Friedensordnung, Europa, Ludwig XIV., Friedensverträge, Gleichgewicht der Kräfte, Vertragswerke, Münster, Osnabrück, Außenpolitik, Rechtsordnung, Krieg, Religion, Konfession, Kaiser, Reich.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Westfälischen Friedens?
Das Ziel war nicht nur ein Waffenstillstand, sondern die Schaffung dauerhafter Rechtsverhältnisse, die das Zusammenleben in Europa nach dem 30-jährigen Krieg regelten.
Wie beeinflusste Ludwig XIV. die europäische Friedensordnung?
Seine ehrgeizige Außenpolitik und Machtansprüche forderten das Gleichgewicht heraus und führten zu zahlreichen weiteren Friedensverträgen wie dem von Nimwegen oder Rijswijk.
Was bedeutet „Gleichgewicht der Kräfte“ (Balance of Power)?
Es ist die politische Idee, dass kein einzelner Staat in Europa so mächtig werden darf, dass er alle anderen dominieren kann. Der Westfälische Friede legte hierfür wichtige Grundlagen.
Warum sind die Verträge von Münster und Osnabrück so bedeutend?
Sie markieren den Beginn des modernen Völkerrechts und schufen eine neue rechtsstaatliche Ordnung für das Heilige Römische Reich und ganz Europa.
Hatte der Westfälische Friede eine langfristige Wirkung?
Ja, die Arbeit untersucht, inwieweit die dort getroffenen Bestimmungen bis ins 18. Jahrhundert hinein als Referenzpunkt für internationale Friedensschlüsse dienten.
- Quote paper
- Matthias Reith (Author), 2007, Eine dauerhafte Friedensordnung für Europa?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74526