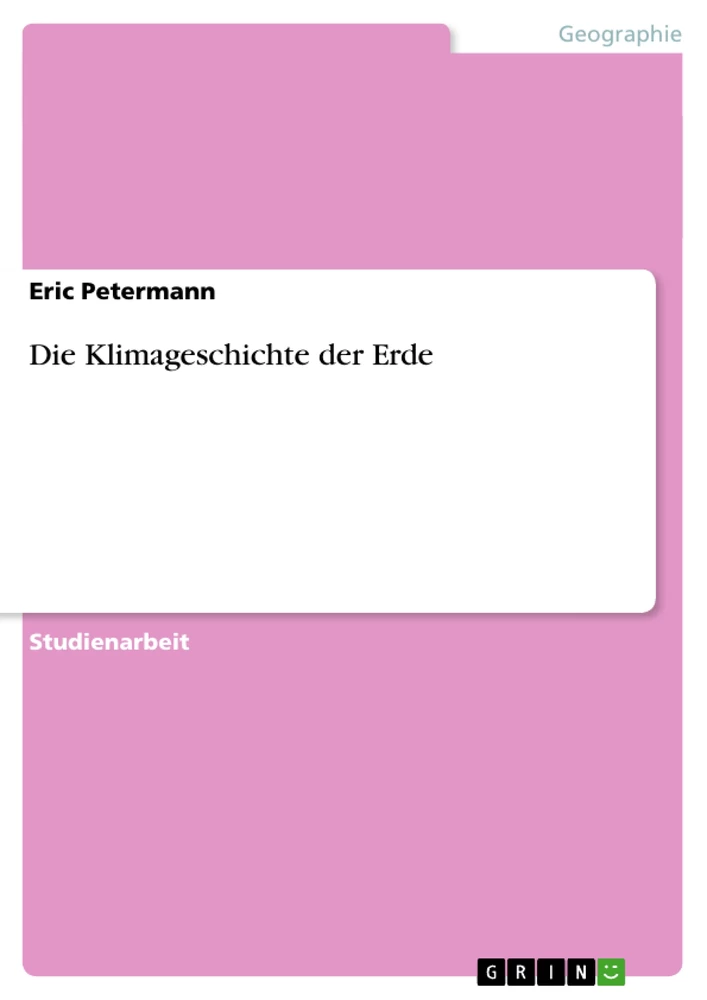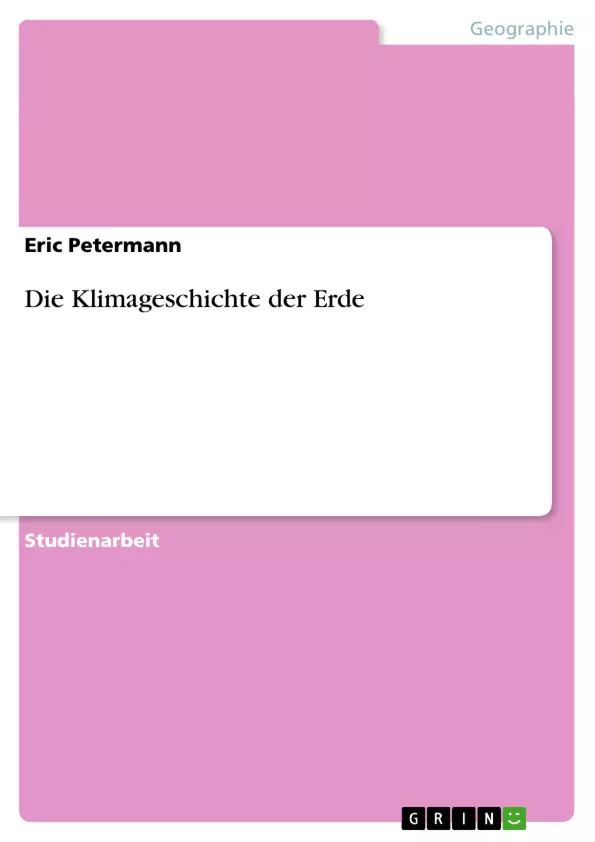Das Thema Klimawandel genießt spätestens seit dem diesjährigen UN-Klimabericht in den Medien Omnipräsenz. Leser und Zuschauer werden mit Fragen nur so überhäuft. Wodurch kann man den Klimawandel aufhalten? Welche ökologischen und ökonomischen Folgen hat eine globale Erwärmung? Was passiert, wenn die Polkappen schmelzen? Kommt gar der Golfstrom ins Stocken und die Menschheit steht am Rande einer neuen Eiszeit?
Fragen, die nur mit Hilfe der Paläoklimaforschung beantwortet werden können. Eine genaue Kenntnis der klimatischen Entwicklung auf der Erde ist Voraussetzung um aktuelle und zukünftige Klimaänderungen richtig beurteilen zu können. Dabei lautet das Motto: aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen.
Die heutige weltweite Durchschnittstemperatur liegt bei etwa 15°C. Diese unterliegt jedoch Schwankungen, die von 11°C Durchschnittstemperatur in den Glazialen (Kalt- bzw. Eiszeiten) bis zu 24°C in den großen Warmzeiten (z.B. älteres Tertiär) reichen können (JUNGE & EISSMANN 2003: 346). Es muss geklärt werden, welches die determinierenden Faktoren sind, die diese Veränderungen verursachen. Eine detaillierte Kenntnis der Funktionsweise des Klimasystems ist elementar um Ursachen und Folgen von Klimaveränderungen verstehen zu können. Welche Vorgänge im System Erde, verändern auf welche Art und Weise die globale und regionale Verteilung von Temperatur und Niederschlägen. In welchem Maße haben etwa plattentektonische Prozesse Einfluss auf das Klimasystem? Was sind natürliche Steuermechanismen für den Anteil von Treibhausgasen wie Kohlendioxid oder Methan in der Atmosphäre? Wodurch werden Eiszeiten hervorgerufen?
Ziel dieser Arbeit ist es, diese und andere Fragen näher zu beleuchten um das Klima, als Ergebnis vielfältiger innersystemarer Wechselwirkungen, besser zu verstehen. Dabei soll zunächst ein Überblick über Faktoren gegeben werden, die das Klima auf verschiedenen Zeitskalen entscheidend bestimmen. Anschließend soll die Klimage-schichte vom Archaikum bis ins Holozän beschrieben werden. Aufgrund des immensen thematischen Umfangs und des begrenzten Rahmens, kann diese Arbeit viele Aspekte nur streifen sowie einige Klimahypothesen exemplarisch aufgreifen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klimabeeinflussende Faktoren auf verschiedenen Zeitskalen
- Faktoren mit langfristigen Auswirkungen
- Faktoren mit mittelfristigen Auswirkungen
- Faktoren mit kurzfristigen Auswirkungen
- Das Klima im Präkambrium
- Archaikum
- Proterozoikum
- Das paläozoische Klima
- Kambrium und Ordovizium
- Silur und Devon
- Karbon und Perm
- Das warme Klima des Mesozoikums
- Das Klima Pangäas
- Treibhausklima während der Kreide
- Der Meteoritenimpakt an der Kreide/ Tertiär-Grenze und die klimatischen Folgen
- Tertiär – der Weg in ein neues Eiszeitalter
- Belege für die Abkühlung
- Ursachen für die Abkühlung
- Das quartäre Eiszeitalter - Wechsel von Glazialen und Interglazialen
- Steuermechanismen des quartären Klimas
- Das Klima seit dem Abschmelzen der Inlandeismassen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Klimageschichte der Erde und beleuchtet die verschiedenen Faktoren, die das Klima im Laufe der Erdgeschichte beeinflusst haben. Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen der Erdatmosphäre, den Ozeanen und der Biosphäre im Hinblick auf die Klimageschichte zu entwickeln.
- Langfristige und kurzfristige Klimaänderungen
- Einfluss von tektonischen Plattenbewegungen und Vulkanausbrüchen
- Die Rolle des Treibhauseffekts in der Erdgeschichte
- Das Wechselspiel von Glazialen und Interglazialen im Quartär
- Die Bedeutung des Menschen für die gegenwärtige Klimaentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Klimageschichte ein und stellt die Bedeutung der Erforschung vergangener Klimaverhältnisse für das Verständnis des heutigen Klimas heraus. Das zweite Kapitel analysiert die verschiedenen Faktoren, die das Klima auf unterschiedlichen Zeitskalen beeinflussen. Dabei werden sowohl langfristige Prozesse wie die Plattentektonik und die Sonneneinstrahlung als auch kurzfristige Faktoren wie Vulkanausbrüche und die menschliche Aktivität berücksichtigt.
Die Kapitel 3 und 4 befassen sich mit dem Klima im Präkambrium und im Paläozoikum. Es werden die wichtigsten Klimaereignisse dieser Epochen dargestellt, wie die Entstehung des ersten Lebens auf der Erde im Archaikum und die Eiszeiten im Proterozoikum. Das fünfte Kapitel behandelt das Mesozoikum, eine Periode mit warmen Temperaturen und einem hohen CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Der Meteoritenimpakt an der Kreide/Tertiär-Grenze und seine Auswirkungen auf das Klima werden ebenfalls beleuchtet.
Die Kapitel 6 und 7 widmen sich dem Tertiär und dem Quartär. Die Abkühlung der Erde und die Entstehung der Eiszeiten im Quartär werden ausführlich untersucht. Dabei werden die verschiedenen Steuermechanismen des quartären Klimas, wie beispielsweise die Milankovitch-Zyklen, und die Folgen der Eiszeiten für die Umwelt und das Leben auf der Erde beleuchtet.
Schlüsselwörter
Klimageschichte, Erdgeschichte, Klimafaktoren, Plattentektonik, Vulkanausbrüche, Treibhauseffekt, Glaziale, Interglaziale, Milankovitch-Zyklen, Biosphäre, Atmosphäre, Ozeane, Paläoklimaforschung, Klimarekonstruktion.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Paläoklimaforschung wichtig für die Zukunft?
Durch das Studium vergangener Klimaänderungen können Forscher die Mechanismen des Klimasystems besser verstehen und genauere Prognosen für zukünftige Entwicklungen erstellen.
Welche Faktoren beeinflussen das Erdklima langfristig?
Zu den langfristigen Faktoren zählen die Plattentektonik, die Verschiebung der Kontinente, Änderungen der Sonneneinstrahlung und vulkanische Aktivitäten.
Was war das Besondere am Klima im Mesozoikum?
Das Mesozoikum war geprägt von einem extrem warmen Treibhausklima mit hohen CO2-Konzentrationen, das erst durch Ereignisse wie den Meteoritenimpakt an der Kreide-Tertiär-Grenze beendet wurde.
Was sind die Milankovitch-Zyklen?
Dies sind zyklische Veränderungen der Erdbahnparameter, die die Verteilung der Sonneneinstrahlung auf der Erde beeinflussen und als Hauptsteuermechanismen für das quartäre Eiszeitalter gelten.
Wie hoch war die Durchschnittstemperatur in vergangenen Warmzeiten?
Während die heutige Durchschnittstemperatur bei etwa 15°C liegt, erreichte sie in großen Warmzeiten wie dem älteren Tertiär bis zu 24°C.
- Quote paper
- Eric Petermann (Author), 2007, Die Klimageschichte der Erde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74783