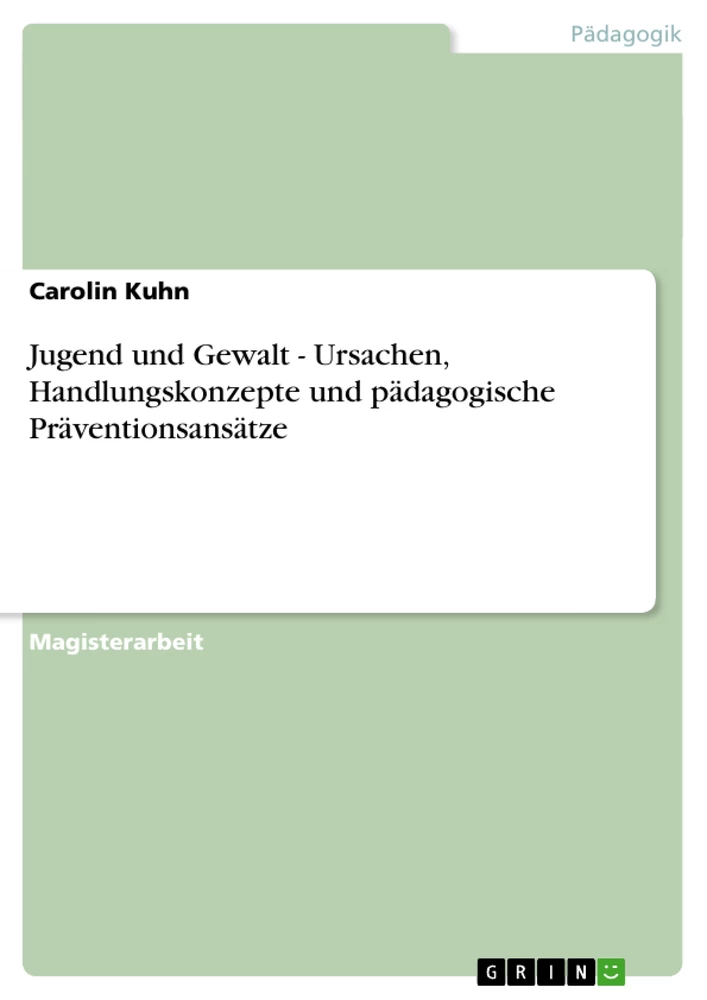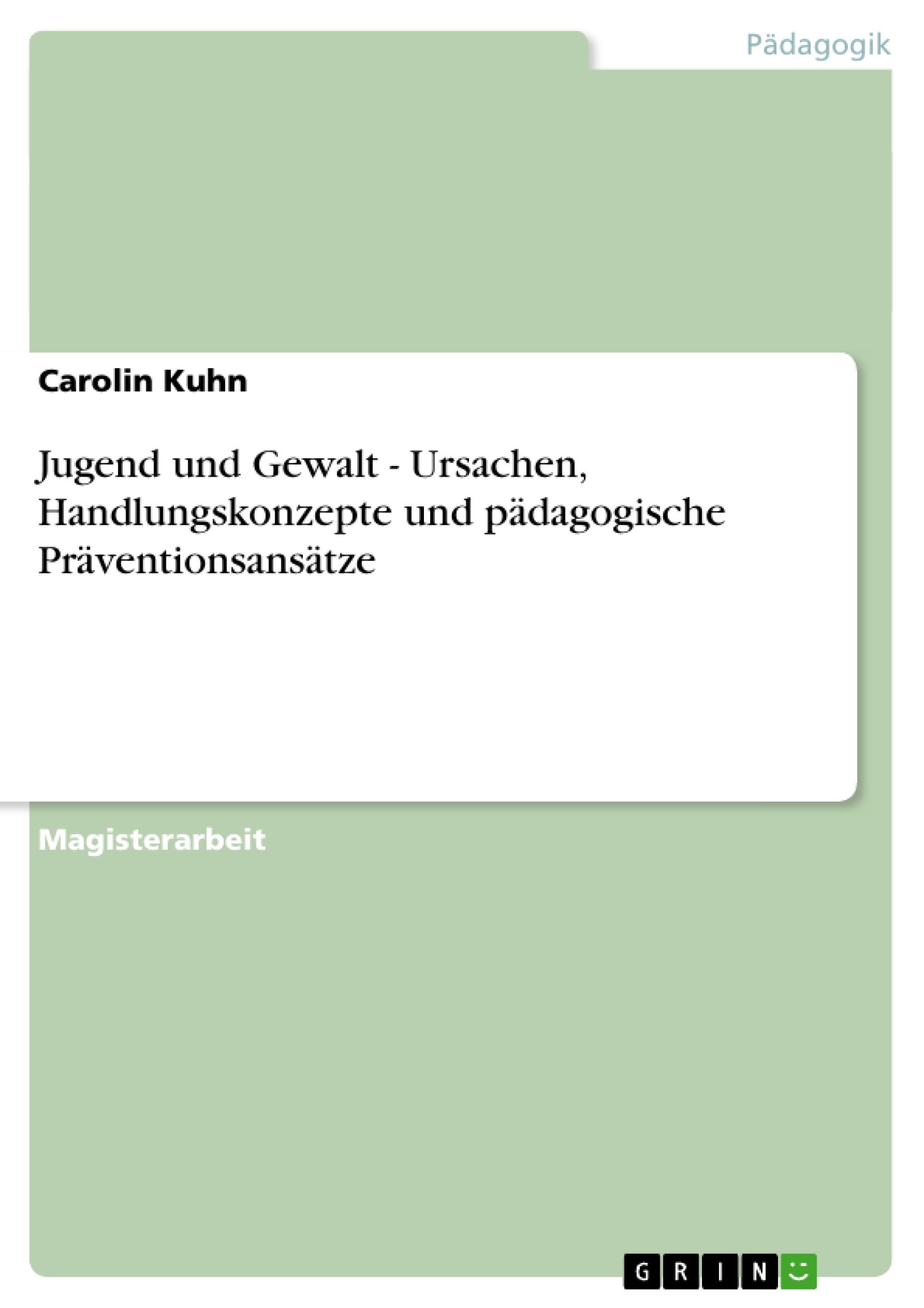Ein 15-jähriger Gymnasiast ersticht 1999 seine Lehrerin mit mehreren Messerstichen. Ein 16-jähriger Realschüler erschießt 2000 den Schulleiter seiner Schule, schießt sich danach selbst in den Kopf und liegt seitdem im Koma. 2002 tötet der Gymnasiast Robert Steinhäuser in Erfurt 16 Menschen, darunter ein Polizist, Schüler1 und Schulpersonal. Danach richtet er sich selbst.
Aufgrund dieser erschreckenden Taten wird vielerorts davon gesprochen, wir hätten in Deutschland bereits amerikanische Verhältnisse was die Jugendgewalt betrifft. Trotzdem spricht der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder 2002 nach dem Amoklauf von Erfurt von einem schrecklichen, aber singulären Verbrechen.
Im November dieses Jahres gibt die Bundesregierung den Sicherheitsbericht 2006 heraus, in dem festgestellt wird, Deutschland ist eines der sichersten Länder, die Jugendgewalt nicht steigend und seit den 1990er Jahren ist ein zunehmendes Sicherheitsgefühl der deutschen Bürger zu beobachten.
Kurz nach Erscheinen dieses Berichtes, begeht Sebastian B. einen Amoklauf in Emsdetten, bei dem er mehrere Leute verletzt und schließlich sich selbst umbringt.
Immer, wenn die Gesellschaft durch derlei Verbrechen aufgerüttelt wird, folgen stets Debatten, um das Phänomen Jugendgewalt.
So zahlreich diese Debatten über Jugend und Gewalt sind, so zahlreich sind auch die Auffassungen darüber, was Gewalt und Aggression ist. Um klar zu machen, auf welche Definition sich in dieser Arbeit bezogen wird, wird zunächst eine Eruierung der beiden Begriffe vorgenommen.
Mit Hilfe von Thesen befasst sich die vorliegende Arbeit dann mit den Fragen, ob eher Jungen oder Mädchen gewaltbereit sind, ob es einen Unterschied zwischen der Gewaltbereitschaft von deutschen und nichtdeutschen Jugendlichen gibt und ob man von einem Anstieg der Jugendgewalt sprechen kann.
In den folgenden Thesen werden die Gründe herausgearbeitet, die Kinder und Jugendliche dazu veranlassen können, Gewalt anzuwenden.
Hurrelmann spricht sich in einem Zeitungsbericht dafür aus, dass jede Schule zwei bis drei spezialisierte Beratungslehrer haben sollte, damit schon eingegriffen werden kann, bevor es zu solch schrecklichen Vorfällen wie in Erfurt oder Emsdetten kommen kann. Daher befasst sich der abschließende Abschnitt der Arbeit mit Handlungskonzepten und Präventionsprogrammen, die in Elternhaus und Schule angewendet werden können, um Jugendgewalt entgegen zu wirken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gewalt und Aggression – Eruierung der Wortbedeutungen.….………………….
- 3. Drei Thesen über die Ausprägung von Jugendgewalt......
- 3.1 These 1: „Jungen sind häufiger Täter als Mädchen”
- 3.2 These 2: Deutsche Jugendliche sind häufiger Täter als nichtdeutsche Jugendliche
- 3.3 These 3: In den letzten Jahren hat es eine Zunahme von Jugendkriminalität gegeben........
- 4. Vier Thesen zur Ursachenforschung.....
- 4.1 These 4: Jugendliche haben keine Zukunftsperspektive.........
- 4.2 These 5: Jugendliche „Gewalttäter waren [/sind] überdurchschnittlich oft Gewaltopfer”.
- 4.3 These 6: Medienkonsum fördert Gewalt...
- 4.4 These 7: Gewalttätigkeit ist angeboren...
- 4.5 Resultierende Erkenntnisse aus den sieben Thesen........
- 5. Gewaltprävention.......
- 5.1 Pädagogische Präventionsansätze und Handlungskonzepte ......
- 5.1.1 Das Präventionsprogramm Faustlos
- 5.1.2 Das Präventionsprogramm Konfliktlotsen..
- 5.1.3 Das Handlungskonzept Triple P
- 5.1.4 Das Aggressions-Bewältigungs-Programm (ABPro).
- 5.1.4.1 Vier Grundregeln beim Umgang mit aggressivem Verhalten
- 5.1.4.2 Der Umgang mit Aggressionen des Typs A..
- 5.1.4.3 Der Umgang mit Aggressionen des Typs B..
- 5.1.4.4 Der Umgang mit Aggressionen des Typs C....
- 5.1.4.5 Evaluation des Aggressions-Bewältigungs-Programmes
- 5.1 Pädagogische Präventionsansätze und Handlungskonzepte ......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit dem komplexen Phänomen der Jugendgewalt und analysiert die Ursachen, Handlungskonzepte und pädagogischen Präventionsansätze. Ziel ist es, einen tieferen Einblick in die Ursachen von Jugendgewalt zu gewinnen und die Wirksamkeit verschiedener Präventionsmaßnahmen zu beleuchten. Dabei werden verschiedene Thesen zu Ursachen und Ausprägungen von Jugendgewalt diskutiert, die sich auf Faktoren wie Geschlechterunterschiede, Migrationshintergrund, Medienkonsum und soziokulturelle Einflüsse beziehen.
- Ursachen von Jugendgewalt
- Ausprägungen von Jugendgewalt
- Präventionsansätze gegen Jugendgewalt
- Wirksamkeit pädagogischer Maßnahmen
- Rolle von Medien und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Debatte um Jugendgewalt am Beispiel von tragischen Amokläufen. Es wird deutlich, dass die gesellschaftliche Wahrnehmung von Jugendgewalt ambivalent ist und die Ursachenforschung große Bedeutung zukommt. Im zweiten Kapitel wird die Bedeutung der Begriffe Gewalt und Aggression erörtert, um ein gemeinsames Verständnis für die Arbeit zu schaffen. Das dritte Kapitel widmet sich drei Thesen, die die Ausprägung von Jugendgewalt aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Dabei werden Fragen nach Geschlechterunterschieden, Migrationshintergrund und dem Anstieg von Jugendkriminalität untersucht. Das vierte Kapitel erforscht die Ursachen von Jugendgewalt und befasst sich mit Thesen, die auf fehlende Zukunftsperspektiven, Traumatisierungen und den Einfluss von Medienkonsum hinweisen.
Kapitel fünf befasst sich mit den Möglichkeiten der Gewaltprävention und stellt verschiedene pädagogische Ansätze und Handlungskonzepte vor. Dabei werden Programme wie Faustlos, Konfliktlotsen und Triple P sowie das Aggressions-Bewältigungs-Programm (ABPro) näher betrachtet.
Schlüsselwörter
Jugendgewalt, Aggression, Prävention, Pädagogik, Handlungskonzepte, Ursachenforschung, Sozialisation, Medienkonsum, Konfliktlösung, Gewaltpräventionsprogramme, Faustlos, Konfliktlotsen, Triple P, Aggressions-Bewältigungs-Programm, ABPro.
Häufig gestellte Fragen
Sind Jungen gewaltbereiter als Mädchen?
Statistiken und Thesen zeigen, dass Jungen häufiger als Täter physischer Gewalt in Erscheinung treten, während bei Mädchen andere Formen der Aggression überwiegen können.
Welchen Einfluss hat Medienkonsum auf Jugendgewalt?
Es wird diskutiert, dass intensiver Konsum gewalthaltiger Medien die Hemmschwelle senken kann, wobei dies oft im Zusammenspiel mit anderen sozialen Faktoren steht.
Was ist das Präventionsprogramm „Faustlos“?
„Faustlos“ ist ein pädagogisches Programm für Schulen und Kindergärten zur Förderung von Empathie, Impulskontrolle und dem konstruktiven Umgang mit Ärger und Wut.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Opfern und Tätern?
Eine zentrale These besagt, dass jugendliche Gewalttäter überdurchschnittlich oft in ihrer eigenen Kindheit oder Jugend selbst Opfer von Gewalt waren.
Was ist das „Triple P“-Programm?
Triple P steht für „Positive Parenting Program“ und ist ein Handlungskonzept für Eltern, um die Erziehungskompetenz zu stärken und Verhaltensproblemen vorzubeugen.
Helfen Konfliktlotsen in Schulen?
Ja, das Konzept der Konfliktlotsen setzt auf Peer-Mediation, bei der Schüler lernen, Streitigkeiten unter Gleichaltrigen ohne Einmischen von Lehrern friedlich zu lösen.
- Citar trabajo
- Magister Carolin Kuhn (Autor), 2006, Jugend und Gewalt - Ursachen, Handlungskonzepte und pädagogische Präventionsansätze, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74802