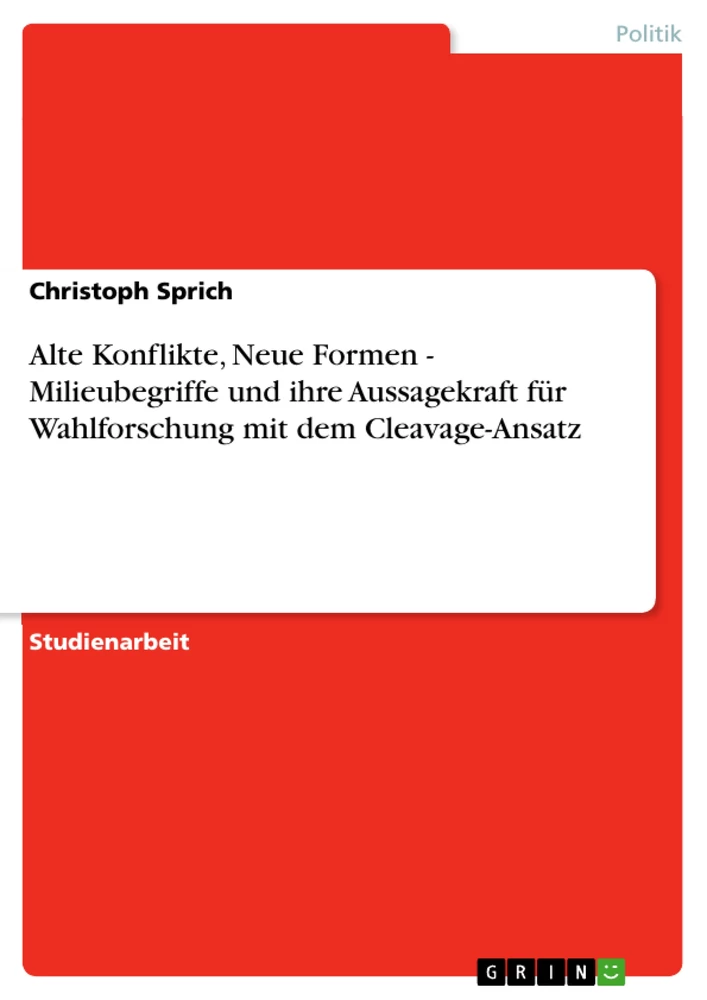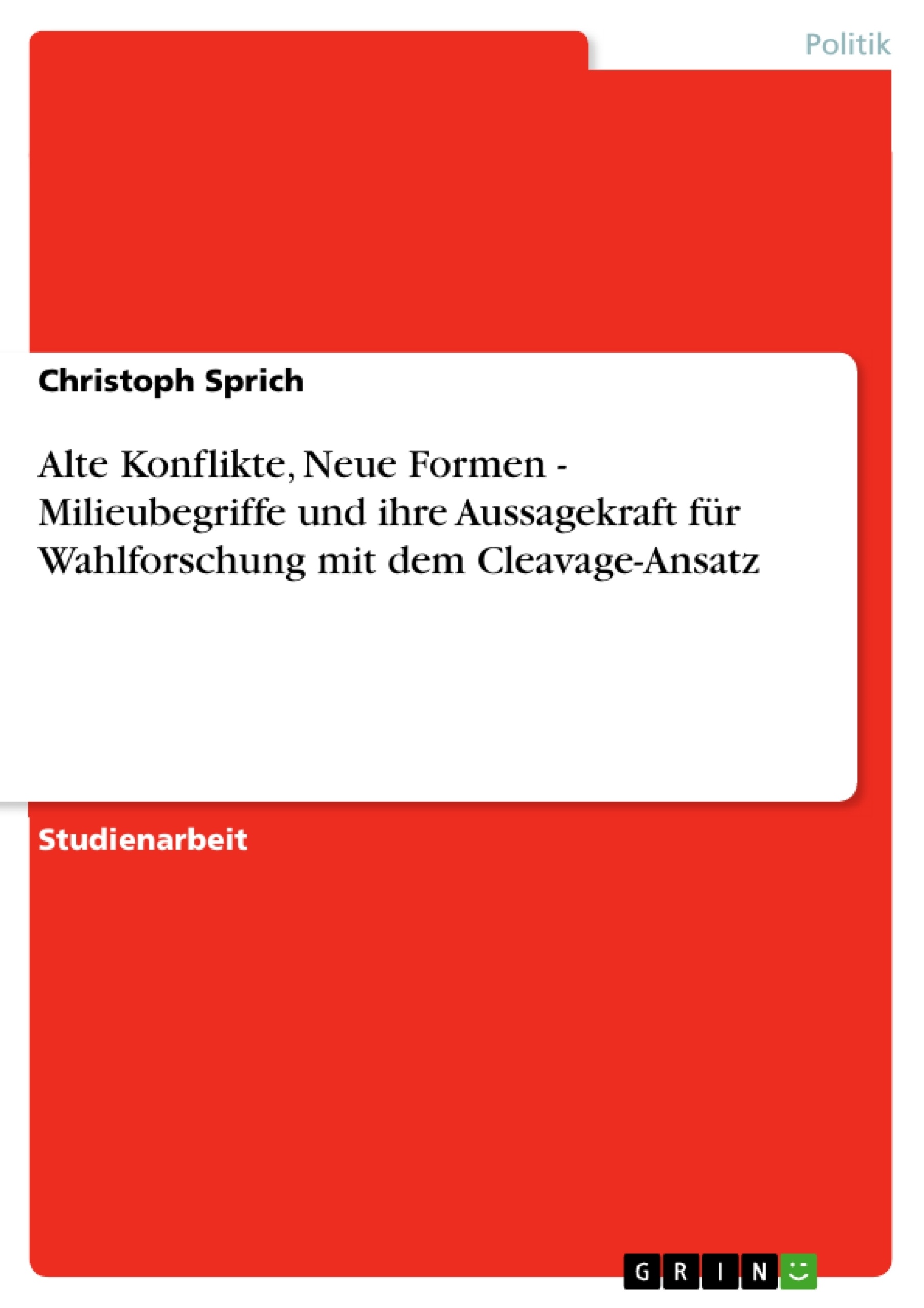Der Milieubegriff erlebte in der soziologischen Sozialstrukturforschung der 1980er Jahre ein Comeback unter dem Leitmodell der Lebensstilforschung als übergreifendes Konzept. Diesen neuen soziologischen Milieus werden zumindest teilweise ebenfalls klar zuzuordnende politische Orientierungen zugeschrieben. Zur Klärung der Frage, ob, und wenn inwiefern bestimmte neue Milieukonstruktionen in Deutschland Trägergruppen von politischen Orientierungen oder gar gesellschaftlichen Konfliktlinien darstellen könnten, wird im Folgenden zunächst der Cleavage-Ansatz und insbesondere sein Gruppenverständnis nochmals umrissen und um den darauf aufbauenden Milieu-Begriff nach Lepsius ergänzt. Im Folgenden sollen die Milieubegriffe von Michael Vester, Stefan Hradil, und dem Sinus Institut dargestellt werden und in einem abschließenden Schritt auf ihre Aussagekraft im Sinne einer politisierten Sozialstruktur bezogen werden. Berücksichtigung sollen dabei insbesondere die Bedingungen, die ein Konflikt erfüllen muss, um als Cleavage gelten zu können, sowie die Bedingungen, die demzufolge ein Milieu erfüllen muss, um als Ausdruck und Basis eines Cleavage gelten zu können. Leitthese soll dabei sein, dass nur ein theoretischer Milieubegriff, der die kulturelle und politische Homogenität als Grundbedingung zur Konstitution eines Milieus mit der Bedingung der Identität des Milieus als Gruppe in der Selbst- und Fremdwahrnehmung kombiniert, als Trägergruppe für ein Cleavage in Frage kommt.
Inhaltsverzeichnis
- Der Cleavage-Ansatz nach Lipset/Rokkan
- Das Konzept
- Sozialmoralische Milieus nach M. Rainer Lepsius
- Der reine Lebensstil-/Lebensweltansatz
- Der Millieu-Begriff nach Stefan Hradil
- Die SINUS-Milieus als politische Zielgruppen
- Gesellschaftlich-politische Milieus und Lager nach Michael Vester et. al.
- Eignung der Milieubegriffe zur Konstitution von Cleavage-Trägergruppen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern der Cleavage-Ansatz von Lipset und Rokkan, der auf die Analyse historischer Konfliktlinien und deren Einfluss auf das Wahlverhalten abzielt, für die Erklärung des aktuellen Wahlverhaltens in Deutschland noch relevant ist. Die Arbeit untersucht, ob die traditionellen Cleavages wie Religion, Klasse und Region, angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen und der Erosion homogener sozialer Milieus, noch eine Aussagekraft besitzen.
- Entwicklung des Cleavage-Ansatzes und dessen Kritik
- Relevanz von Milieubegriffen für die Analyse von Wahlverhalten
- Analyse verschiedener Milieukonzepte (Lepsius, Hradil, Sinus)
- Bedeutung von Milieubegriffen für die Konstitution von Cleavage-Trägergruppen
- Die Rolle von kultureller und politischer Homogenität für die Formation von Milieus
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Das erste Kapitel stellt den Cleavage-Ansatz von Lipset und Rokkan vor und erklärt dessen Kernargument, dass historische Konfliktlinien (Cleavages) das aktuelle Wahlverhalten beeinflussen. Es wird auf die vier zentralen Cleavages (Zentrum-Peripherie, Kirche-Staat, Stadt-Land, Kapital-Arbeit) eingegangen.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel diskutiert die Entwicklung des Milieubegriffs in der soziologischen Sozialstrukturforschung und stellt das Konzept von M. Rainer Lepsius vor, der den Begriff des sozialmoralischen Milieus zur Erklärung der politischen Spaltungslinien in der Weimarer Republik verwendet.
- Kapitel 3: Hier werden verschiedene Milieukonzepte vorgestellt, darunter die SINUS-Milieus und die gesellschaftlich-politischen Milieus nach Michael Vester. Es wird auf die Relevanz dieser Konzepte für die Analyse von politischen Zielgruppen eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie Cleavage-Ansatz, Wahlverhalten, Sozialstruktur, Milieubegriff, sozialmoralische Milieus, Lebensstilforschung, politische Orientierungen, gesellschaftliche Konfliktlinien, kulturelle Homogenität, Selbst- und Fremdwahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt der Cleavage-Ansatz nach Lipset und Rokkan?
Der Ansatz besagt, dass historische Konfliktlinien (Cleavages) wie Religion, Klasse oder Stadt-Land-Gegensätze das Wahlverhalten einer Gesellschaft langfristig prägen.
Was sind SINUS-Milieus in der Wahlforschung?
SINUS-Milieus gruppieren Menschen nach ihrer sozialen Lage und ihren Grundorientierungen (Lebensstile, Werte), um politische Zielgruppen besser analysieren zu können.
Welche Bedeutung hat der Milieubegriff von Michael Vester?
Vester untersucht gesellschaftlich-politische Milieus und Lager, um herauszufinden, wie soziale Strukturen und politische Orientierungen in Deutschland heute zusammenhängen.
Warum ist kulturelle Homogenität für die Bildung eines Milieus wichtig?
Nur wenn eine Gruppe eine hohe kulturelle und politische Homogenität sowie eine klare Identität in der Selbst- und Fremdwahrnehmung aufweist, kann sie als stabile Basis für politische Konfliktlinien dienen.
Sind traditionelle Cleavages heute noch aussagekräftig?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Faktoren wie Religion oder Klasse angesichts der Erosion homogener Milieus noch zur Erklärung des aktuellen Wahlverhaltens ausreichen.
- Quote paper
- Christoph Sprich (Author), 2007, Alte Konflikte, Neue Formen - Milieubegriffe und ihre Aussagekraft für Wahlforschung mit dem Cleavage-Ansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74833