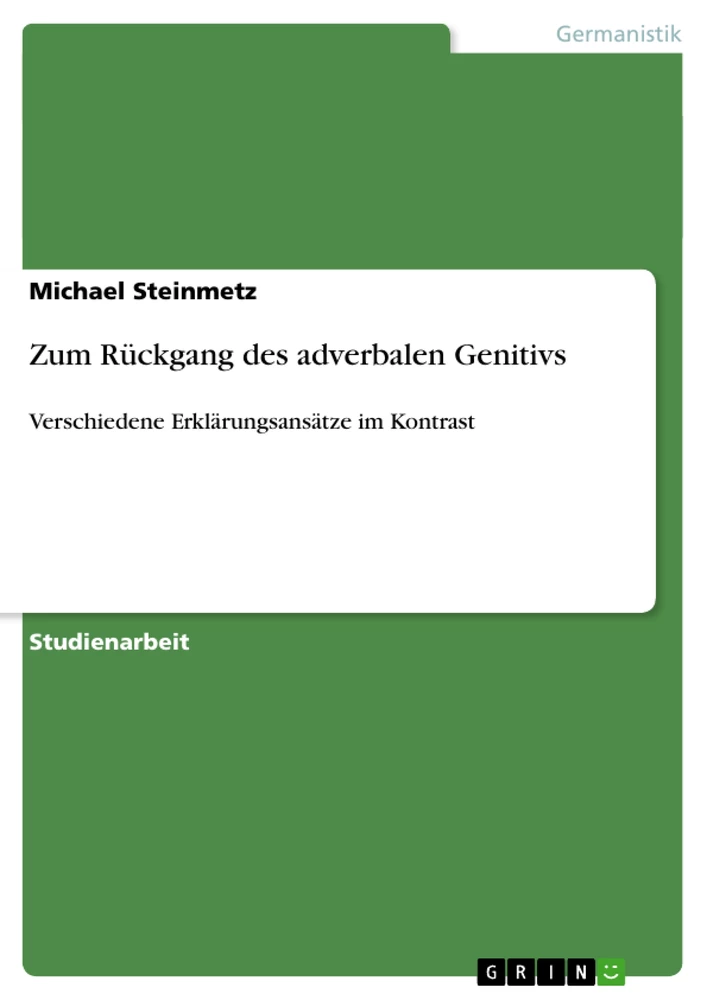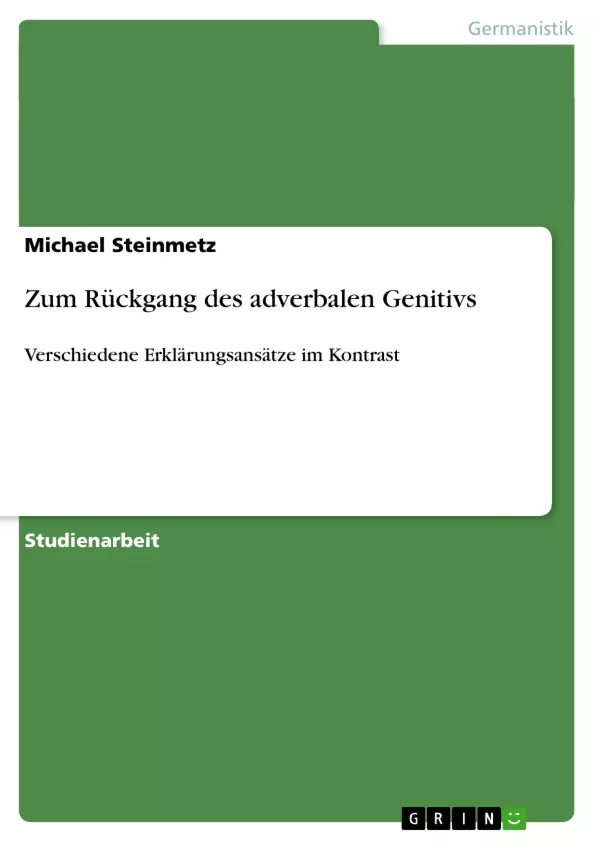Der Genitiv ist dem Dativ sein Tod versichert der Titel eines nahezu emphatisch rezipierten populärwissenschaftlichen Buches nunmehr in der 24. Auflage (Sick 2006). Nun ist es kein Geheimnis mehr. Der Gebrauch des Kasus Genitiv schwindet. Doch muss das Urteil derart vernichtend ausfallen, muss dem – umgangssprachlich als Wesfall betitelten – Genitiv tatsächlich der Tod prognostiziert werden?
Tatsächlich mutet der Genitiv – jedenfalls im mündlichen Sprachgebrauch – meist recht befremdlich an. Nicht selten lässt er sich stilistisch der Bildungssprache oder zumindest dem gehobenen Sprachgebrauch zuordnen.
Zuerst sollen auf synchroner Basis das Vorkommen und die Verwendung des adverbalen Genitivs in der gegenwärtigen schriftlich fixierten und mündlich gesprochenen Sprache und dessen alternative Ausdrucksmöglichkeiten ansatzweise skizziert werden. Anschließend sollen sowohl diachron als auch synchron orientierte Erklärungsmodelle für einen etwaigen Schwund des Genitivobjekts vergleichend thematisiert werden. Die der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegende Fragestellung lautet demzufolge: ‚Ist es legitim einen Schwund des Genitivobjekts zu konstatieren und – sofern die Antwort affirmativ ausfällt – wie kann dieser Schwund begründet werden?’
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ein Wort zum Beginn ...
- 2. Vorkommen und alternative Ausdrucksmöglichkeiten genitivregierender Verben
- 3. Erklärungen für den Schwund
- 3.1. Diachrone Erklärungsansätze
- 3.1.1. Erklärungsansatz durch Prozessanalyse der verbalen Geschehensweise
- 3.1.2. Schwund durch Verlust der genitivspezifischen Funktion der Indefinitheitsmarkierung nach Leiss
- 3.1.3. Schwund durch syntaktische Varianz und semantische Konstanz nach Schrodt
- 3.1.4. Die Verträglichkeit von Schrodts und Leiss' Hypothesen
- 3.2. Ein synchroner Erklärungsversuch
- 3.1. Diachrone Erklärungsansätze
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Rückgang des adverbalen Genitivs im Deutschen. Ziel ist es, verschiedene Erklärungsansätze, sowohl diachron als auch synchron, zu kontrastieren und zu bewerten. Die Arbeit hinterfragt die These eines vollständigen Verschwindens des Genitivs und analysiert alternative Ausdrucksmöglichkeiten.
- Vorkommen und Verwendung des adverbalen Genitivs in schriftlicher und mündlicher Sprache
- Diachrone Erklärungsansätze für den Rückgang des Genitivs
- Synchrone Erklärungsansätze für den Rückgang des Genitivs
- Alternative Ausdrucksmöglichkeiten zum adverbalen Genitiv
- Bewertung der verschiedenen Erklärungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ein Wort zum Beginn: Der einleitende Abschnitt konstatiert den Rückgang des Genitivs im Deutschen, insbesondere im mündlichen Sprachgebrauch, und führt anhand von Beispielen aus Goethes Faust und Nietzsches Werken verschiedene Arten des Genitivs (struktureller, semantischer, inhärenter/adverbaler Genitiv) an. Der Fokus der Arbeit wird auf den adverbalen Genitiv gelegt, dessen Verwendung und der mögliche Schwund untersucht werden sollen.
2. Vorkommen und alternative Ausdrucksmöglichkeiten genitivregierender Verben: Dieses Kapitel untersucht das Vorkommen des adverbalen Genitivs in schriftlicher und mündlicher Sprache. Es wird festgestellt, dass der Genitiv in der Schriftsprache noch relativ häufig verwendet wird, während er in der gesprochenen Sprache selten ist. Der Abschnitt vergleicht unterschiedliche Meinungen zum Rückgang des Genitivs, wobei die These eines vollständigen Verschwindens sowie die Gegenmeinung einer wieder zunehmenden Verwendung thematisiert werden. Weiterhin werden alternative Ausdrucksmöglichkeiten zum Genitiv, insbesondere der Gebrauch des Akkusativs und von Präpositionalphrasen, angesprochen und anhand von Nietzsche-Zitaten illustriert.
3. Erklärungen für den Schwund: Dieses Kapitel widmet sich verschiedenen Erklärungsansätzen für den Rückgang des adverbalen Genitivs. Diachrone Ansätze werden durch die Analyse der verbalen Geschehensweise, den Verlust der genitivspezifischen Funktion der Indefinitheitsmarkierung (Leiss) und die syntaktische Varianz bei semantischer Konstanz (Schrodt) erläutert. Die Kapitel vergleichen und diskutieren die Kompatibilität der verschiedenen Hypothesen. Ein synchroner Erklärungsansatz wird ebenfalls vorgestellt, um das Phänomen aus einer gegenwärtigen Perspektive zu beleuchten. Der Abschnitt stellt die unterschiedlichen Theorien gegenüber und trägt zur Diskussion über die Ursachen des Genitiv-Rückgangs bei.
Schlüsselwörter
Adverbaler Genitiv, Genitivobjekt, Kasusverlust, Sprachwandel, Diachronie, Synchronie, Alternative Ausdrucksmöglichkeiten, Grammatik, Deutsche Sprache, Schriftsprache, Mündliche Sprache, Valenzrahmen, semantische Konstanz, syntaktische Varianz.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Rückgang des adverbalen Genitivs im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Rückgang des adverbalen Genitivs im Deutschen. Sie analysiert dessen Vorkommen in schriftlicher und mündlicher Sprache, kontrastiert verschiedene diachrone und synchrone Erklärungsansätze für diesen Rückgang und bewertet deren Gültigkeit. Ein weiterer Fokus liegt auf alternativen Ausdrucksmöglichkeiten zum adverbalen Genitiv.
Welche Arten von Genitiv werden behandelt?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Arten des Genitivs, u.a. den strukturellen, semantischen und den inhärenten/adverbalen Genitiv. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem adverbalen Genitiv.
Wie wird der Rückgang des adverbalen Genitivs in der Arbeit belegt?
Der Rückgang wird anhand von Beispielen aus Literatur (Goethe, Nietzsche) und durch den Vergleich der Genitiv-Verwendung in schriftlicher und mündlicher Sprache belegt. Es werden unterschiedliche Meinungen zum Ausmaß des Rückgangs und der These eines vollständigen Verschwindens diskutiert.
Welche diachronen Erklärungsansätze werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene diachrone Erklärungsansätze: die Analyse der verbalen Geschehensweise, den Verlust der genitivspezifischen Funktion der Indefinitheitsmarkierung nach Leiss und den Ansatz der syntaktischen Varianz bei semantischer Konstanz nach Schrodt. Die Kompatibilität dieser Hypothesen wird ebenfalls diskutiert.
Gibt es auch synchrone Erklärungsansätze?
Ja, die Arbeit stellt neben den diachronen Ansätzen auch einen synchronen Erklärungsversuch vor, um den Rückgang des Genitivs aus einer gegenwärtigen Perspektive zu beleuchten.
Welche alternativen Ausdrucksmöglichkeiten zum adverbalen Genitiv werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht alternative Ausdrucksweisen, insbesondere den Gebrauch des Akkusativs und von Präpositionalphrasen. Diese werden anhand von Beispielen aus den Werken Nietzsches illustriert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Ein einleitendes Kapitel, ein Kapitel zum Vorkommen des adverbalen Genitivs und seinen Alternativen, ein Kapitel mit diachronen und synchronen Erklärungsansätzen und ein abschließendes Resümee.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Adverbaler Genitiv, Genitivobjekt, Kasusverlust, Sprachwandel, Diachronie, Synchronie, Alternative Ausdrucksmöglichkeiten, Grammatik, Deutsche Sprache, Schriftsprache, Mündliche Sprache, Valenzrahmen, semantische Konstanz, syntaktische Varianz.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Erklärungsansätze für den Rückgang des adverbalen Genitivs zu kontrastieren und zu bewerten. Sie hinterfragt die These eines vollständigen Verschwindens des Genitivs und analysiert alternative Ausdrucksmöglichkeiten.
- Quote paper
- Michael Steinmetz (Author), 2007, Zum Rückgang des adverbalen Genitivs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74862