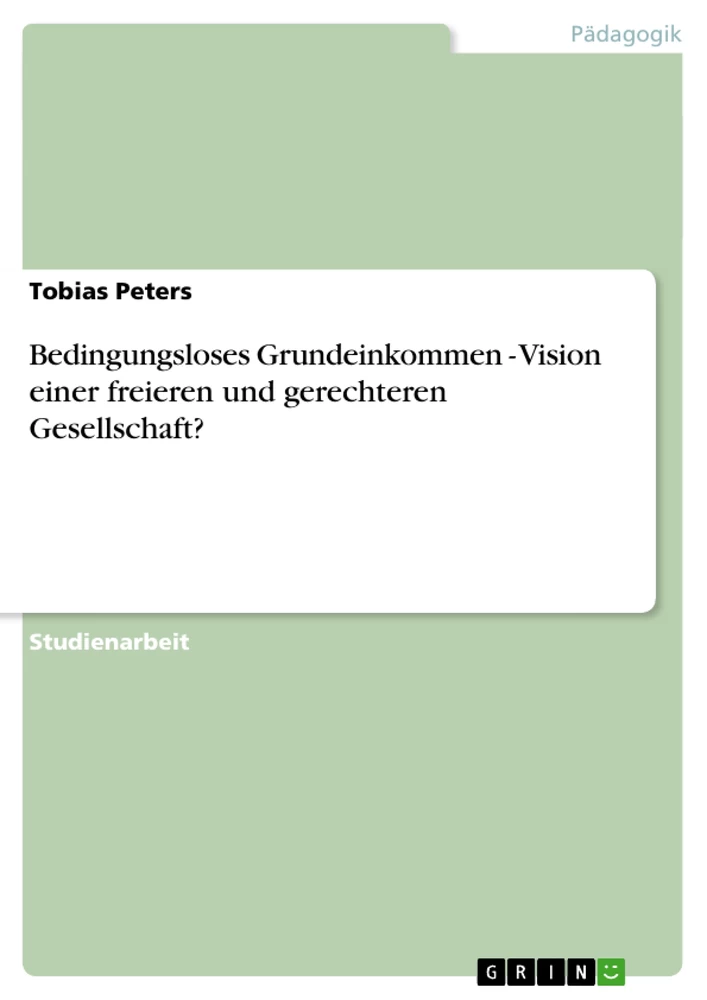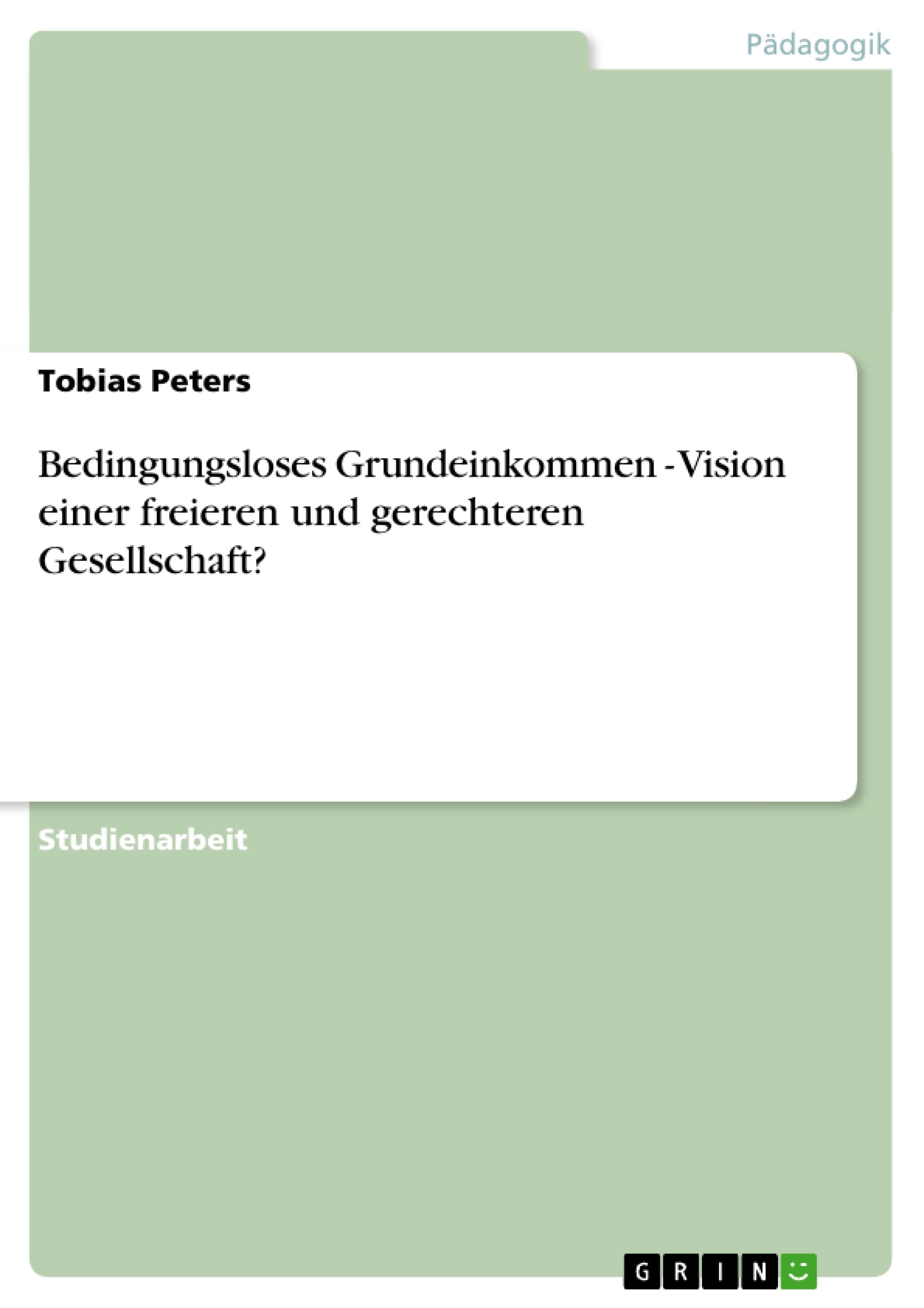Thomas Althaus (CDU) macht den Vorschlag eines „solidarischen Bürgergeldes“, Tanja Kipping (PDS) schwärmt von den Vorzügen eines bedingungslosen Grundeinkommens und der Psychologe Erich Fromm schrieb 1966 einen Aufsatz über die psychologischen Aspekte eines Grundeinkommens für jeden. Während es im letzten Jahrhundert nur vereinzelte Stimmen waren, die ein bedingungsloses Grundeinkommen befürworteten, mehren sich die Stimmen Anfang unseres Jahrhunderts. Wie kommt es, dass Argumente für ein bedingungsloses Grundeinkommen (im Folgenden BGE genannt) aus so unterschiedlichen, ja konträren Lagern, kommen. Zwar gibt es viele verschiedene Modelle (daher kann hier auch nicht auf alle Modelle im Einzelnen eingegangen werden), die Unterschiede liegen jedoch nur in den Detailfragen. Könnte es sein, dass diese Idee jenseits jeglicher Parteiideologie einfach gut ist?
Das BGE wäre ein Mindesteinkommen für jeden individuellen Bürger. Es müsste existenzsichernd sein, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zur Arbeit gewährt werden. Die Vorschläge über die Höhe des BGE schwanken zwischen 800 Euro (Althaus-Modell) und 1.500 Euro im Monat. Jedem ist es freigestellt über dieses Mindesteinkommen soviel hinzuzuverdienen, wie er möchte.
Ist so etwas überhaupt realisierbar oder ist das nur eine Spinnerei einiger hoffnungsloser Romantiker? Wie würde sich unsere Gesellschaft verändern? Würde das Solidarsystem auseinander fallen oder würde es im Gegenteil freier und gerechter? Was bedeutete das BGE für jeden Einzelnen?
Mit diesen Fragen möchte ich mich im Rahmen dieser Untersuchung auseinandersetzen. Die Argumente und Einwände dieser Vision werden nur kurz zu Wort kommen können, denn mehr lässt der Rahmen dieses Essays nicht zu. Ich werde die Kriterien Wirtschaft, Finanzierung, Psychologie und Ethik sowie Kinder, Jugend und Bildung untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pro und Contra
- Wirtschaft
- Finanzierung
- Kinder, Jugend und Bildung
- Psychologische Aspekte
- Ethik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Untersuchung befasst sich mit der Vision eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) und dessen möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Es wird untersucht, ob diese Idee, die aus unterschiedlichen Lagern Unterstützung findet, jenseits jeglicher Parteiideologie sinnvoll sein könnte.
- Wirtschaftliche Aspekte des BGE, insbesondere die Rolle der Automation und die Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Produktivität
- Finanzierungsmöglichkeiten und Umsetzbarkeit des BGE
- Psychologische und ethische Implikationen des BGE
- Auswirkungen des BGE auf Kinder, Jugendliche und Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die These vor, dass die Idee eines BGE zunehmend an Bedeutung gewinnt und aus verschiedenen Perspektiven Unterstützung findet. Es werden die Grundprinzipien des BGE erläutert, die sich auf ein Mindesteinkommen für jeden Bürger beziehen, das ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zur Arbeit gewährt werden soll. Der Autor stellt die wichtigsten Fragen, die im Rahmen der Untersuchung beantwortet werden sollen.
Pro und Contra
Wirtschaft
Der Autor präsentiert Argumente für und gegen ein BGE aus wirtschaftlicher Sicht. Die positive Entwicklung der Automation und Produktivitätssteigerung, die Konsumanregung und die Förderung des Risikos sowie die Erweiterung des Verhandlungsspielraums zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden als Argumente für ein BGE genannt. Gegenargumente beziehen sich auf die Abkehr von Vollbeschäftigung und die Annahme, dass Arbeitslosigkeit nicht mehr bekämpft, sondern akzeptiert werden würde.
Finanzierung
Der Abschnitt beleuchtet die Finanzierbarkeit des BGE und stellt verschiedene Konzepte vor. Die Hauptbefürchtung der Gegner, die mangelnde Finanzierbarkeit, soll durch stufenweise Umfinanzierung und eine Senkung der Lohnnebenkosten hin zur konsumorientierten Steuer (Mehrwertsteuer) behoben werden. Die Sozialausgaben (mit Ausnahme der Kranken- und Pflegeversicherung) würden ersatzlos gestrichen, da das Mindesteinkommen über das BGE finanziert würde.
Schlüsselwörter
Bedingungsloses Grundeinkommen, Automation, Produktivität, Arbeitsmarkt, Vollbeschäftigung, Finanzierung, Sozialausgaben, Psychologie, Ethik, Kinder, Jugend, Bildung.
- Quote paper
- Tobias Peters (Author), 2006, Bedingungsloses Grundeinkommen - Vision einer freieren und gerechteren Gesellschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74971