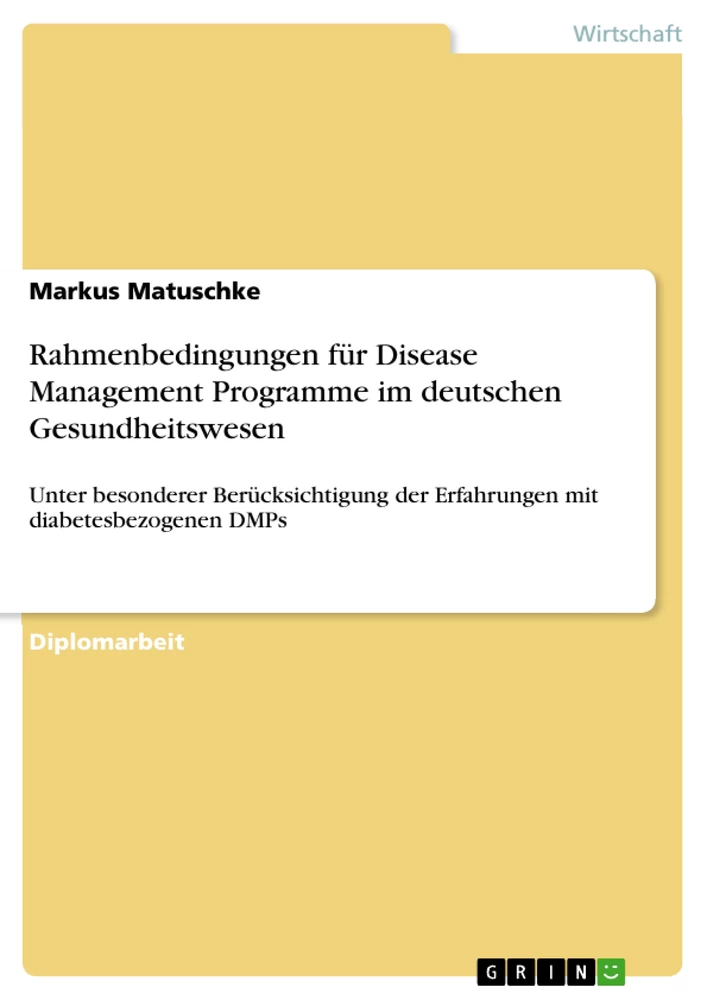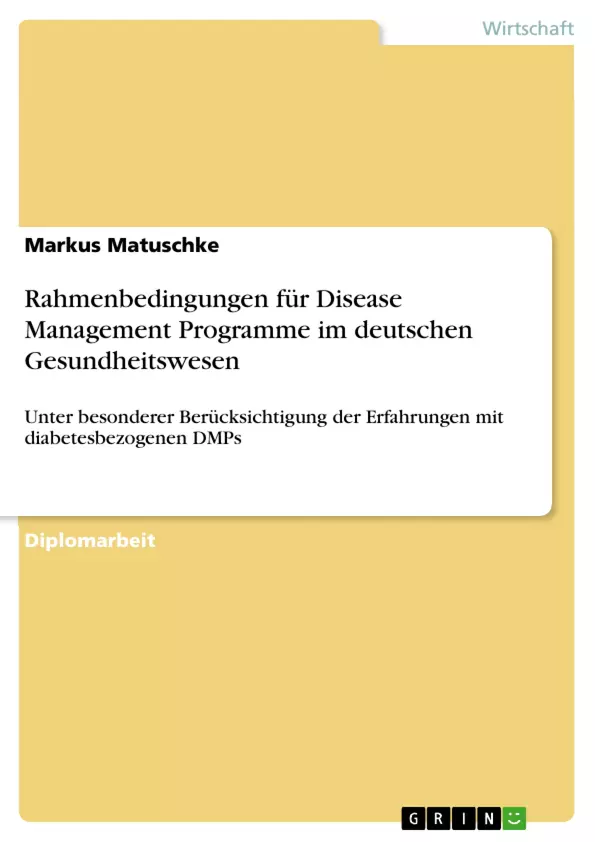Gegenstand dieser Arbeit ist die Erörterung methodischer Fragestellungen in Bezug auf die Evaluationsmöglichkeiten von DMP’s mit Routinedaten der Gesetzlichen Kranken-versicherungen. Um das Verständnis der Ausführungen späterer Kapitel zu erleichtern, bietet der erste Teil einen Einblick in die medizinischen Gesichtspunkte der Stoffwech-selkrankheit Diabetes. Dem schließt sich eine kurze Begriffsbestimmung der sich seit Anfang der 90er zunächst in den USA verbreitenden DMP’s an. Es wird erläutert, warum Diabetiker von einer Teilnahme an einem DMP profitieren können und mit welchen konkreten Maßnahmen die Verbesserung der Versorgungsqualität angestrebt wird.
Eine umfassende Darstellung der Rahmenbedingungen für die Programme, worunter beispielsweise der Kassenwettbewerb, der Risikostrukturausgleich und die sektoralen Gegebenheiten fallen, rundet das Kapitel ab. Anschließend wird gezeigt, inwiefern mehrere Evaluationsarten für die Bewertung von DMP’s herangezogen werden können und in welcher Weise diesen gewisse Outcomearten zuordenbar sind.
Das fünfte Kapitel bietet eine Betrachtung international gesammelter Erfahrungen mit Diabetes-Programmen. Zwei Tabellen stellen für 11 Studien einen Überblick über deren Teilnehmerzahlen, Dauer, Einschlusskriterien und untersuchte Parameter dar. Auf Grundlage dieser allgemeinen Aufführung werden alle Studien einzeln vorgestellt, um explizit deren Stärken und Schwächen anzusprechen. Von besonderem Interesse sind die Konstruktionen der Vergleichsgruppen, weil nicht randomisierte Studien häufig invalide Ergebnisse liefern, wenn mögliche Selektionsverzerrungen unangepasst in die Analyse miteinfließen. Insgesamt wird sich herausstellen, dass es trotz flächendeckender Verbreitung der Krankheitsmanagementprogramme kaum gesicherte Erkenntnisse über deren Kosteneffektivität gibt. Eine nachweisliche Reduktion Diabetes bedingter Komplikationen ist im Zusammenhang mit DMP’s bisher ebenfalls noch nicht beobachtet worden.
In den beiden nachfolgenden Kapiteln werden die Charakteristika der deutschen Routinedaten analysiert. Zunächst werden die Vor- und Nachteile für die Auswertung der bestehenden Daten aufgezeigt. Anschließend werden anhand der Datenquellen die einzelnen Variablenarten vorgestellt und mit den Ergebnissen des vierten und fünften Ka-pitels verglichen. Der letzte Teil der Arbeit bietet konkrete Lösungsansätze zur Umset-zung einer Evaluation, die sich ausschließlich der vorhandenen Sekundärdaten bedient.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DIABETES
- .1 EPIDEMIOLOGIE
- .2 MEDIZINISCHE KENNGRÖBEN
- .3 FOLGEERKRANKUNGEN
- .4 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG
- 3. DISEASE MANAGEMENT PROGRAMME
- .1 DEFINITION
- .2 ENTWICKLUNG
- .3 RAHMENBEDINGUNGEN IN DEUTSCHLAND
- .1 Einflussfaktoren auf die Einführung von DMP's
- .2 Praktische Umsetzung
- .3 Zukünftige Entwicklung
- 4. EVALUATION UND SIMULATION VON DMP'S
- .1 THEORETISCHE ANSATZPUNKTE ZUR EVALUATION EINES DMP
- .2 OUTCOMEARTEN EINES DIABETES-DMP'S
- .3 SIMULATIONSRECHNUNG
- 5. INTERNATIONALE ERFAHRUNGEN BEI DER EVALUATION VON DIABETES-DMP'S
- .1 ERGEBNISSE AUS STUDIEN MIT ROUTINEDATEN
- .1 ,,Diabetes NetCare\" von RUBIN et al.
- .2 ,,Penn State Geisinger Health System Studie\" von SIDOROV et al.
- .3 ,,Diabetes Disease Management Program“ von VILLAGRA und AHMED
- .4 Weitere Studienergebnisse
- .2 ERGEBNISSE AUS KLINISCHEN STUDIEN
- .1 ,,Diabetes Advantage Program\" von CLARK et al.
- .2 ,,TennCare\" von PATRIC et al.
- .3 ,,Comprehensive Diabetes Care Service\" von PETERS / DAVIDSON
- .4 ,,Nurse Case Management\" von AUBERT et al.
- .5 ,,Mayo Health System Diabetes Translation Project\" von MONTORI et al.
- .3 SCHLUSSFOLGERUNGEN
- .1 ERGEBNISSE AUS STUDIEN MIT ROUTINEDATEN
- 6. ROUTINEDATEN DER GKV
- .1 CHARAKTERISIERUNG
- .2 VARIABLEN
- .3 IDENTIFIKATION VON DIABETIKERN
- .4 SCHLUSSFOLGERUNGEN
- 7. EVALUATION VON DIABETES-DMP'S MIT ROUTINEDATEN
- .1 PROBLEMSTELLUNG
- .2 MODELLVARIANTEN
- .1 Regressionsmodelle
- .2 Nichtparametrische Verfahren
- .3 RISIKODIMENSIONEN
- .4 SCHLUSSFOLGERUNGEN
- 8. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit den Rahmenbedingungen für Disease Management Programme (DMP's) im deutschen Gesundheitssystem. Im Fokus stehen die Erfahrungen mit diabetesbezogenen DMP's.
- Analyse der epidemiologischen und volkswirtschaftlichen Relevanz von Diabetes
- Bewertung der Rahmenbedingungen für die Einführung und Durchführung von DMP's in Deutschland
- Bewertung der internationalen Forschungsergebnisse zur Evaluation von Diabetes-DMP's
- Untersuchung der Möglichkeiten und Grenzen der Evaluation von Diabetes-DMP's mit Routinedaten der GKV
- Entwicklung eines Modells zur Simulation der Kostenentwicklung von DMP's
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2 gibt einen Überblick über die epidemiologische und volkswirtschaftliche Relevanz von Diabetes mellitus. Dabei werden die Prävalenzraten, die medizinischen Kennzeichen, die Folgeerkrankungen und die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Erkrankung behandelt.
- Kapitel 3 definiert Disease Management Programme (DMP's) und erläutert deren Entwicklung und die Rahmenbedingungen in Deutschland. Die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Einführung von DMP's werden betrachtet, und es wird auf die praktische Umsetzung und die zukünftige Entwicklung eingegangen.
- Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Evaluation und Simulation von DMP's. Es werden theoretische Ansätze zur Evaluation eines DMP's vorgestellt, die Outcomearten eines Diabetes-DMP's analysiert und eine Simulationsrechnung zur Kostenentwicklung durchgeführt.
- Kapitel 5 stellt internationale Erfahrungen bei der Evaluation von Diabetes-DMP's vor. Es werden sowohl Ergebnisse aus Studien mit Routinedaten als auch aus klinischen Studien zusammengefasst.
- Kapitel 6 analysiert die Routinedaten der GKV als wichtige Quelle für die Evaluation von DMP's. Es werden die Charakteristika der Daten, die relevanten Variablen und die Möglichkeiten zur Identifikation von Diabetikern beschrieben.
- Kapitel 7 widmet sich der Evaluation von Diabetes-DMP's mit Routinedaten der GKV. Es werden verschiedene Modellvarianten für die Evaluation vorgestellt und die Risikodimensionen betrachtet.
Schlüsselwörter
Diabetes mellitus, Disease Management Programme (DMP's), Gesundheitswesen, Evaluation, Routinedaten, GKV, epidemiologische Relevanz, volkswirtschaftliche Bedeutung, internationale Erfahrungen, Modellentwicklung, Simulation.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Disease Management Programme (DMP)?
DMPs sind strukturierte Behandlungsprogramme für chronisch Kranke (hier Diabetes), die die Versorgungsqualität durch gezielte Maßnahmen verbessern sollen.
Wie effektiv sind DMPs bei Diabetes?
Internationale Studien zeigen bisher kaum gesicherte Erkenntnisse über die Kosteneffektivität oder eine nachweisliche Reduktion von Komplikationen.
Welche Rolle spielen Routinedaten der GKV bei der Evaluation?
Routinedaten ermöglichen eine großflächige Analyse der Versorgung, weisen aber auch methodische Grenzen wie potenzielle Selektionsverzerrungen auf.
Warum ist Diabetes volkswirtschaftlich so bedeutend?
Aufgrund der hohen Prävalenz und der teuren Folgeerkrankungen stellt Diabetes eine erhebliche finanzielle Belastung für das Gesundheitssystem dar.
Was ist das Ziel der Simulationsrechnungen in dieser Arbeit?
Die Simulationen dienen dazu, die zukünftige Kostenentwicklung von DMPs auf Basis vorhandener Sekundärdaten abzuschätzen.
- Quote paper
- Markus Matuschke (Author), 2007, Rahmenbedingungen für Disease Management Programme im deutschen Gesundheitswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75041