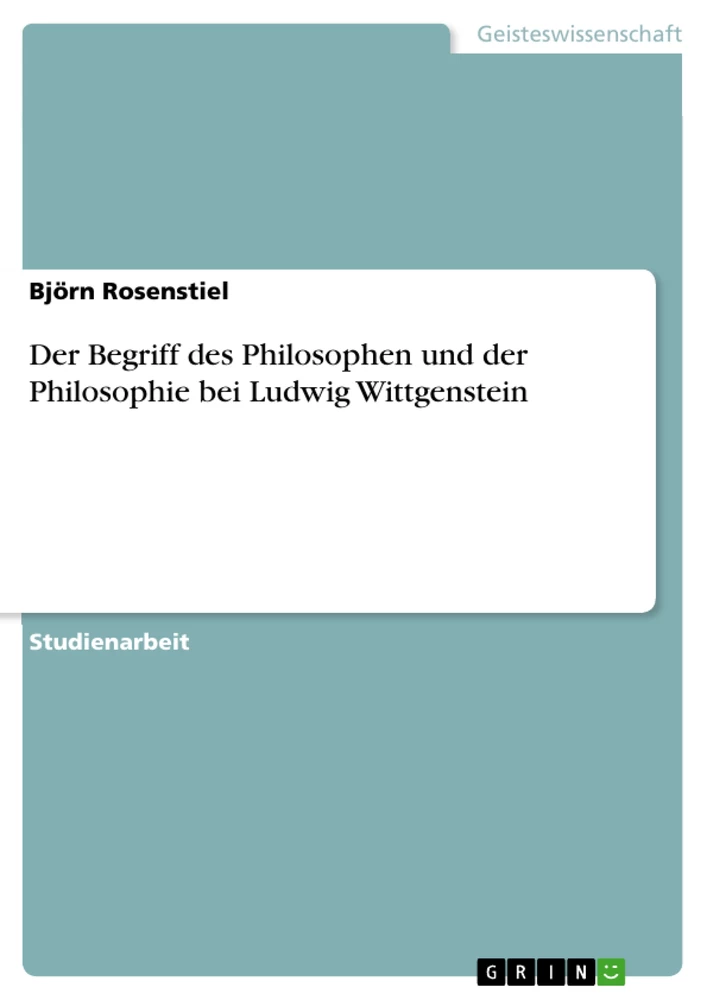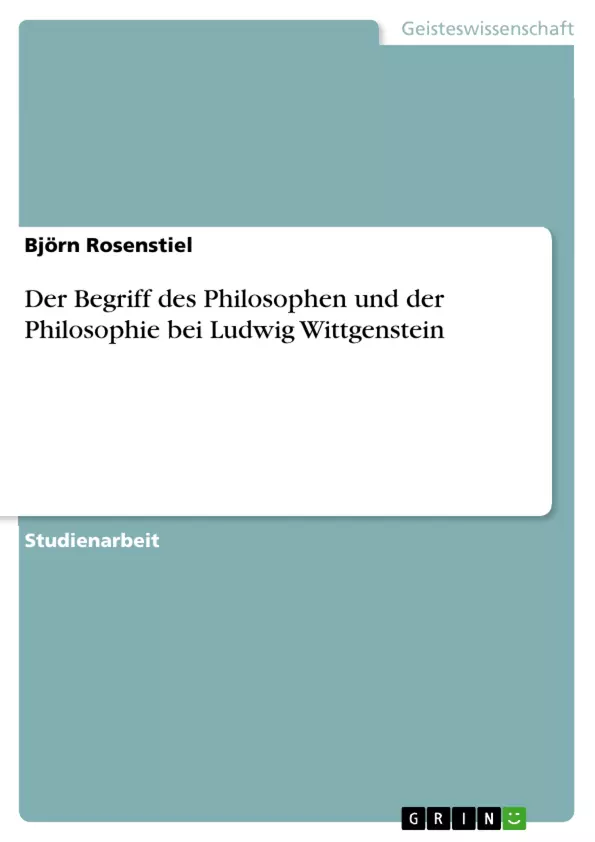1. Einleitung
Will man Heraklit Glauben schenken, dann hat Pythagoras erstmals das bis heute bekannte Wort „philosophe“ für jemanden benutzt, der nach Wissen und Weisheit strebt. Pythagoras selbst vereinte in sich Mathematik und orphische Mystik und stellt damit, in gewisser Hinsicht, den Ausgangspunkt einer Entwicklungsgeschichte westlicher Philosophie dar, die gekennzeichnet ist von der Zerrissenheit zwischen Religion und Wissenschaft.
Oberflächlich gesehen, hat sich die Philosophie in der Antike über mehrere Stadien entwickelt, ging, als das Christentum entstand und Rom fiel, über die arabische Konservierung in der Theologie des Mittelalters auf und geriet nach der Reformation bis zur Gegenwart zunehmend in den Griff der Wissenschaften. Am Begriff des Philosophen hat sich dabei im Laufe der Zeit, nicht viel geändert, wohl aber an der Auffassung, was die Aufgabe des Philosophen, die Philosophie, sein soll.
Vom Standpunkt des Cambridger Wissenschaftlers Bertrand Russell aus betrachtet, erscheint die Philosophie, als „ein Mittelding zwischen Theologie und Wissenschaft“ , denn sie besteht, wie die Theologie, aus der Spekulation über die Dinge, und wie die Wissenschaft beruft sie sich auf die Vernunft.
Die Untersuchung von Fragen, wie etwa, ob die Welt aus Geist und Materie besteht, ob dem Universum ein einheitlicher Zweck zugrunde liegt oder woraus eine glückliche Lebensführung besteht, ist, zumindest für den englischen Philosophen, die Aufgabe der Philosophie. M.a.W.: Ihr größter Wert liegt für ihn darin, daß sie lehrt, „wie man ohne Gewißheit und ohne durch Unschlüssigkeit gelähmt zu werden, leben kann.“ Aber als Niemandsland zwischen Theologie und Wissenschaft ist sie zugleich, „Angriffen von beiden Seiten ausgesetzt“ .
Womit Russell allerdings nicht rechnete, war, daß die wohl folgenschwerste Attacke gegen sie aus ihren eigenen Reihen geführt wurde, noch dazu von einem Zeitgenossen und Freund Russells, dem Österreicher Ludwig Wittgenstein...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Leidenschaft und Genialität
- Leben und Werk
- Persönlichkeit
- Der Tractatus logico - philosophicus
- Die Logik der Sprache
- Klarheit, Übersicht und Problemlösung
- Die Philosophischen Untersuchungen
- Die Grammatik und das Sprachspiel
- Diagnose und Therapie
- Die Ruhe vor der Philosophie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Begriff des Philosophen und der Philosophie bei Ludwig Wittgenstein. Sie verfolgt das Ziel, Wittgensteins Verständnis von Philosophie zu beleuchten und die Herausforderungen, die er für die traditionelle Philosophie aufwarf, aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert Wittgensteins Werk in seiner Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf die zentralen Themen seines Frühwerks, den „Tractatus logico-philosophicus“, und seines Spätwerks, den „Philosophischen Untersuchungen“.
- Die Entwicklung des philosophischen Denkens von Wittgenstein
- Die Rolle der Sprache in der Philosophie
- Die Beziehung zwischen Philosophie und Wissenschaft
- Die Grenzen und Möglichkeiten der Philosophie
- Wittgensteins Kritik an traditionellen philosophischen Konzepten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des Begriffs des Philosophen dar und beleuchtet die Debatte über die Rolle der Philosophie im Spannungsfeld zwischen Religion und Wissenschaft.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Leben und Werk Ludwig Wittgensteins. Es zeichnet die Entwicklung seines Denkens nach, beginnend mit seinen frühen Arbeiten im Bereich der Mathematik und Logik bis hin zu seinen späteren philosophischen Untersuchungen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem „Tractatus logico-philosophicus“, einem zentralen Werk Wittgensteins. Es analysiert die Kernaussagen des „Tractatus“ und beleuchtet die Rolle der Logik und Sprache in Wittgensteins Philosophie.
Das vierte Kapitel untersucht die „Philosophischen Untersuchungen“, Wittgensteins Spätwerk, das eine radikale Abkehr von den Thesen des „Tractatus“ darstellt. Es behandelt die zentralen Konzepte der Sprachspiele und der Bedeutung von Sprache.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Frage, inwieweit Wittgenstein die Philosophie als eine Art Therapie betrachtet hat, die den Menschen helfen soll, aus den Verwirrungen der Sprache zu entkommen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Philosophie Wittgensteins, die Rolle der Sprache in der Philosophie, der Tractatus logico-philosophicus, die Philosophischen Untersuchungen, die Sprachspiele, Logik, und die Grenzen und Möglichkeiten der Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Wie definierte Ludwig Wittgenstein die Aufgabe der Philosophie?
Für Wittgenstein war Philosophie keine Lehre, sondern eine Tätigkeit zur Klärung von Gedanken und zur Überwindung von Sprachverwirrungen.
Was ist der Kernunterschied zwischen seinem Früh- und Spätwerk?
Im Frühwerk (Tractatus) suchte er nach der logischen Struktur der Sprache; im Spätwerk (Philosophische Untersuchungen) betonte er die Vielfalt der 'Sprachspiele' und den Gebrauchskontext.
Was versteht Wittgenstein unter einem 'Sprachspiel'?
Sprachspiele sind die verschiedenen Weisen, wie Sprache in soziale Handlungen eingebettet ist (z. B. Befehlen, Fragen, Erzählen).
Warum verglich Wittgenstein Philosophie mit einer Therapie?
Er sah philosophische Probleme als 'Knoten' im Verstand an, die durch die Analyse der Grammatik gelöst werden müssen, um geistige Ruhe zu finden.
Wie stand Wittgenstein zum Verhältnis von Philosophie und Wissenschaft?
Er grenzte die Philosophie scharf von der Wissenschaft ab: Wissenschaft liefert Erklärungen, Philosophie schafft Übersicht und Klarheit.
- Quote paper
- Magister Artium Björn Rosenstiel (Author), 2005, Der Begriff des Philosophen und der Philosophie bei Ludwig Wittgenstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75070