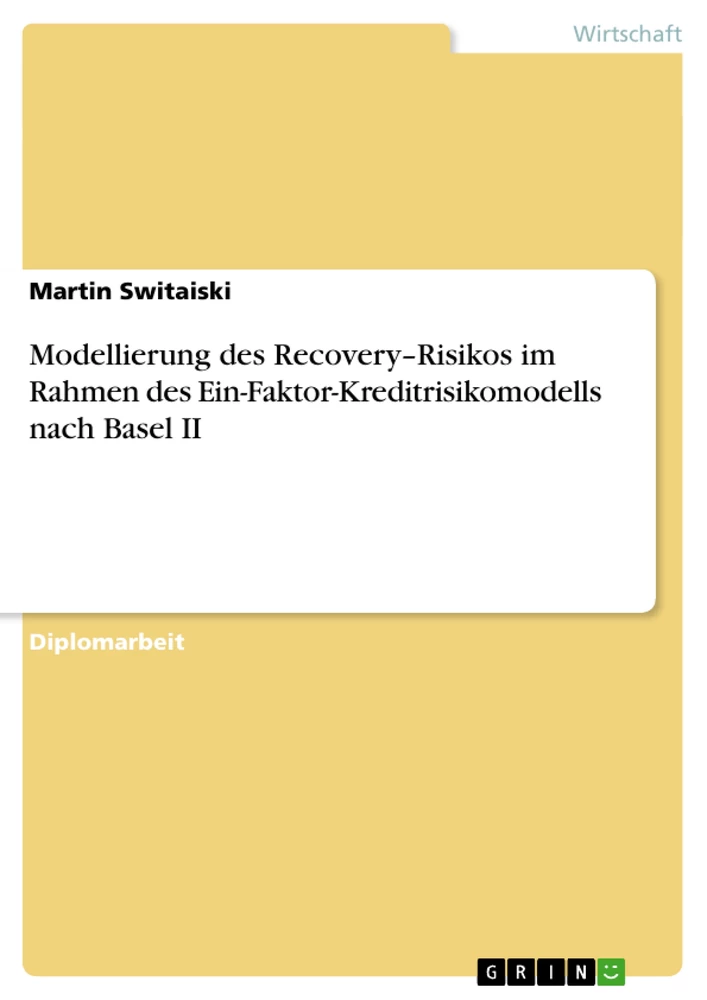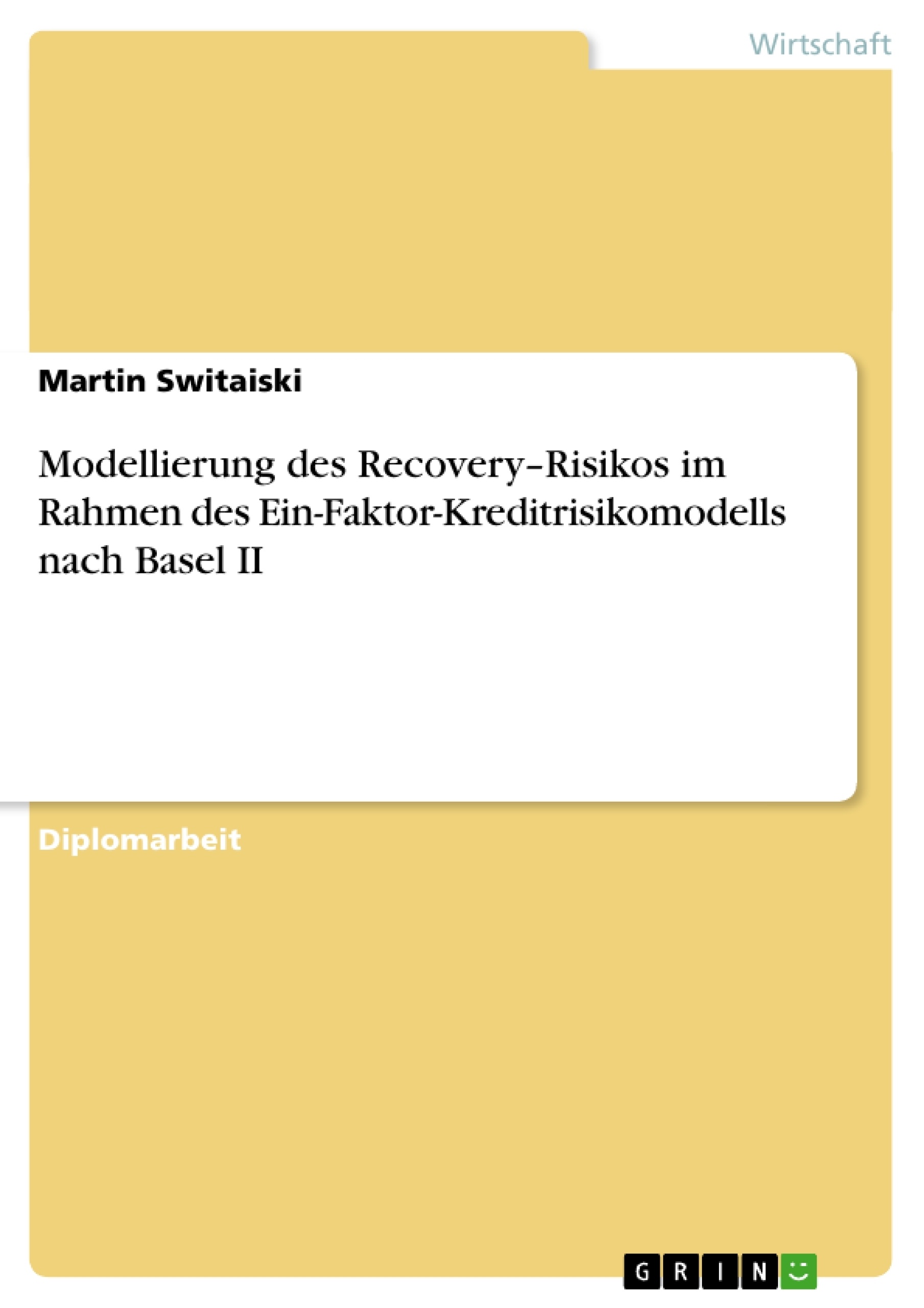Moderne Risikosysteme zur Quantifizierung von Kreditrisiken basieren größtenteils auf Modellen, denen im Wesentlichen drei Risikoparameter zu Grunde liegen. Diese
sind die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD), der Forderungswert bei Ausfall (Exposure at Default, EAD) sowie die Verlustquote bei Ausfall (Loss Given Default, LGD).
Die Bemühungen, möglichst angemessene Modellierungsmethoden zu entwickeln, haben sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf den PD–Parameter konzentriert. Dementsprechend existieren inzwischen weit entwickelte Modelle zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und das Ausfallrisiko von Kreditnehmern kann häufig mit einem hohen Maß an Genauigkeit angegeben werden.
Die Entwicklung theoretischer Modelle zur Schätzung und Analyse des Verlustquotenparameters (Loss Given Default) sowie dessen empirische Erforschung befinden sich hingegen in einer vergleichsweise frühen Phase. Die Verlustquote einer ausgefallenen Forderung gibt das Verhältnis der Schadenshöhe zum ausstehenden Forderungsbetrag an. Analog dazu drückt das Konzept der Recovery–Rate aus, welcher Anteil der Forderungssumme nach einem Ausfallereignis wieder eingebracht werden kann. Das Recovery–Risiko besteht in der Unsicherheit hinsichtlich des Betrages, der dem Kreditgeber nach Abzug des gesamten Verlusts verbleibt. Die Veröffentlichung der neuen Rahmenvereinbarung "Internationale Konvergenz
der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen" ("Basel II") durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2004 führte zu einer spürbaren Intensivierung der Forschungsaktivitäten im Hinblick auf das Recovery–Risiko. Im Zuge von Basel II stieg das Interesse an diesem ehemals wenig beachteten Risikoparameter deutlich an, so dass inzwischen von allen großen Ratingagenturen erste indikative Recovery–Ratings angeboten werden.
Die Arbeit leistet eine kritische Analyse der aktuellen Modellierungsmethodik und der Behandlung des Recovery-Risikos. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf dem den Regelungen von Basel II zugrundeliegenden Ein-Faktor-Kreditrisikomodell sowie verschiedenen Erweiterungen, die eine angemessene Berücksichtigung des Recovery-Risikos innerhalb des Ein-Faktor-Modells und Basel II ermöglichen. Zudem enthält die Arbeit eine Zusammenstellung empirischer Erkenntnisse und eine kritische Auseinandersetzung mit bankenaufsichtlichen Regelungen im Hinblick auf die Behandlung des Recovery Risikos.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Grundlagen und Begriffsdefinition
- 1.1 Risikoparameter und erwarteter Verlust
- 1.2 Unerwarteter Verlust
- 1.2.1 Ökonomisches Kapital
- 1.2.2 Verlustverteilung des Kreditportfolios
- 1.3 Messung von Verlustquoten
- 1.4 Bedeutung des Recovery-Risikos für das Risikomanagement
- 2 Modellierung des Recovery-Risikos
- 2.1 Modelltheoretischer Hintergrund
- 2.1.1 Der Unternehmenswertansatz nach Merton
- 2.1.2 Das Ein-Faktor-Modell mit systematischem Recovery-Risiko
- 2.2 Klassische Ein-Faktor-Modellierung
- 2.2.1 Modellbeschreibung
- 2.2.2 Modellanalyse
- 2.2.3 Berücksichtigung des Besicherungsgrades
- 2.3 Kritische Würdigung des erweiterten Ein-Faktor-Modells
- 2.1 Modelltheoretischer Hintergrund
- 3 Ergebnisse empirischer Untersuchungen zum Recovery-Risiko
- 3.1 Zusammenhang zwischen Ausfallrisiko und Recovery-Risiko
- 3.2 Empirische Erkenntnisse zu weiteren Zusammenhängen
- 4 Bankenaufsichtsrechtliche Behandlung des Recovery-Risikos
- 4.1 Grundzüge der internationalen Bankenaufsicht
- 4.2 Ermittlung der regulatorischen Eigenkapitalanforderung
- 4.3 Kritik an der Behandlung des Recovery-Risikos nach Basel II
- Schlussfolgerung und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Modells nach Basel II. Ziel ist es, die Bedeutung des Recovery-Risikos für das Risikomanagement von Banken zu beleuchten und die Auswirkungen auf die Eigenkapitalanforderungen nach Basel II zu analysieren.
- Die Modellierung des Recovery-Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Modells nach Basel II
- Die Bedeutung des Recovery-Risikos für das Risikomanagement von Banken
- Die Auswirkungen des Recovery-Risikos auf die Eigenkapitalanforderungen nach Basel II
- Empirische Untersuchungen zum Recovery-Risiko und dessen Zusammenhang mit dem Ausfallrisiko
- Kritik an der Behandlung des Recovery-Risikos im Basel II-Regelwerk
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die Analyse des Recovery-Risikos. Es werden wichtige Risikoparameter definiert, wie z.B. der erwartete Verlust und der unerwartete Verlust, sowie die Bedeutung des Ökonomischen Kapitals und der Verlustverteilung des Kreditportfolios erläutert. Zudem wird die Messung von Verlustquoten und die Bedeutung des Recovery-Risikos für das Risikomanagement behandelt.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel befasst sich mit der Modellierung des Recovery-Risikos. Es werden zunächst der Unternehmenswertansatz nach Merton und das Ein-Faktor-Modell mit systematischem Recovery-Risiko vorgestellt. Anschließend wird die klassische Ein-Faktor-Modellierung mit ihren einzelnen Komponenten und der Berücksichtigung des Besicherungsgrades analysiert. Abschließend wird das erweiterte Ein-Faktor-Modell kritisch gewürdigt.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel präsentiert Ergebnisse empirischer Untersuchungen zum Recovery-Risiko. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Ausfallrisiko und Recovery-Risiko sowie weiteren empirischen Erkenntnissen. Die Kapitel beleuchtet Ergebnisse, wie z.B. die durchschnittlichen Recovery- und Ausfallraten und die Häufigkeitsverteilung der Verlustquote bei Ausfall.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit der bankenaufsichtsrechtlichen Behandlung des Recovery-Risikos. Es werden die Grundzüge der internationalen Bankenaufsicht erläutert und die Ermittlung der regulatorischen Eigenkapitalanforderung im Rahmen des Basel II-Regelwerks dargestellt. Schließlich wird die Behandlung des Recovery-Risikos nach Basel II kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Kernthemen Recovery-Risiko, Ein-Faktor-Modell, Basel II, Risikomanagement, Eigenkapitalanforderungen, Verlustverteilung, Ausfallrisiko, Merton-Modell, Besicherungsgrad, empirische Untersuchungen und Bankenaufsicht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Recovery-Risiko im Bankwesen?
Das Recovery-Risiko beschreibt die Unsicherheit darüber, welcher Anteil einer Kreditforderung nach einem Ausfallereignis tatsächlich wieder eingebracht werden kann.
Was bedeutet die Abkürzung LGD?
LGD steht für "Loss Given Default" (Verlustquote bei Ausfall) und gibt das Verhältnis des Schadens zum gesamten ausstehenden Forderungsbetrag an.
Wie wird das Recovery-Risiko unter Basel II modelliert?
Die Arbeit analysiert hierfür vor allem das Ein-Faktor-Kreditrisikomodell sowie dessen Erweiterungen zur besseren Berücksichtigung systematischer Risiken.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit und Recovery-Rate?
Ja, empirische Untersuchungen deuten darauf hin, dass in Zeiten hoher Ausfallraten oft auch die Erlösquoten (Recovery Rates) sinken.
Welche Rolle spielt der Besicherungsgrad?
Der Besicherungsgrad ist ein wesentlicher Faktor bei der Schätzung des LGD, da Sicherheiten den potenziellen Verlust im Falle eines Kreditausfalls direkt reduzieren.
Was ist das Merton-Modell in diesem Kontext?
Das Merton-Modell ist ein struktureller Unternehmenswertansatz, der zur theoretischen Herleitung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten genutzt wird.
- Citar trabajo
- Diplom-Volkswirt Martin Switaiski (Autor), 2007, Modellierung des Recovery–Risikos im Rahmen des Ein-Faktor-Kreditrisikomodells nach Basel II, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75138