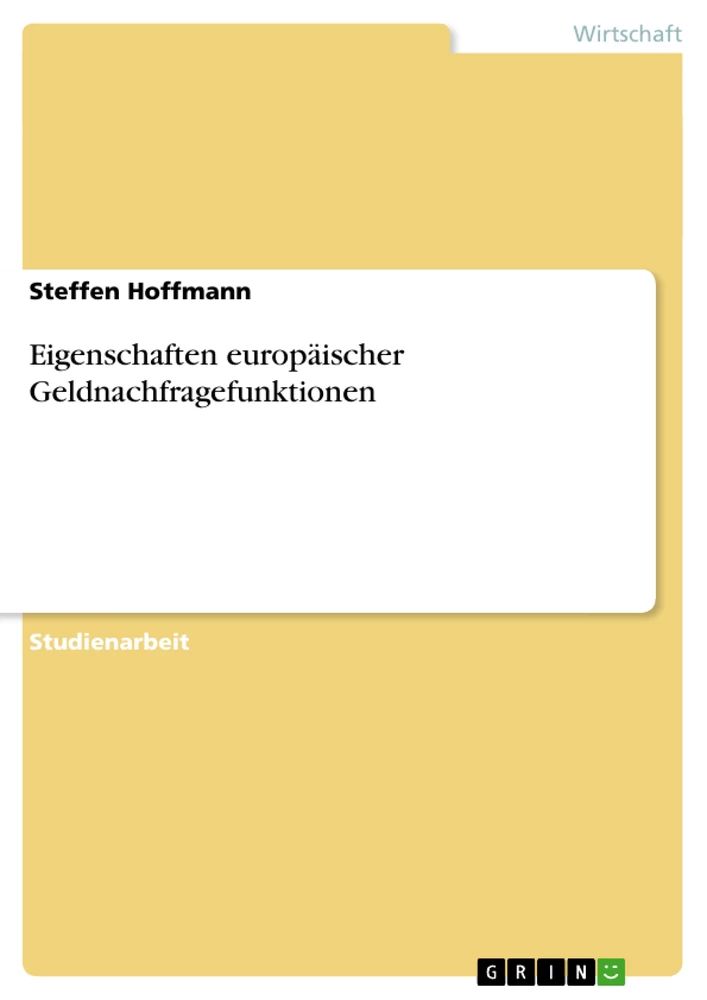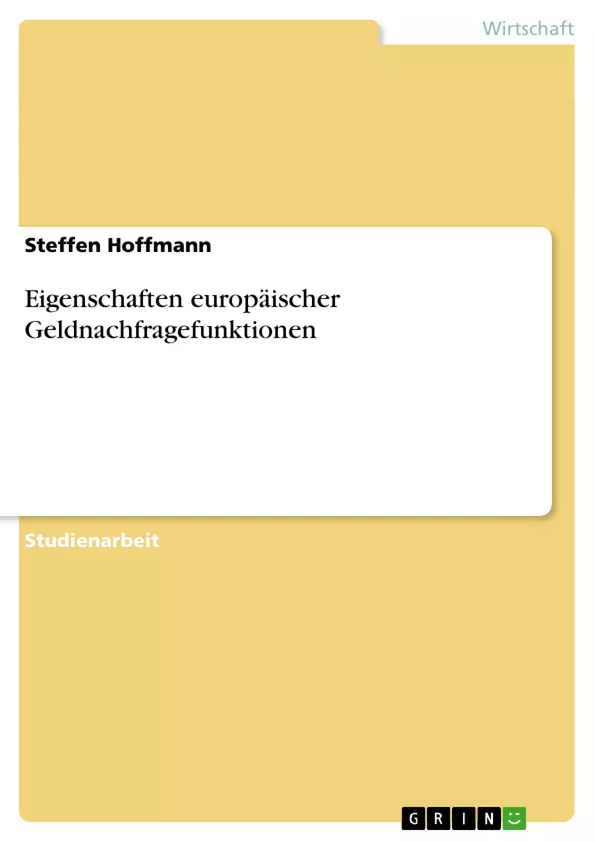Die Geldnachfrage lässt sich theoretisch aus den Funktionen des Geldes herleiten. Dabei
handelt es sich um die Funktion als Recheneinheit, Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel.
In der vorliegenden Arbeit wenden wir uns vor allem den Funktionen des Geldes als
Transaktions- und Wertaufbewahrungsmittel zu. Die Funktion des Transaktionsmittels stellt
die Quantitätsgleichung (1) des Geldes dar. Sie gibt den Zusammenhang zwischen der Anzahl
wirtschaftlicher Transaktionen und der Geldnachfrage wieder.
M *V = P*T (1)
Die rechte Seite der Gleichung T * P kann auch als das Bruttosozialprodukt (BSP)
beschrieben werden. Bei konstanter Umlaufgeschwindigkeit des Geldes führt ein Anstieg des
BSP zu einem Anstieg der Geldnachfrage. Das ist auch der Grund warum sich die Vorgaben
der EZB für das Geldmengenwachstum am erwarteten Wachstum des BSP orientieren. Das
vorrangige Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) ist die Gewährleistung der
Preisniveaustabilität in der Eurozone (Anstieg des Verbraucherpreisindex von unter, aber
nahe bei 2% gegenüber dem Vorjahr). Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung der
Wirtschaftspolitik mit dem Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus und dauerhaften
Wachstums, soweit dies ohne Gefährdung der Preisstabilität möglich ist. Die
Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes ist jedoch genauso wichtig wie die
Transaktionsfunktion. Die Nachfrage nach Geld hängt vor allem von den Opportunitätskosten
ab, also den alternativen Anlagemöglichkeiten. Die Opportunitätskosten steigen mit der
Verzinsung i der alternativen Anlagen, was bedeutet dass die Geldnachfrage abnimmt. Aus
der Wertaufbewahrungs- und der Transaktionsfunktion des Geldes lassen sich also zwei
wesentliche Determinanten der Geldnachfrage ableiten. Das ist zum einen das
Bruttosozialprodukt T * P und zum anderen der nominale Zinssatz nom i . Die nominale
Geldnachfragefunktion (2) lautet demnach:
( , ) nom
nom nom L = L BSP i (2)
In realen Größen ergibt sich die reale Geldnachfragefunktion (3) als Funktion des realen
Einkommens Y und dem realen Zinssatzes i zu:
L = L(Y , i) = ( , )
M
f Y i
P
= (3)
Der Ausgleich von Geldangebot und Geldnachfrage erfolgt über das Preisniveau. Ist das reale
Geldangebot größer als die reale Nachfrage (z.B. aufgrund eines niedrigeren BSP als
erwartet) so steigt der Preis, bis beide Größen wieder ausgeglichen sind. Es erfolgt also ein
inflationärer Prozess, denn im Gleichgewicht muss gelten:
3
nom
M
L
P
= (4)
Ein zu hohes Geldangebot führt also zu Inflation, während ein zu geringes Geldangebot nur
einen eingeschränkten Konsum und Investition ermöglicht (also schlechtes Wachstum). Um
so wichtiger ist es für die EZB die richtige reale Geldnachfrage zu schätzen um eben solchen
wachstumshämmenden bzw. inflationären Risiken entgegenzuwirken. Damit sie dies kann
muss sie jedoch genaue Kenntnis der Geldnachfragefunktion und deren Determinanten haben.
Die folgenden Ausführungen werden sich eingehender mit der Schätzung einer geeigneten
europäischen Geldnachfrage beschäftigen. In Abschnitt 2 wird näher auf die Wahl der
relevanten Determinanten und die Schätzung der europäischen Geldnachfragefunktion
eingegangen um schließlich in Abschnitt 3 die Stabilitätseigenschaften der Determinaten zu
diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Determinanten einer europäischen Geldnachfragefunktion
- 2.1 Wahl und Spezifikation der Determinanten
- 2.2 Schätzung einer europäischen Geldnachfragefunktion
- 3. Stabilitätseigenschaften der Determinaten
- 3.1 Einkommenselastizität der Geldnachfrage
- 3.2 Zinselastizität der Geldnachfrage
- 3.3 Inflationselastizität der Geldnachfrage
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eigenschaften europäischer Geldnachfragefunktionen. Ziel ist die Schätzung einer geeigneten europäischen Geldnachfragefunktion und die Analyse der Stabilitätseigenschaften ihrer Determinanten. Die Arbeit konzentriert sich auf die theoretischen Grundlagen der Geldnachfrage, die Auswahl relevanter Determinanten und die empirische Modellierung.
- Theoretische Fundierung der Geldnachfrage
- Wahl und Spezifikation relevanter Determinanten (Einkommen, Zinsen, Inflation)
- Schätzung einer europäischen Geldnachfragefunktion
- Analyse der Stabilitätseigenschaften der Determinanten
- Bewertung verschiedener Geldmengenaggregate (M1, M2, M3)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Geldnachfrage ein und erläutert die Funktionen des Geldes als Transaktionsmittel und Wertaufbewahrungsmittel. Sie beschreibt den Zusammenhang zwischen Geldnachfrage, Bruttosozialprodukt (BSP) und Preisniveau anhand der Quantitätsgleichung. Das vorrangige Ziel der EZB, die Preisstabilität, und die Bedeutung der Wertaufbewahrungsfunktion werden hervorgehoben. Die Arbeit kündigt die bevorstehende Schätzung einer europäischen Geldnachfragefunktion und die Analyse ihrer Determinanten an.
2. Determinanten einer europäischen Geldnachfragefunktion: Dieses Kapitel befasst sich mit der Wahl und Spezifikation der Determinanten einer europäischen Geldnachfragefunktion. Es wird die Verwendung des weiten Geldmengenaggregats M3 aufgrund der EZB-Strategie und technischer Aspekte begründet. Die Vorteile eines realen gegenüber einem nominalen Geldmengenaggregats werden diskutiert, unter Berücksichtigung der langfristigen Neutralität des Geldes und ökonometrischer Vereinfachungen. Das Kapitel analysiert verschiedene Spezifikationen der Geldnachfragefunktion, berücksichtigt lang- und kurzfristige Zinsraten sowie die Inflationsrate als Einflussfaktoren und diskutiert die Herausforderungen bei der Wahl und Interpretation der Zinsvariablen. Es werden verschiedene Ansätze aus der Literatur präsentiert, die die Opportunitätskosten der Geldhaltung unterschiedlich modellieren.
Schlüsselwörter
Geldnachfrage, Europäische Zentralbank (EZB), Geldmengenaggregate (M1, M2, M3), reale Geldnachfrage, nominale Geldnachfrage, Zinselastizität, Einkommenselastizität, Inflationselastizität, Opportunitätskosten, Preisniveau, Bruttosozialprodukt (BSP), ökonometrische Modellierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Analyse Europäischer Geldnachfragefunktionen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Eigenschaften europäischer Geldnachfragefunktionen. Ihr Hauptziel ist die Schätzung einer geeigneten Geldnachfragefunktion für Europa und die Untersuchung der Stabilität ihrer bestimmenden Faktoren (Determinanten).
Welche Determinanten der Geldnachfrage werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Einflüsse von Einkommen, Zinsen (sowohl kurz- als auch langfristige Zinssätze) und Inflation auf die Geldnachfrage. Es wird diskutiert, wie diese Faktoren in das ökonometrische Modell integriert werden und welche Herausforderungen sich dabei stellen.
Welches Geldmengenaggregat wird verwendet und warum?
Die Analyse verwendet das breite Geldmengenaggregat M3. Diese Wahl wird mit der Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB) und technischen Aspekten begründet. Die Vor- und Nachteile im Vergleich zu nominalen Aggregaten und anderen Geldmengenaggregaten (M1, M2) werden ebenfalls erörtert.
Wie wird die Geldnachfrage modelliert?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Spezifikationen der Geldnachfragefunktion und diskutiert unterschiedliche Ansätze aus der Literatur zur Modellierung der Opportunitätskosten der Geldhaltung. Es wird zwischen realer und nominaler Geldnachfrage unterschieden, wobei die langfristige Neutralität des Geldes berücksichtigt wird.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Wahl und Spezifikation der Determinanten der Geldnachfragefunktion, ein Kapitel zur Analyse der Stabilitätseigenschaften dieser Determinanten (Einkommenselastizität, Zinselastizität, Inflationselastizität) und ein Fazit.
Welche Schlüsselkonzepte werden behandelt?
Schlüsselkonzepte umfassen die Geldnachfrage, die Europäische Zentralbank (EZB), Geldmengenaggregate (M1, M2, M3), reale und nominale Geldnachfrage, Elastizitäten (Zins-, Einkommens-, Inflationselastizität), Opportunitätskosten, Preisniveau, Bruttosozialprodukt (BSP) und ökonometrische Modellierung.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Das Hauptziel ist die Schätzung einer stabilen europäischen Geldnachfragefunktion und die Bestimmung der Einflüsse der untersuchten Determinanten. Die Arbeit bewertet verschiedene Spezifikationen und diskutiert die Stabilität der geschätzten Elastizitäten.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die theoretischen Grundlagen der Geldnachfrage, inklusive der Quantitätsgleichung und der Betrachtung des Geldes als Transaktionsmittel und Wertaufbewahrungsmittel. Die Bedeutung der Preisstabilität als vorrangiges Ziel der EZB wird hervorgehoben.
- Citation du texte
- Steffen Hoffmann (Auteur), 2006, Eigenschaften europäischer Geldnachfragefunktionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75174