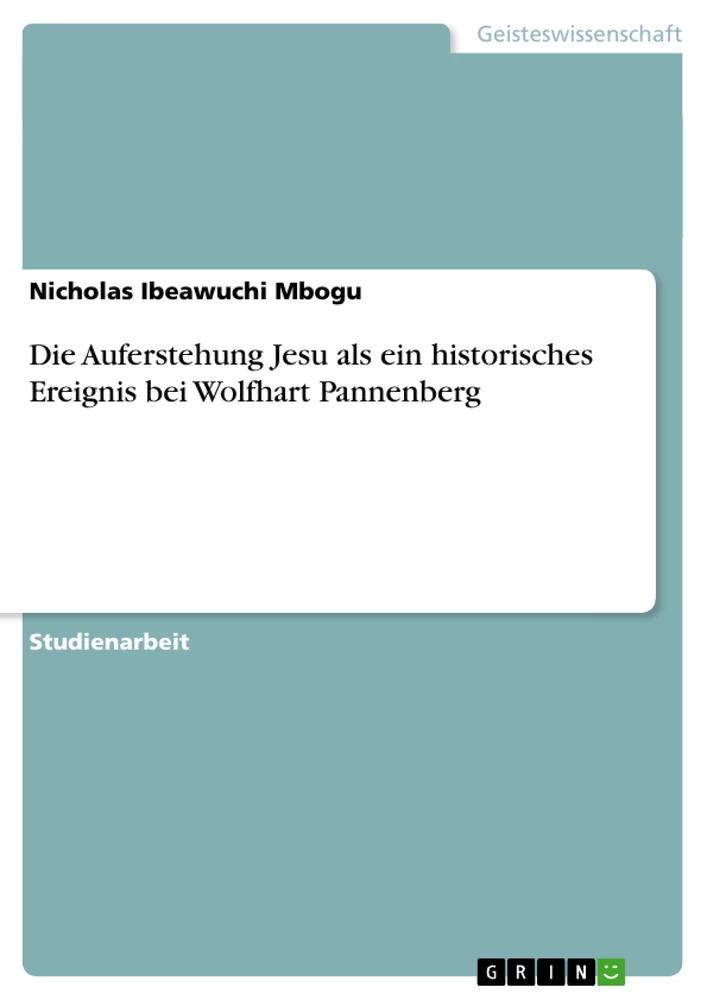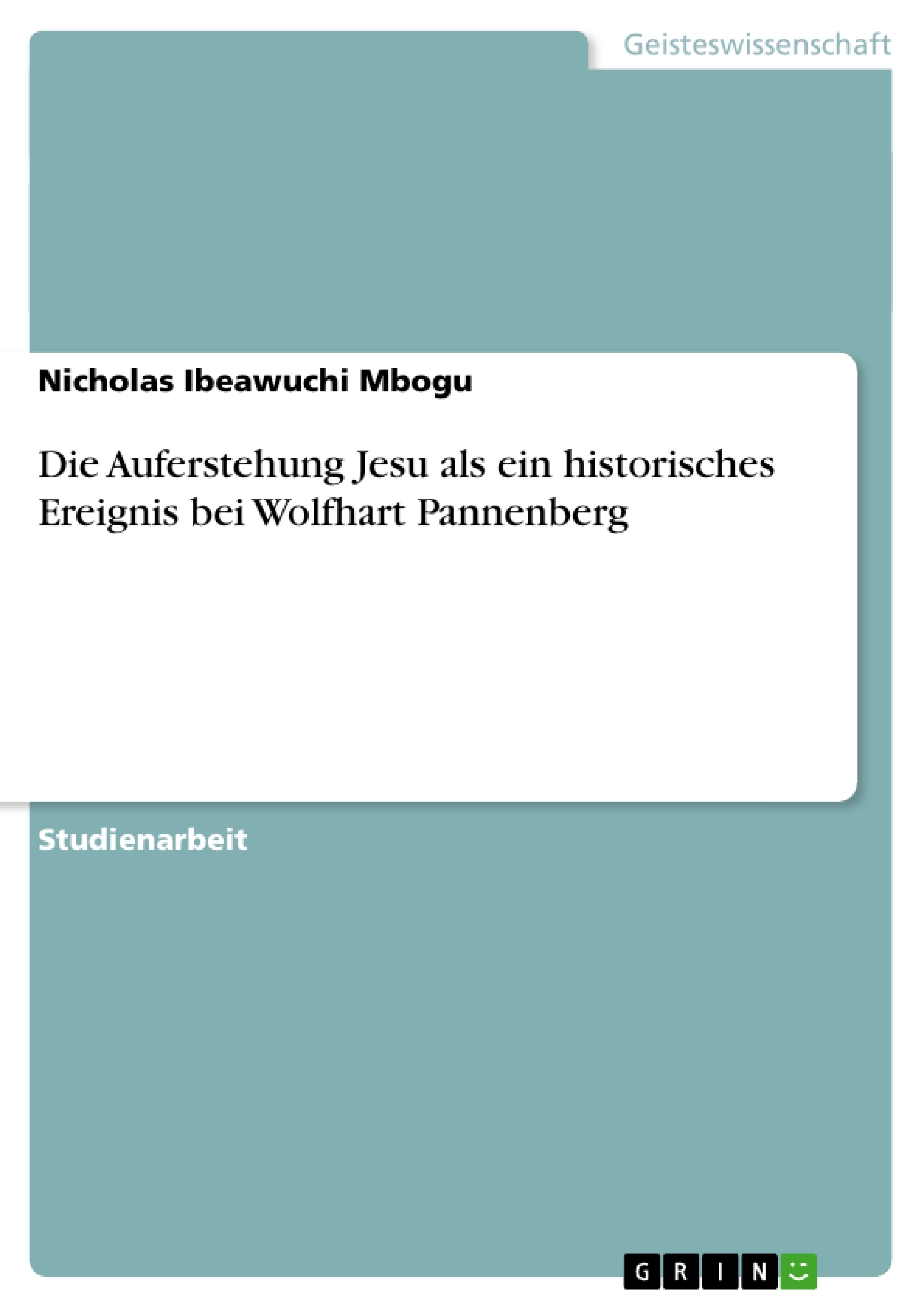Was meinen wir, wenn wir im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu von „historisch“ reden? Möglicherweise wollen wir mit dem Begriff „historisch“ kennzeichnen, dass ein Geschehen wirklich, d.h. zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte an einem konkreten Ort stattfand. In diesem Sinn verstehen wir Pannenbergs Behauptung, die Auferstehung Jesu sei historisch. Wolfhart Pannenberg lässt keinen Zweifel mit seinem Werk Offenbarung als Geschichte, dass Geschichte für ihn eine breitere Bedeutung hat als normal verstanden wird. Das theologische Interesse an der Historizität der Auferstehung besteht darin, dass die Überwindung des Todes durch das neue, eschatologische Leben tatsächlich stattgefunden hat. Historizität bedeutet nach Pannenberg nicht, dass das als historisch tatsächlich Behauptete zu dem sonst bekannten Geschehen analog sein muss, vielmehr beinhaltet es nicht mehr als dessen Tatsächlichkeit. So ist auch die Spannung zu der Andersartigkeit der eschatologischen Wirklichkeit auszuhalten. Das Verhältnis zwischen Glaube und Geschichte ist nach Pannenberg reich an Spannungen. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die Person Jesu von Nazareth und damit die Kenntnis vergangenen Geschehens und ihre Vergewisserung. Andererseits liegt aber das Interesse des Glaubens auf dem Handeln Gottes in dieser Geschichte. Dieses wurde in der historischen Wissenschaft vernachlässigt, und wird es auch heute. Ohne die Auferweckung Jesu hätte es weder die Missionsbotschaft der Apostel, noch auch eine auf die Person Jesu bezogene Christologie gegeben. Ohne dieses Ereignis wäre der Glaube der Christen nichtig. Es geht bei diesem Ereignis nicht nur um das In-Erscheinung-Treten eines neuen, ewigen Lebens. Es ist für den christlichen Glauben nicht gleichgültig, wer der war, der hier von den Toten auferweckt wurde, nämlich der Gekreuzigte. Es handelt sich auch nicht um irgendeinen Gekreuzigten, sondern um den gekreuzigten Jesus von Nazareth. Damit bleibt der christliche Osterglaube für alle Zeiten gebunden an die irdische Geschichte des Jesus von Nazareth. Die Auferweckung Jesu ist der Grund des christlichen Glaubens, aber nicht als isoliertes Ereignis, sondern in ihrem Rückbezug auf die irdische Sendung Jesu und seinen Kreuzestod. Dieses Ereignis ist von Jesus von Nazareth untrennbar, da die Auferweckung ja eben dem gekreuzigten Jesus widerfahren ist.
Inhaltsverzeichnis
- Erklärung der Begriffe
- Auferstehung
- Historizität
- Wolfhart Pannenberg und die Forschung um die Historizität der Auferstehung Jesu
- Das Verhältnis zwischen Glaube und Geschichte
- Pannenbergs These zur Historizität der Auferstehung Jesu
- Auffindung des leeren Grabes Jesu
- Die Erscheinungstradition
- Die Bedeutung der Auferstehung Jesu nach Pannenberg
- Kritik an der historisch-kritischen Exegese Pannenbergs
- Schlussgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Frage der Historizität der Auferstehung Jesu Christi aus der Sicht des Theologen Wolfhart Pannenberg. Der Autor analysiert Pannenbergs Argumentation, die auf der These beruht, dass die Auferstehung Jesu ein historisches Ereignis ist, das sich in der Zeit ereignet hat und nicht nur ein mythologisches Konzept.
- Die Bedeutung von Pannenbergs Konzept der Geschichte
- Die Interpretation der Auferstehung Jesu im Kontext der Geschichte
- Die Beziehung zwischen Glaube und Geschichte
- Die Rolle der historischen Forschung in der Theologie
- Die Kritik an der historisch-kritischen Exegese
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel des Textes beleuchtet die Begriffe "Auferstehung" und "Historizität" im Kontext der christlichen Theologie. Der Autor erklärt die Bedeutung des Auferstehungsgeschehens und wie Pannenberg den Begriff "Historizität" in seiner Analyse der Auferstehung Jesu verwendet.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Beitrag Pannenbergs zur Forschung um die Historizität der Auferstehung Jesu. Der Autor erläutert Pannenbergs Ansatz und seine Auseinandersetzung mit anderen Theologen.
Das dritte Kapitel beleuchtet das Verhältnis zwischen Glaube und Geschichte im Pannenbergschen Werk. Der Autor beschreibt Pannenbergs Verständnis von Geschichte und wie es in der christlichen Theologie zum Tragen kommt.
Das vierte Kapitel widmet sich Pannenbergs These zur Historizität der Auferstehung Jesu. Es werden die beiden zentralen Argumente Pannenbergs – die Auffindung des leeren Grabes und die Erscheinungstradition – beleuchtet.
Das fünfte Kapitel behandelt die Bedeutung der Auferstehung Jesu nach Pannenberg. Es wird gezeigt, wie Pannenberg die Auferstehung als Schlüsselereignis für die christliche Theologie betrachtet.
Das sechste Kapitel präsentiert verschiedene Kritikpunkte an Pannenbergs historisch-kritischer Exegese. Der Autor diskutiert die Einwände gegen Pannenbergs Argumentation und versucht, sie zu beantworten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Auferstehung Jesu, Historizität, Wolfhart Pannenberg, Glaube, Geschichte, Theologie, historisch-kritische Exegese, Erscheinungstradition, leeres Grab. Der Text beschäftigt sich mit der Frage, ob die Auferstehung Jesu ein historisches Ereignis ist, das wissenschaftlich untersucht und bewiesen werden kann.
Häufig gestellte Fragen
Was meint Wolfhart Pannenberg mit der „Historizität“ der Auferstehung?
Pannenberg behauptet, dass die Auferstehung Jesu ein tatsächliches, in der Geschichte stattgefundenes Ereignis ist, das nicht nur symbolisch oder mythologisch zu verstehen ist.
Warum ist das leere Grab für Pannenberg ein wichtiges Argument?
Das Auffinden des leeren Grabes dient ihm als historischer Anhaltspunkt, der die Tatsächlichkeit der Auferweckung stützt.
Wie hängen Glaube und Geschichte bei Pannenberg zusammen?
Nach Pannenberg basiert der christliche Glaube auf historischen Tatsachen; ohne die reale Auferweckung wäre der Glaube nichtig.
Was versteht Pannenberg unter „Offenbarung als Geschichte“?
Er vertritt die These, dass Gott sich nicht durch übernatürliche Eingriffe, sondern in und durch die geschichtlichen Ereignisse selbst offenbart.
Welche Rolle spielt die Erscheinungstradition?
Die Berichte über die Erscheinungen des Auferstandenen sind für Pannenberg wesentliche historische Zeugnisse, die das Ereignis verifizieren.
- Quote paper
- Dr. Nicholas Ibeawuchi Mbogu (Author), 2005, Die Auferstehung Jesu als ein historisches Ereignis bei Wolfhart Pannenberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75281