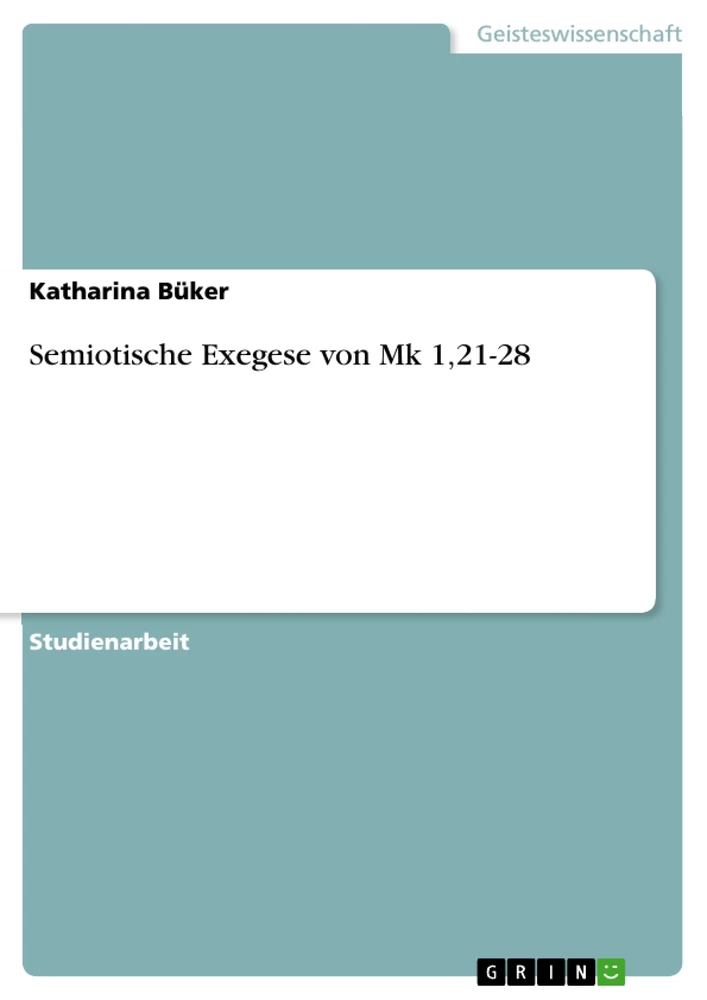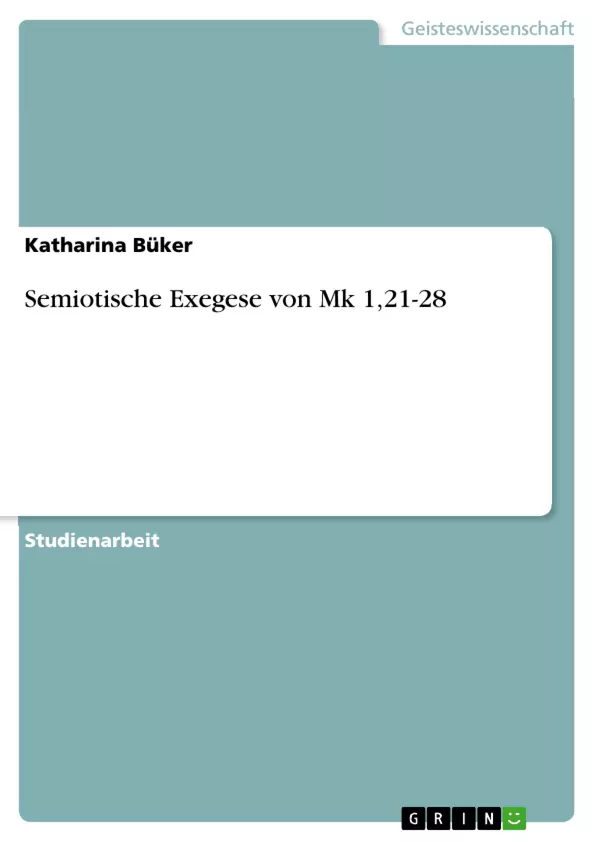„Ein Text ist ein syntaktisch-semantisch-pragmatisches Kunstwerk, an dessengenerativer Planung die vorgesehene Interpretation bereits teilhat.“
Auf diese Erkenntnis baut die Methodik der semiotischen Exegese auf, mit welcher ich mich in der vorliegenden Proseminararbeit auseinander setzen möchte.
Das Arbeiten im Seminar mit dieser Methode ließ mich neugierig werden und ich wollte selbst einmal ausprobieren, ob Texte wirklich derartig viel „Eigenleben“ besitzen, wie die Theorie der semiotischen Exegese es mir im Seminar versprochen hatte.
Bei diesem Verfahren geht es darum, einen eigenen Text zu konstruieren, um daraufhin zu verstehen, was er mit seiner Zeichenzusammenstellung aussagen will. Man ist nicht darauf aus, welche Intention der Autor beim Verfassen der Erzählung hatte, sondern wird bei der semiotischen Exegese davon ausgegangen, dass es mehrere Interpretationsmöglichkeiten gibt und nicht nur die eine. Sie versteht die Texte als Zeichenzusammenhänge und will dabei herausfinden, was die Zeichen selbst für einen Textsinn wiedergeben. Die Grundlage dafür bietet Charles Sanders Peirce mit seinem triadischen Zeichenmodell, welches auf dessen Kategorienlehre aufbaut.
Jeder Text hat, der semiotischen Exegese nach, des weiteren ein eigenes Diskursuniversum. Er stammt folglich aus einer eigenen, fremden Welt, in der andere Gesetze herrschen. Es gilt, diese Fremdheit des Textes zu beachten und ernst zu nehmen, um ihn für sich vollends verstehen zu können. Die einzelnen Zeichen werden bei der semiotischen Exegese (u.a. nach Charles Morris) auf drei unterschiedlichen Betrachtungsweisen hin untersucht. Bei der Intra-, Inter- und Extratextualität wird das Zeichen jeweils hinsichtlich seiner syntagmatischen, semantischen und pragmatischen Eigenschaften betrachtet.
Als zu bearbeitende Textstelle habe ich Mk 1,21-28 gewählt. Diese Perikope behandelt eine Exorzismusgeschichte Jesu. Ich denke, dass eine derartige Erzählung hinsichtlich der semiotischen Exegese sehr interessant sein wird und zudem eine besondere Herausforderung stellt, da es sich bei der Textstelle ja um eine Wundertat Jesu handelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Textkritik
- 2.1 Bibelstelle Mk 1, 21
- 2.1.1 Problemdarstellung...
- 2.1.2 Äußere Textkritik
- 2.1.3 Auswertung
- 2.1.4 Innere Textkritik.
- 2.1.5 Auswertung..
- 2.1.6 Gesamturteil
- 2.1.7 Gegenprobe
- 2.2 Bibelstelle Mk 1, 25
- 2.2.1 Problemdarstellung.
- 2.2.2 Äußere Textkritik
- 2.2.3 Auswertung...
- 2.2.4 Innere Textkritik.
- 2.2.5 Auswertung...
- 2.2.6 Gesamturteil
- 2.2.7 Gegenprobe.
- 2.3 Bibelstelle Mk 1, 26
- 2.3.1 Problemdarstellung.
- 2.3.2 Äußere Textkritik
- 2.3.3 Auswertung..
- 2.3.4 Innere Textkritik.
- 2.3.5 Auswertung..
- 2.3.6 Gesamturteil
- 2.3.7 Gegenprobe..........\n
- 2.4 Bibelstelle Mk 1, 27
- 2.4.1 Problemdarstellung.
- 2.4.2 Äußere Textkritik
- 2.4.3 Auswertung...
- 22.4.4 Innere Textkritik.
- 2.4.5 Auswertung...
- 2.4.6 Gesamturteil
- 2.4.7 Gegenprobe...\n
- 2.1 Bibelstelle Mk 1, 21
- 3 Intratextuelle Analyse
- 3.1 Textpartitur.
- 3.1.1 Auswertung..
- 3.2 Syntagmatische Analyse.....
- 3.2.1 Syntagmatik des Mikrotextes
- 3.2.2 Syntagmatik des Makrotextes.
- 3.2.3 Ergebnis.....
- 3.3 Semantische Analyse.....
- 3.3.1 Semantik des Mikrotextes
- 3.3.2 Semantik des Makrotextes....
- 3.3.3 Enzyklopädische Semantik.......
- 3.4 Pragmatik.……………………….
- 3.4.1 Reflexion der bisherigen Arbeitsschritte.
- 3.4.2 Ideologie des Textes ......
- 3.4.3 Evaluation...\n
- 4 Intertextuelle Analyse
- 4.1 Poetische Intertextualität.
- 5 Zusammenfassung der Kapitel
- 6 Übersetzung von Mk 1,21-28.
- 7 Hilfsmittel..
- 7.1 Literaturverzeichnis.
- 7.2 Weiterführende Literatur.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Proseminararbeit widmet sich der Anwendung der semiotischen Exegese auf den biblischen Text Mk 1,21-28, eine Perikope über einen Exorzismus Jesu. Die Arbeit zielt darauf ab, die Methodik der semiotischen Exegese zu veranschaulichen und zu erforschen, wie die Textstelle als ein Zeichensystem mit eigenem Diskursuniversum verstanden werden kann.
- Analyse der Textstelle Mk 1,21-28 unter Verwendung der semiotischen Exegese
- Untersuchung des Textes als Zeichensystem mit eigenem Diskursuniversum
- Erforschung der syntagmatischen, semantischen und pragmatischen Eigenschaften des Textes
- Identifizierung und Interpretation von intertextuellen Bezügen
- Zusammenfassende Interpretation der Textstelle im Kontext der semiotischen Exegese
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die semiotische Exegese als Methode vorstellt und die Forschungsfrage und das Ziel der Arbeit definiert. Kapitel 2 befasst sich mit der Textkritik der Perikope Mk 1,21-28, wobei die einzelnen Verse hinsichtlich ihrer äußeren und inneren Textkritik analysiert werden. Kapitel 3 widmet sich der intratextuellen Analyse, die die syntagmatischen, semantischen und pragmatischen Aspekte des Textes untersucht. Kapitel 4 befasst sich mit der intertextuellen Analyse, wobei die Beziehung des Textes zu anderen Texten, insbesondere aus der Bibel, untersucht wird. Das Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und interpretiert die Textstelle im Kontext der semiotischen Exegese.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themengebiete der semiotischen Exegese, Textkritik, Intratextuelle Analyse, Intertextuelle Analyse, Exorzismus, Wundertat Jesu, Markusevangelium, Diskursuniversum und Zeichenmodell.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer semiotischen Exegese?
Ziel ist es, einen biblischen Text als Zeichensystem zu verstehen und den Sinn aus der Zusammenstellung der Zeichen selbst zu ermitteln, statt nach der ursprünglichen Intention des Autors zu suchen.
Welche biblische Textstelle wird in dieser Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert Mk 1,21-28, eine Perikope aus dem Markusevangelium, die von einer Exorzismusgeschichte Jesu handelt.
Was bedeutet „Intratextuelle Analyse“?
Sie untersucht die syntagmatischen (Satzbau), semantischen (Bedeutung) und pragmatischen (Wirkung) Eigenschaften innerhalb des Textes selbst.
Welche Rolle spielt Charles Sanders Peirce für diese Methode?
Sein triadisches Zeichenmodell und seine Kategorienlehre bilden die theoretische Grundlage für das Verständnis des Textes als komplexes Zeichensystem.
Was versteht man unter dem „Diskursuniversum“ eines Textes?
Jeder Text stammt aus einer eigenen Welt mit eigenen Gesetzen. Die semiotische Exegese nimmt diese Fremdheit ernst, um den Text vollends zu verstehen.
- Arbeit zitieren
- Katharina Büker (Autor:in), 2006, Semiotische Exegese von Mk 1,21-28, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75302