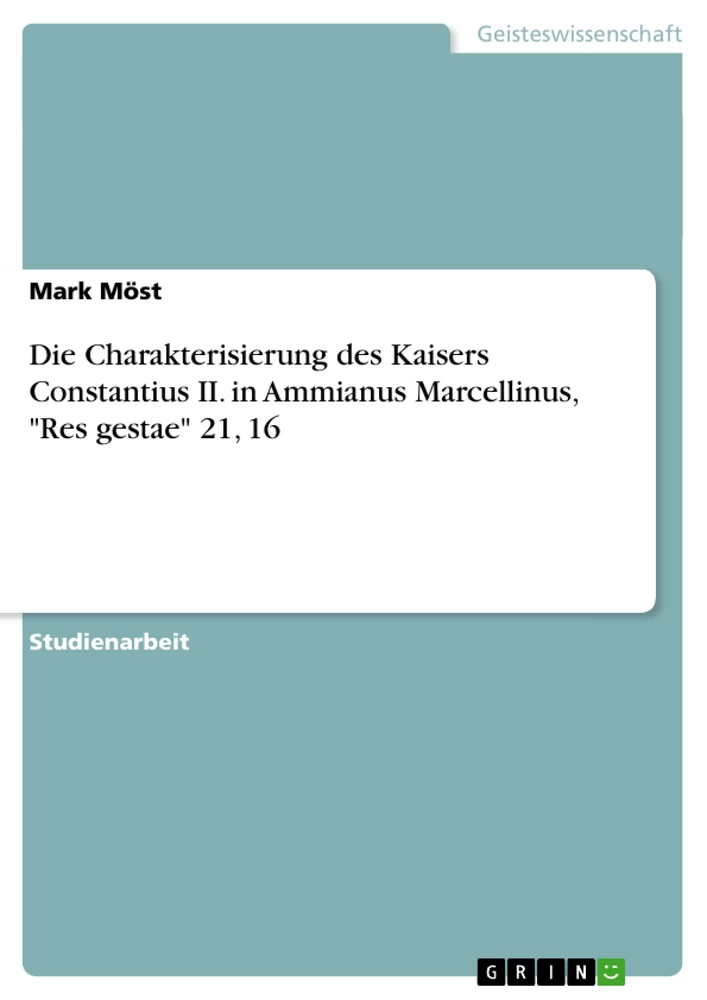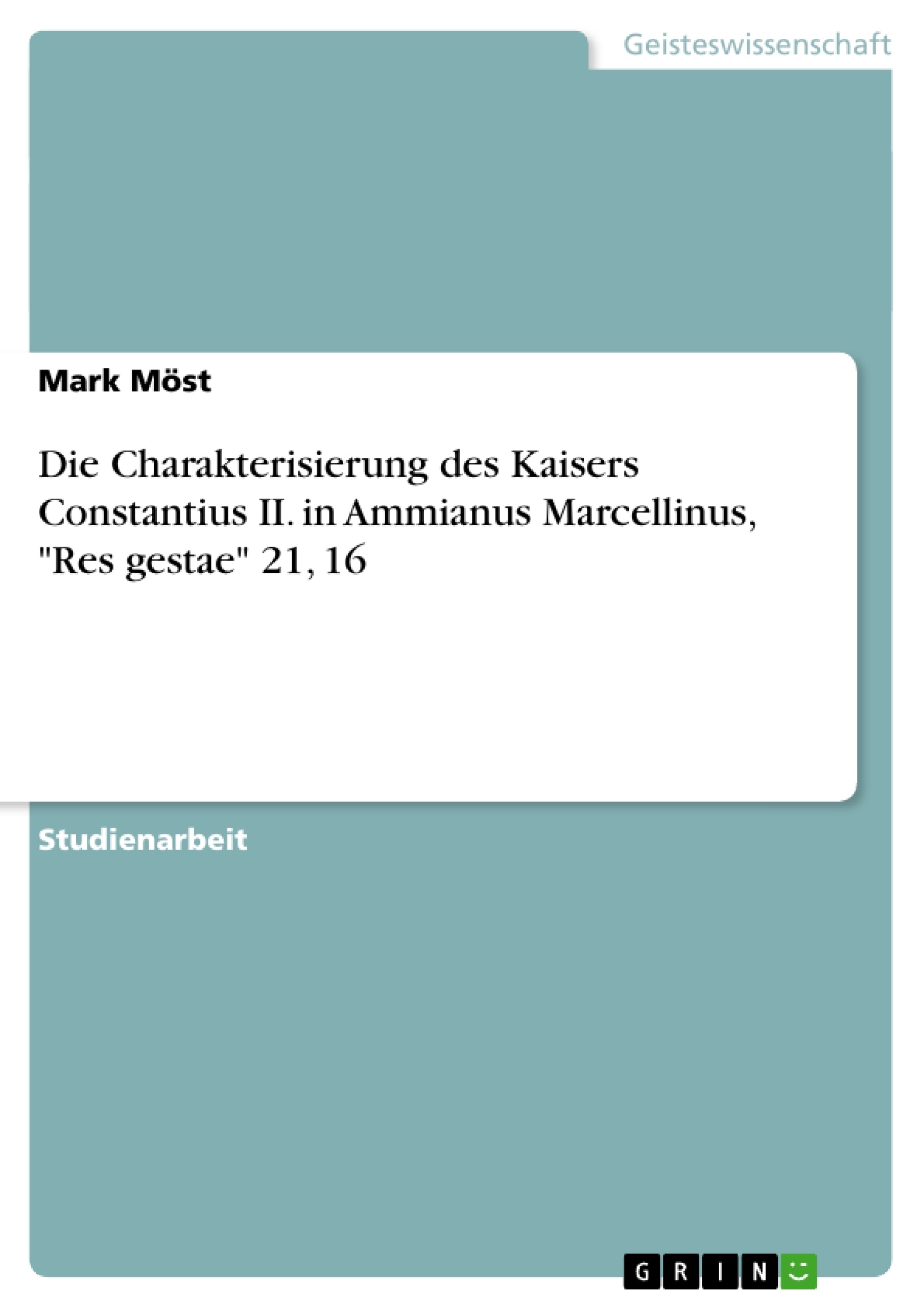(§§ 1-4) Also wird es jetzt angebracht sein, unter wirklicher Bewahrung der Unterschiede zwischen seinen positiven und seinen negativen Eigenschaften die herausragendsten der ersteren darzustellen. Indem er die Hoheit der kaiserlichen Macht überall bewahrte, verachtete er die Volkstümlichkeit erhabenen und großen Sinnes, war ungemein sparsam bei der Verleihung höherer Würden, duldete nicht, daß viel rund um die Vermehrung der Verwaltungen erneuert wurde bis auf Weniges und begünstigte niemals den Hochmut der Militärs. Auch wurde unter ihm kein Führer zum Clarissimat befördert. Sie waren nämlich, wie auch ich mich erinnere, nur Perfectissimi. Und es begegnete einem Heermeister kein Provinzstatthalter, und er gestattete nicht, daß von diesem eine zivile Aufgabe angerührt wurde. Aber alle militärischen und zivilen Machthaber blickten immer zu den Prätorianerpräfekten nach der Sitte alter Ehrerbietung wie zum Gipfel aller Ehren. Bei der Behandlung der Soldaten war er allzu vorsichtig, ein manchmal übergenauer Untersucher der Verdienste, der die kaiserlichen Würden gewissermaßen wie nach der Goldwaage verlieh, und unter seiner Herrschaft wurde niemand plötzlich oder unbekannt eingesetzt, um irgendeinen hohen Posten im Palast zu besetzen, sondern derjenige, der nach einem Jahrzehnt seiner Ämterlaufbahn das Amt eines Marschalls oder eines Schatzmeisters oder irgendetwas Ähnliches bekleiden sollte, war wohlbekannt. Und sehr selten ereignete es sich, daß irgendjemand von den Militärs zur Verwaltung ziviler Angelegenheiten überging; dagegen wurden nur Männer, die im Kriegsstaub sich abgehärtet hatten, den Bewaffneten an die Spitze gestellt. Er war ein eifriger Arbeiter in den Wissenschaften, aber er brachte nach dem Übergang zur Verskunst nichts zustande, was der Mühe wert gewesen wäre, weil er in der Rhetorik durch seine schwache Begabung im Stich gelassen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Übersetzung von 21, 16 (in Auswahl)
- Überblick über die Charakterisierung von Gallus, Constantius und Julian bei Ammian
- Die Charakterisierung des Constantius in 21, 16 (in Auswahl)
- Situierung und Gliederung von 21, 16
- Zur Form und Stellung von 21, 16
- Interpretation von 21, 16 (in Auswahl)
- Darstellung der bona.
- Darstellung der vitia
- Beschreibung des äußeren Erscheinungsbildes
- Constantius II. im Licht der antiken Geschichtsschreibung und der althistorischen Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Charakterisierung des Kaisers Constantius II. durch Ammianus Marcellinus. Sie analysiert ausgewählte Paragraphen aus Buch 21 der Res gestae und vergleicht Ammians Urteil mit der Parallelüberlieferung und den Ergebnissen der althistorischen Forschung. Die Arbeit strebt danach, sowohl literaturwissenschaftliche als auch geschichtswissenschaftliche Aspekte zu berücksichtigen.
- Die Darstellung von Constantius II. in Ammianus Marcellinus, Res gestae 21, 16
- Vergleich der Charakterisierung mit anderen Darstellungen des Kaisers
- Analyse von Ammians literarischen Methoden
- Einordnung der Charakterisierung in den historischen Kontext
- Bewertung der historischen Genauigkeit von Ammians Darstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Übersetzung von ausgewählten Paragraphen aus Buch 21, 16 der Res gestae. Anschließend wird ein Überblick über Ammians Charakterisierung von Gallus, Constantius und Julian gegeben. Im Fokus steht dann die detaillierte Analyse von 21, 16, die sich mit der Situierung, Gliederung und Interpretation des Textes befasst. Die Arbeit beleuchtet dabei sowohl die positiven als auch die negativen Eigenschaften, die Ammianus Constantius zuschreibt.
Schlüsselwörter
Ammianus Marcellinus, Res gestae, Constantius II., Kaiser, Charakterisierung, antike Geschichtsschreibung, althistorische Forschung, Literaturwissenschaft, Geschichte, spätantike Literatur.
- Quote paper
- Mark Möst (Author), 2003, Die Charakterisierung des Kaisers Constantius II. in Ammianus Marcellinus, "Res gestae" 21, 16, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75315