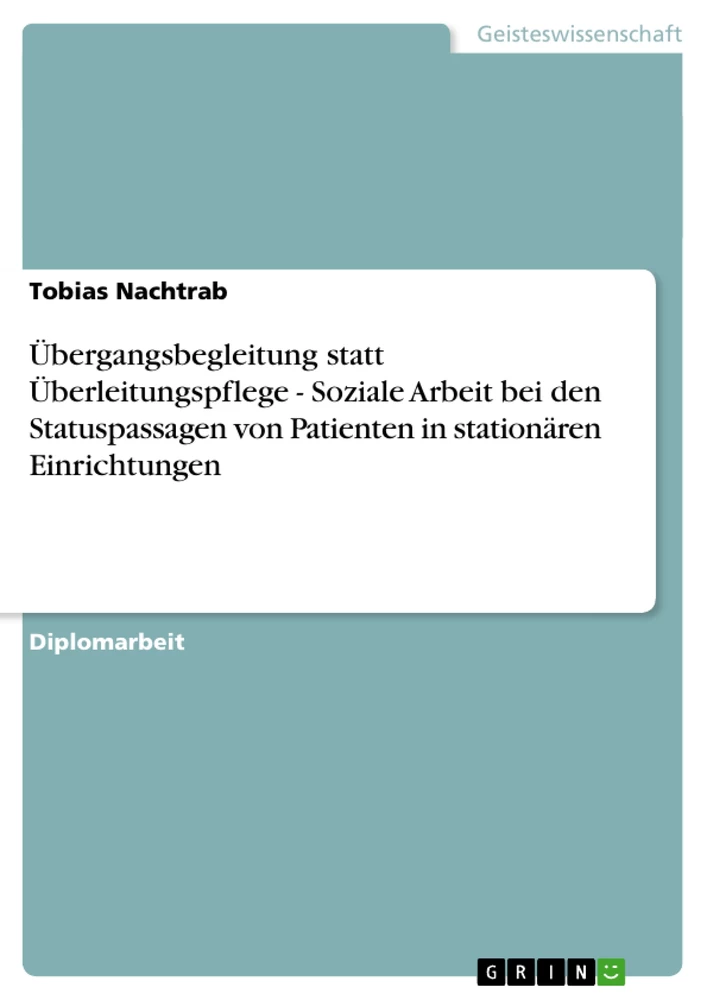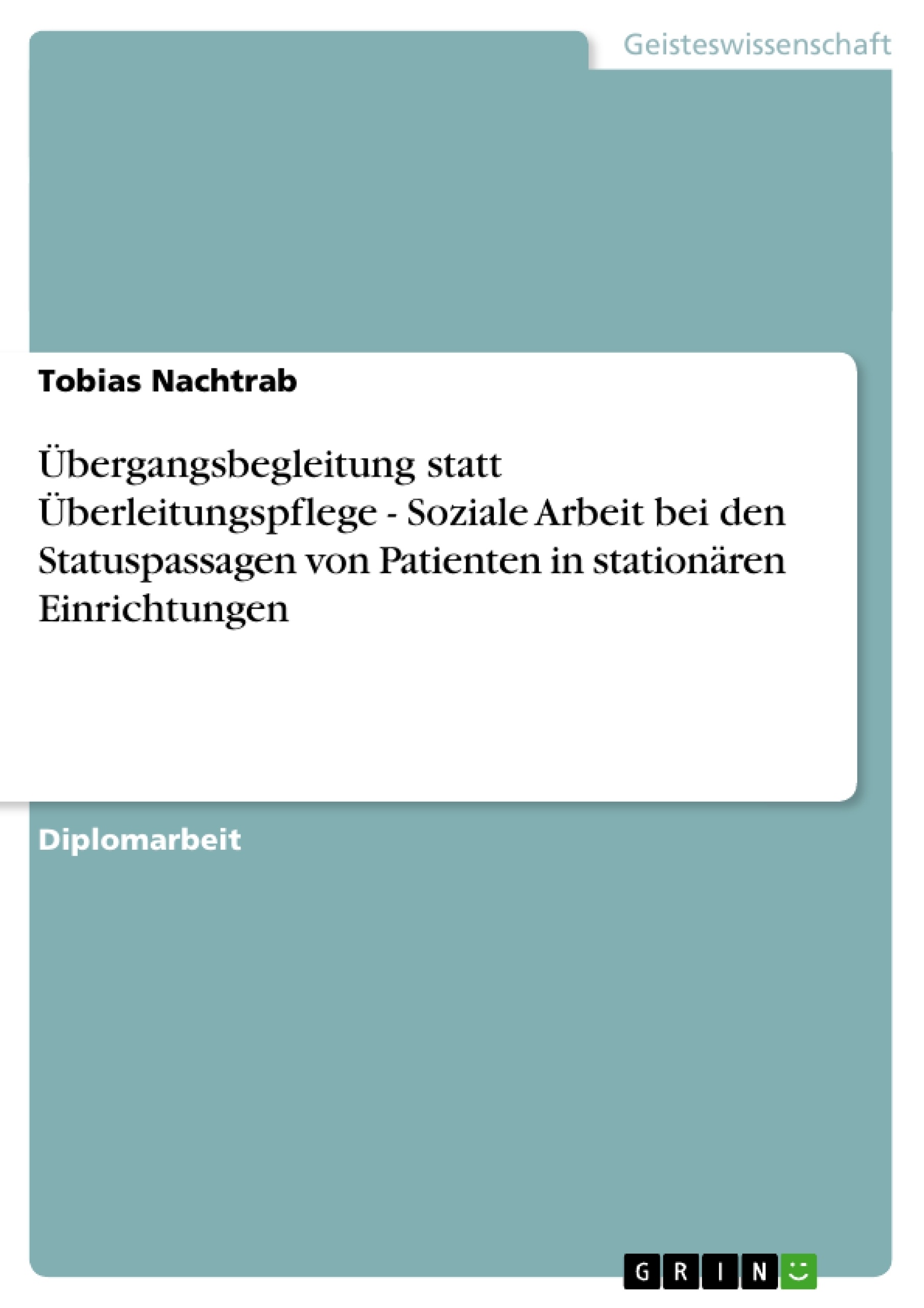Die Gesundheit ist das höchste Gut in einer leistungsorientierten Zeit. Sie ist die Voraussetzung für den Arbeitnehmer, seine Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Jedoch ist die Krankheit ein Bestandteil von Gesundheit und in der ganzheitlichen Betrachtungsweise des Menschen ein Alarmsignal des Körpers. Es ist die Reaktion eines komplexen biochemischen Systems, welches adaptiv auf eine veränderte Umwelt reagiert. Eine zunehmende Überforderung oder auch Unfähigkeit dieses Systems lässt jedoch Krankheitsbilder auftreten, welche medizinische aber auch zu einem nicht unerheblichen Teil sozialpsychologische Intervention benötigen.
Mit Einführung der Diagnosis Related Groups (DRG) wurde die Pflegeüberleitung (oder auch Überleitungspflege, Übergangspflege oder Brückenpflege genannt) eingerichtet. Sie soll den Prozess von stationärer nach ambulanter Verlegung administrativ begleiten und im interdisziplinären Kontext der Professionen und Gruppen von Arzt, Pflegeteam, Patient und Angehörige stattfinden.
An dieser Stelle soll aber nur eine erste Formulierung der Übergangsbegleitung abgegeben sein. Frau Hecht wird diese präzisieren und am konkreten auf die spezifischen Anforderungen im Arbeitsfeld an der Schnittstelle zwischen ambulanten Pflegdienst und Krankenhaus für die Soziale Arbeit anpassen. Ein Fazit dieser Diplomarbeit, welche durch seine Zweiteilung einen größeren Rahmen erfassen soll, kann am Ende des 1. Teils nur innerhalb des Rahmens der Wissensansammlung und an der Prozessanalyse und Kompetenz-Performanz Betrachtung erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Präambel
- 1. Einleitung
- 2. Ist-Analyse
- 2.1. SACHVERSTÄNDIGENRAT für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen
- 2.2. Die Reform in Gesundheit und Politik
- 2.2.1. Demografie-Sozialsysteme
- 2.2.2. Demografie-Bevölkerungsentwicklung
- 3. Grundlagen im Gesundheitswesen
- 3.1. Kennzahlen der Krankenhausversorgung
- 3.2. Gesetzliche Verankerungen
- 3.2.1. § 140 SGB V „Integrierte Versorgung“
- 3.2.2. § 17a Krankenhausfinanzierungsgesetz
- 3.2.3. § 17 b Krankenhausfinanzierungsgesetz
- 3.2.4. Koalitionsvertrag
- 3.2.5. Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG)
- 3.3. DRG`s - Diagnosis Related Groups
- 3.3.1. Abrechnung nach den DRG's
- 3.3.2. Folgen der DRG`s
- 3.3.3. Nachbarländer und das DRG-System
- 4. Die Pflegeüberleitung
- 4.1. Die Idee der Pflegeüberleitung
- 4.2. Zielgruppen der Pflegeüberleitung
- 4.3. Zielstellung / Ablauf der Pflegeüberleitung
- 4.3.1. Initiales Assessment
- 4.3.2. Differenziertes Assessment
- 4.3.3. Verschiedenste Assessments
- 4.3.4. Zielformulierung und -planung
- 4.3.5. Näheres zu FIM (Functional Independence Measure)
- 4.4.6. Näheres zu den ATL's
- 4.4. Prozessmethodik
- 4.4.1. Prozessmethodische Merkmale
- 4.4.2. Prozess-Schnittstellen
- 4.4.3. Prozesse
- 4.4.4. Visualisierung von Prozessen
- 4.4.5. Patientenpfade
- 4.4.6. Statuspassagen
- 4.4.7. Anfangs- und Endpunkte der Pflegeüberleitung
- 4.5. Vorhandene Strukturen
- 4.5.1. Der Expertenstandard „Pflegeüberleitung“
- 4.5.2. Die Pflegeüberleitung
- 4.5.3. Der Sozialdienst
- 4.5.4. Verdrängungswettbewerb
- 4.5.5. Ethik des Helfens in der Pflege
- 4.7. Analyse Pflegeüberleitung/Überleitungspflege
- 4.7.1. Dokumentationsanalyse
- 4.7.2. Begriffsklärung
- 4.7.3. Fazit
- 5. Die Komponente Soziale Arbeit
- 5.1. Standpunktbestimmung
- 5.1.1. Sozialpädagogische Berufsethik
- 5.1.2. Professionelles Handeln
- 5.2. Aufgaben der Sozialarbeit
- 5.3. Ablauf der Prozesse im stationären Bereich
- 5.3.1. Prozessanalyse für die Übergangsbegleitung
- 5.3.2. Interventionsebenen
- 5.3.3. Prozess Beratung
- 5.3.4. Prozess Begleitung
- 5.3.5. Prozess Betreuung
- 5.3.6. Prozess Bildung
- 5.4. Herleitung von erforderlichen Kompetenzen für die Übergangsbegleitung
- 5.4.1. Das Kompetenzmodell
- 5.4.3. Ressourcen-Kompetenz-Performanz-Modell
- 5.6. Performanz bei der Übergangsbegleitung
- Gemeinsame Performanz
- Überschneidungsbereiche Übergangsbegleitung und Pflegeüberleitung
- Kernaufgaben der Übergangsbegleitung
- Kernaufgaben der Pflegeüberleitung
- Fazit: Pflege näher am Patienten – Kritische Hinterfragung
- 5.7. Systemische Betrachtung - Im Kontext der Familie
- 5.1. Standpunktbestimmung
- 6. Synthese zur Übergangsbegleitung
- 6.1. Zitiert aus der Fachliteratur
- 6.1.1. Schnittstellen
- 6.1.2. Fallbeispiel- Folgerungen im Kontext der Übergangsbegleitung
- 6.2. Zielformulierung der Übergangsbegleitung
- 6.2.1. Der Pflegerische Teil bei der Übergangsbegleitung
- 6.2.2. Der Soziale Teil bei der Übergangsbegleitung
- 6.3. Fazit: Der Übergangs- Manager
- 6.1. Zitiert aus der Fachliteratur
- 7. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die Rolle der sozialen Arbeit bei der Begleitung von Patienten in stationären Einrichtungen während des Übergangs von der stationären in die ambulante Versorgung. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Gestaltung von Übergangsbegleitung im Kontext von Demografie, Gesundheitsreform und DRG-System verbunden sind. Die Arbeit befasst sich mit den aktuellen Strukturen und Prozessen der Pflegeüberleitung sowie den Kompetenzen, die für eine effektive Übergangsbegleitung erforderlich sind.
- Analyse des Status quo der Pflegeüberleitung und der Rolle der sozialen Arbeit
- Bewertung der aktuellen Strukturen und Prozesse im Kontext der Gesundheitsreform
- Entwicklung eines Modells für die Übergangsbegleitung im Kontext der sozialen Arbeit
- Identifikation der notwendigen Kompetenzen für die Übergangsbegleitung
- Diskussion der systemischen Dimension der Übergangsbegleitung im Kontext der Familie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Das Kapitel stellt die Relevanz des Themas Übergangsbegleitung im Gesundheitswesen dar und skizziert den Forschungsstand sowie die Fragestellungen der Arbeit.
- Kapitel 2: Ist-Analyse - Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Situation in Bezug auf die Pflegeüberleitung und die Rolle des SACHVERSTÄNDIGENRATES sowie die Auswirkungen der Gesundheitsreform auf die Übergangsbegleitung.
- Kapitel 3: Grundlagen im Gesundheitswesen - Dieses Kapitel beleuchtet die Kennzahlen der Krankenhausversorgung, die gesetzlichen Verankerungen der Pflegeüberleitung und die Bedeutung der DRG-Systematik für den Prozess.
- Kapitel 4: Die Pflegeüberleitung - Dieses Kapitel beschreibt die Idee, die Zielgruppen und den Ablauf der Pflegeüberleitung, inklusive der verschiedenen Assessments und der Prozessmethodik.
- Kapitel 5: Die Komponente Soziale Arbeit - Dieses Kapitel untersucht die Rolle der sozialen Arbeit bei der Übergangsbegleitung, die Aufgaben und Prozesse sowie die notwendigen Kompetenzen für die erfolgreiche Begleitung von Patienten.
- Kapitel 6: Synthese zur Übergangsbegleitung - Dieses Kapitel fasst die Erkenntnisse aus der Analyse der Pflegeüberleitung und der Rolle der sozialen Arbeit zusammen und entwickelt ein Modell für die Übergangsbegleitung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Diplomarbeit sind Übergangsbegleitung, Pflegeüberleitung, Soziale Arbeit, Gesundheitswesen, DRG-System, Demografie, Kompetenzmodell, Systemische Betrachtung und Patientenorientierung. Diese Schlüsselbegriffe verdeutlichen die interdisziplinären Aspekte der Arbeit und die Relevanz der Übergangsbegleitung im Kontext der modernen Gesundheitsversorgung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Pflegeüberleitung und Übergangsbegleitung?
Während die Pflegeüberleitung oft administrativ-pflegerisch fokussiert ist, betont die Übergangsbegleitung die ganzheitliche psycho-soziale Unterstützung durch die Soziale Arbeit.
Welchen Einfluss haben DRGs auf die Patientenentlassung?
Diagnosis Related Groups (DRGs) führen oft zu kürzeren Liegezeiten im Krankenhaus, was die Notwendigkeit einer effizienten Planung des Übergangs in die ambulante Pflege erhöht.
Was ist die Aufgabe des Sozialdienstes im Krankenhaus?
Der Sozialdienst berät Patienten und Angehörige zu rechtlichen, finanziellen und häuslichen Fragen, um die Versorgung nach dem Klinikaufenthalt sicherzustellen.
Warum ist eine systemische Betrachtung der Familie wichtig?
Weil die Erkrankung eines Mitglieds das gesamte Familiensystem beeinflusst und die häusliche Pflege oft nur durch die Einbindung der Angehörigen gelingen kann.
Was bedeutet „Initiales Assessment“?
Es ist die erste Einschätzung des Pflege- und Unterstützungsbedarfs eines Patienten direkt bei oder kurz nach der Aufnahme im Krankenhaus.
Welche Kompetenzen benötigt ein Übergangs-Manager?
Er benötigt medizinisches Grundwissen, Kenntnisse im Sozialrecht, Beratungskompetenz sowie Fähigkeiten im Schnittstellenmanagement zwischen verschiedenen Professionen.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Sozialpädagoge Tobias Nachtrab (Autor:in), 2006, Übergangsbegleitung statt Überleitungspflege - Soziale Arbeit bei den Statuspassagen von Patienten in stationären Einrichtungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75326