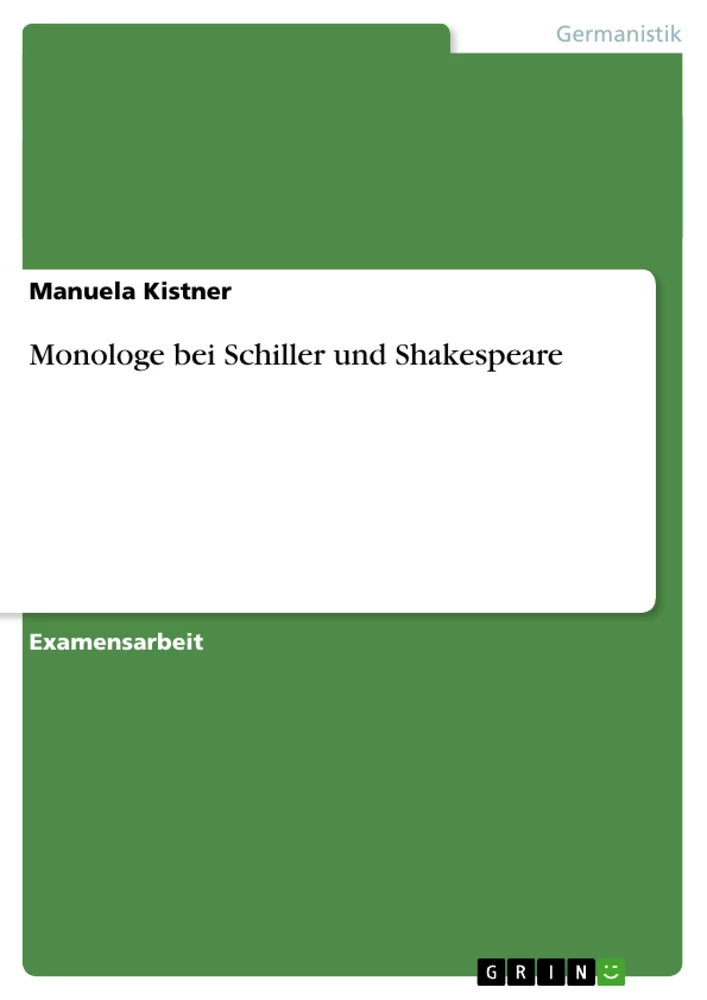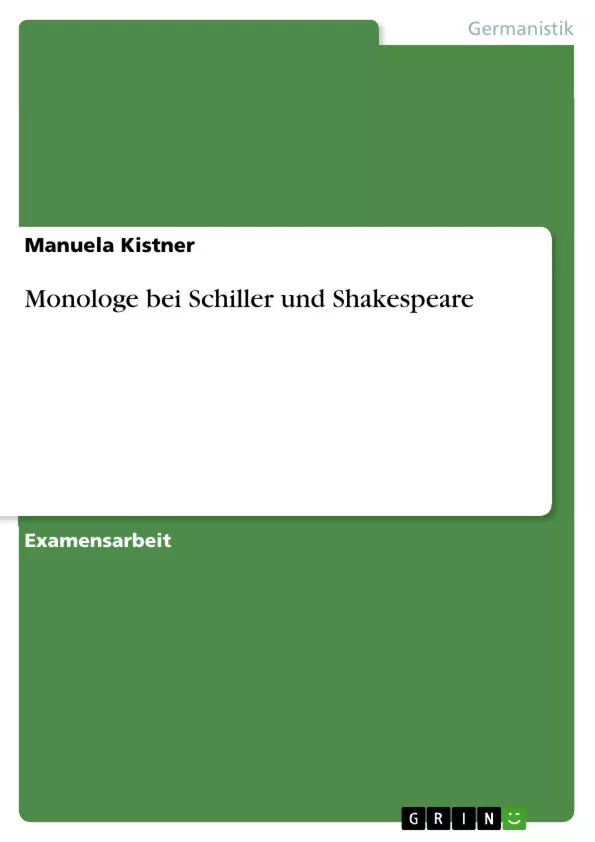„Monologe sind lauter Atemzüge der Seele.“ (Friedrich Hebbel )
Wer hat sich nicht schon einmal selbst dabei ertappt, einen – zumindest gedanklichen – Monolog gehalten zu haben? Einen Monolog in einer Situation, die eine Entscheidung erforderte? Eine Entscheidung, bei der es nicht möglich war, sie einfach aus dem hohlen Bauch heraus zu treffen, sondern sie statt dessen abzuwägen? Einen Monolog, der uns selbst verdeutlicht, in welcher Situation wir uns befinden? Eine Situation, über die wir uns nur dann klar werden können, wenn wir über sie reflektieren? Wahrscheinlich jeder! Denn Monologe sind etwas, was wir tagtäglich tun, teilweise auch ohne uns darüber bewusst zu sein. Monologe sind etwas, das uns in bestimmten Situationen helfen kann. Monologe sind Ausdruck unseres Inneren, die anderen verborgen bleiben; sie sind eben `Atemzüge unserer Seele´.
In der Literatur sind Monologe ein beliebtes Mittel, um eine Situation, ein Vorhaben oder gar Ängste von Figuren hervorzuheben, welchen anderen – abgesehen vom Leser – verborgen sind. Denkt man an die deutsche Literatur der Vergangenheit, fallen einem sofort Autoren, wie Schiller und Goethe ein, deren Werke maßgeblich für die weitere Entwicklung der Literatur waren. Denkt man im Spezielleren an die Werke Schillers, hört man förmlich seine Figuren `sprechen´, denn die Monologe seiner Figuren gehören zu den bekanntesten überhaupt, vor allem Tells „Durch diese hohle Gasse muss er kommen...“ oder Wallensteins „Wär’s möglich? Könnt‘ ich nicht mehr, wie ich wollte?“. Auch in der englischen Literatur finden sich Autoren, die eine vergleichbare Wirkung hatten und noch immer haben: So vor allem Shelley und Shakespeare, bei dessen Nennung nahezu jedem unwillkürlich die Hexen von Macbeth einfallen, die den gleichnamigen Helden des Werks dazu verleiten, zum Königsmörder zu werden, so dass dieser im Anschluss an den begangenen Mord von Wahnvorstellungen heimgesucht wird und mit diesen Erscheinungen sogar spricht; seine Worte „If it were done when `tis done“ und „Is this a dagger which I see before me“ eröffnen ebenfalls einen Monolog.
Die vorliegende Studie beschäftigt sich vor allem mit Monologen Schillers, teilweise jedoch auch mit denen Shakespeares und soll zeigen, ob und wenn ja, inwiefern sich Schiller von Shakespeare in seinen Werken beeinflussen ließ.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Untersuchung der Monologe
- 1.1 Wallenstein und Macbeth
- 1.1.1 Wallensteins Monolog Wär's möglich? Könnt' ich...
- 1.1.2 Macbeths Monologe
- 1.1.2.1 If it were done when 'tis done...
- 1.1.2.2 Is this a dagger which I see before me
- 1.1.3 Zusammenfassung
- 1.2 Die Räuber und Richard III
- 1.2.1 Franz Monolog Tröste dich, Alter! Du wirst ihn nimmer...
- 1.2.2 Richards Monolog Now is the winter of our discontent
- 1.2.3 Zusammenfassung
- 1.3 Die Verschwörung des Fiesco zu Genua: Fiescos Monolog Was ist das? - Der Mond ist unter – der Morgen kommt feurig
- 1.4 Don Karlos: Posas Monolog Wär's möglich? Wär es?
- 1.5 Maria Stuart: Elisabeths Monolog O Sklaverei des Volksdiensts!
- 1.6 Wilhelm Tell: Tells Monolog Durch diese hohle Gasse muss er kommen
- 1.1 Wallenstein und Macbeth
- 2. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Monologe in den Dramen Schillers und Shakespeares, um den Einfluss Shakespeares auf Schillers Werk aufzuzeigen. Die Analyse konzentriert sich auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung innerer Konflikte und Entscheidungsfindungen der Figuren durch den Einsatz von Monologen.
- Vergleich der Monologtechniken bei Schiller und Shakespeare
- Analyse der psychologischen Tiefe der dargestellten Figuren durch ihre Monologe
- Untersuchung der Funktion von Monologen als dramaturgisches Mittel
- Bedeutung von Goethes Interpretation Shakespeares für den Vergleich
- Parallelen in Handlung, Charakteren und Motiven beider Autoren
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Monologe in der Literatur ein und erläutert die Bedeutung von Monologen als Ausdruck innerer Konflikte und als dramaturgisches Mittel. Sie stellt die Autoren Schiller und Shakespeare vor und skizziert die Forschungsfrage nach dem Einfluss Shakespeares auf Schillers Werk. Die Einleitung verweist auf die zentrale Bedeutung von Introspektion und die Darstellung von Entscheidungsfindungsprozessen durch Monologe. Sie veranschaulicht die Relevanz von Monologen im alltäglichen Leben und in der Literatur, unterstreicht den Einfluss von Goethe's Arbeit über Shakespeare auf die vorliegende Untersuchung, und kündigt den Aufbau der Arbeit an.
1.1 Wallenstein und Macbeth: Dieses Kapitel analysiert die Monologe Wallensteins und Macbeths im Detail. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der sprachlichen Gestaltung, der psychologischen Darstellung der Figuren und der dramaturgischen Funktion der Monologe untersucht. Der Vergleich zeigt, wie beide Autoren durch Monologe die inneren Konflikte ihrer Protagonisten offenbaren und ihre Entscheidungsfindungen nachvollziehbar machen. Goethes Interpretation von Wallenstein wird herangezogen, um die Handlungsmotive und die Entwicklung der Figur zu erläutern. Die Analyse der Monologe beleuchtet, wie Wallenstein und Macbeth mit ihren jeweiligen moralischen Dilemmata ringen und wie diese Konflikte sprachlich und dramaturgisch inszeniert werden. Die Struktur der Monologe, ihre sprachlichen Mittel, und deren Beitrag zur Charakterisierung der Figuren werden eingehend untersucht. Die Kapitelteil-Zusammenfassung integriert die Analyse der einzelnen Monologe zu einem zusammenhängenden Verständnis der Kapitelthematik.
1.2 Die Räuber und Richard III: Diese Kapitel setzt den Vergleich der Monologtechniken fort, indem es die Monologe von Franz Moor (aus Schillers "Die Räuber") und Richard III. analysiert. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Strategien, die die Figuren zur Darstellung ihrer Ziele und Ängste einsetzen. Die Analyse untersucht die sprachlichen Mittel und die psychologischen Aspekte der Monologe. Die Analyse zeigt auf, wie die Wahl der Sprache, der rhetorischen Mittel und der Metaphorik die jeweilige Persönlichkeit und die Situation der Figuren widerspiegelt. Der Vergleich von Franz und Richards Monologen legt dar, wie Schiller und Shakespeare unterschiedliche Charaktere mit ähnlichen dramatischen Mitteln darstellen, und inwiefern sich Schiller von Shakespeare inspirieren ließ.
1.3 Die Verschwörung des Fiesco zu Genua: Dieses Kapitel analysiert den Monolog Fiescos und untersucht seine Funktion innerhalb des Gesamtstücks. Es werden die sprachlichen Besonderheiten des Monologs herausgearbeitet und seine Bedeutung für die Entwicklung der Handlung und die Charakterisierung Fiescos beleuchtet. Die Analyse vergleicht Fiescos Monolog mit ähnlichen Monologen in den Werken Shakespeares, um mögliche Einflüsse aufzuzeigen. Das Kapitel zeigt den Einsatz von Monologen als Mittel zur Darstellung von Ambivalenz und der Konfliktlösung in der Handlung.
1.4 Don Karlos: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Analyse des Monologs von Posa. Die Analyse untersucht die sprachlichen Mittel, die Posa verwendet, um seine inneren Konflikte und seine politischen Ziele auszudrücken. Die Kapitel-Zusammenfassung integriert die Einzelaspekte der Monologanalyse, um die Funktion des Monologs im Gesamtkontext des Dramas und im Vergleich zu Shakespeare zu verdeutlichen. Die Analyse beleuchtet insbesondere den Einfluss von Posas Monolog auf die Handlungsentwicklung und die Charakterisierung der anderen Figuren.
1.5 Maria Stuart: Hier wird Elisabeths Monolog im Detail analysiert. Die Untersuchung konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel und die psychologische Tiefe der Figur, die durch den Monolog offenbart werden. Die Zusammenfassung dieses Kapitels verknüpft die Einzelaspekte der Analyse und zeigt die Bedeutung des Monologs für die Gesamtinterpretation des Dramas und für den Vergleich mit Shakespeares Werken. Der Fokus liegt auf der Darstellung des inneren Konflikts Elisabeths und ihrer politischen Situation.
1.6 Wilhelm Tell: Dieses Kapitel widmet sich Tells Monolog und untersucht dessen Bedeutung für das Verständnis der Figur und des Dramas. Die Analyse geht auf die sprachlichen Mittel ein und zeigt die Verbindung zwischen dem Monolog und der Handlung. Die Kapitel-Zusammenfassung integriert die Einzelheiten der Analyse und betont die Bedeutung von Tells Monolog für die Entwicklung der Handlung und die Charakterisierung Tells im Vergleich zu ähnlichen Monologen in Shakespeares Dramen.
Schlüsselwörter
Monologe, Schiller, Shakespeare, Dramenanalyse, Vergleichende Literaturwissenschaft, Innere Konflikte, Entscheidungsfindung, Dramaturgie, Sprachstil, Psychologische Darstellung, Wallenstein, Macbeth, Richard III, Franz Moor, Fiesco, Posa, Elisabeth, Tell, Goethe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Monologen bei Schiller und Shakespeare
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Monologe in ausgewählten Dramen von Friedrich Schiller und William Shakespeare. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Monologtechniken beider Autoren und der Untersuchung des Einflusses Shakespeares auf Schillers Werk. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung innerer Konflikte und Entscheidungsfindungen der Figuren durch den Einsatz von Monologen.
Welche Dramen werden untersucht?
Die Analyse umfasst Monologe aus folgenden Dramen: Schillers Wallenstein, Die Räuber, Die Verschwörung des Fiesco zu Genua, Don Karlos, Maria Stuart und Wilhelm Tell; sowie Shakespeares Macbeth und Richard III.
Welche konkreten Monologe werden analysiert?
Die Arbeit untersucht unter anderem folgende Monologe: Wallensteins "Wär's möglich? Könnt' ich...", Macbeths "If it were done when 'tis done..." und "Is this a dagger which I see before me...", Franz Moors "Tröste dich, Alter! Du wirst ihn nimmer...", Richards "Now is the winter of our discontent", Fiescos "Was ist das? - Der Mond ist unter – der Morgen kommt feurig", Posas "Wär's möglich? Wär es?", Elisabeths "O Sklaverei des Volksdiensts!", und Tells "Durch diese hohle Gasse muss er kommen".
Welche Aspekte der Monologe werden analysiert?
Die Analyse betrachtet die sprachliche Gestaltung, die psychologische Darstellung der Figuren, die dramaturgische Funktion der Monologe, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Monologtechniken von Schiller und Shakespeare, und den Einfluss von Goethes Interpretation Shakespeares auf den Vergleich.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss Shakespeares auf Schillers Werk aufzuzeigen, indem sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung innerer Konflikte und Entscheidungsfindungen durch Monologe vergleicht. Sie untersucht die Monologtechniken als dramaturgisches Mittel und die psychologische Tiefe der Figuren, die durch ihre Monologe offenbart wird.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von der detaillierten Analyse der ausgewählten Monologe, gruppiert nach den jeweiligen Dramen. Ein Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen. Das Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht über die Kapitel und Unterkapitel.
Welche Rolle spielt Goethe in dieser Arbeit?
Goethes Interpretation Shakespeares spielt eine wichtige Rolle im Vergleich der beiden Autoren. Seine Interpretationen werden herangezogen, um die Handlungsmotive und die Entwicklung der Figuren zu erläutern und den Einfluss Shakespeares auf Schiller besser zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Monologe, Schiller, Shakespeare, Dramenanalyse, Vergleichende Literaturwissenschaft, Innere Konflikte, Entscheidungsfindung, Dramaturgie, Sprachstil, Psychologische Darstellung, Wallenstein, Macbeth, Richard III, Franz Moor, Fiesco, Posa, Elisabeth, Tell, Goethe.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und richtet sich an Leser, die sich für die Dramenliteratur von Schiller und Shakespeare, vergleichende Literaturwissenschaft und Dramenanalyse interessieren.
- Quote paper
- Manuela Kistner (Author), 2006, Monologe bei Schiller und Shakespeare, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75386