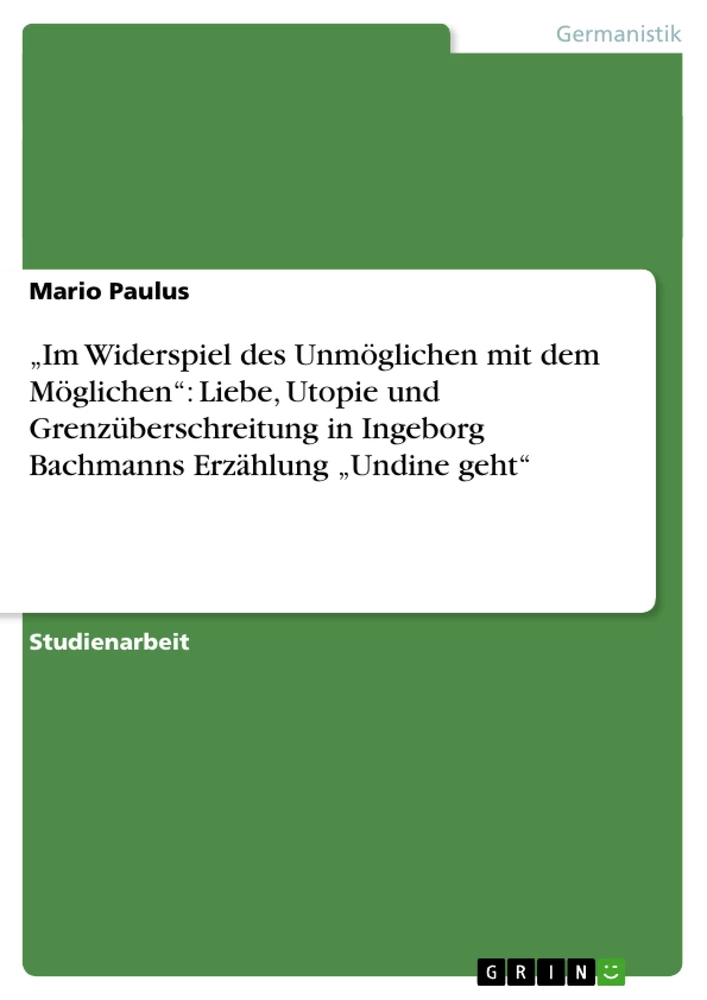Ingeborg Bachmanns Werk ist mit dem Aufkommen der feministischen Literaturwissenschaft seit den 1970er Jahren vollständig neu interpretiert worden. Die Affinität ihres Werkes zu Feminismus und Gender-Forschung ist deshalb nahe liegend, weil Bachmanns literarisches Schaffen in hohem Maße von einer Kritik der bestehenden Geschlechterordnung geprägt ist. Diese Kritik steht aber letztlich stellvertretend für die akuten Missstände in der Zivilisation schlechthin.
Allerdings wird man Ingeborg Bachmanns Texten nicht gerecht, wenn man bei einer Deutung ausschließlich diese kritisch-pessimistische Sicht auf die Welt zugrunde legt. Denn ihr Werk wäre nicht denkbar ohne einen utopischen Grundton, der – mal stärker, mal schwächer – immer wieder zu vernehmen ist. Andererseits wird die Verwirklichung dieser Utopien immer wieder ins Reich des Unmöglichen verwiesen, und es ist letztlich diese Spannung zwischen dem Festhalten an einer Utopie und dem zugleich fehlenden Glauben an ihre (gesellschaftliche) Realisierung, die charakteristisch ist sowohl für ihre Gedichte als auch für ihre Prosatexte und Hörspiele.
Letztlich dürfte es – im „dreißigsten Jahr“ nach ihrem frühen Tod – bei der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Bachmanns Werk darum gehen, sowohl ihre Verwurzelung im historischen Kontext – also vor allem Kriegs- und Nachkriegszeit sowie politische Restaurationsphase – als auch ihre individuell ausgeprägte Sichtweise auf ihre (öffentliche und private) Umwelt gleichermaßen zu berücksichtigen.
In der vorliegenden Untersuchung der Erzählung „Undine geht“ wird deshalb davon ausgegangen, dass der Liebesverrat von zentraler Bedeutung ist, dass eine rein existentialistische Erklärung für die zyklische Handlungsstruktur aber ebenso zu kurz greift wie eine Überbetonung der Verbindung zwischen Bachmanns Werk und der „Dialektik der Aufklärung“ von Adorno und Horkheimer.
Vielmehr wird zunächst einmal dezidiert untersucht, wie Bachmann das Geschlechterverhältnis darstellt und welche Konsequenzen diese Darstellung für den Handlungsverlauf hat. Dann wird – ausgehend von der Titelfigur – analysiert, welche Rolle der Utopie in der Erzählung zukommt, welchen Stellenwert die Autorin in diesem Zusammenhang der Literatur und dem Schriftsteller beimisst und in welcher Weise sie sich dabei auf die literarische Tradition bezieht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: zyklische Erzählstruktur und Existentialismus
- Bachmanns Diskurskritik: Zum Umgang mit Dichotomien
- ,,von mir, der anderen, dem anderen“: Zur Dichotomie „Subjekt – Objekt“
- ,,Ich gehe ja schon“: Zur Dichotomie „aktiv – passiv“
- „Die Kunst, ach die Kunst“: Undine als Produkt männlicher Phantasie
- „(K)ein Tag wird kommen“: Utopie und Grenzüberschreitung
- „Die nasse Grenze zwischen mir und mir“: Trennung von Hans und Undine
- „Komm. Nur einmal. Komm“: Grenzüberschreitung?
- „Denn wir wollen alle sehend werden“: Utopie und Poesie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Ingeborg Bachmanns Erzählung "Undine geht" und untersucht, wie sie die bestehenden Geschlechterrollen und die gesellschaftliche Ordnung kritisiert. Die Analyse beleuchtet Bachmanns utopischen Grundton und die Spannung zwischen dem Festhalten an einer Utopie und der fehlenden Überzeugung an ihrer Realisierbarkeit. Darüber hinaus wird die Bedeutung des Existentialismus für das Verständnis der Erzählung und die Rolle von Undine als Individuum im Kontext von Liebe und Grenzüberschreitung untersucht.
- Kritik der bestehenden Geschlechterordnung
- Spannung zwischen Utopie und Realisierung
- Die Bedeutung des Existentialismus für das Verständnis der Erzählung
- Undines Rolle als Individuum und ihre Suche nach Liebe
- Die Grenzen zwischen Mensch und Natur und die Grenzüberschreitung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Erzählung "Undine geht" ein und stellt die zentrale Frage nach der Bedeutung von Undines zyklischer Bewegung zwischen der Menschenwelt und ihrer Unterwasserwelt. Sie stellt die These auf, dass die Erzählung ein "existentialistisches Manifest" ist, das die Unvereinbarkeit von Ordnung und individueller Selbstverwirklichung beleuchtet.
Kapitel 2 widmet sich Bachmanns Diskurskritik und analysiert die Dichotomien "Subjekt – Objekt", "aktiv – passiv" und die Darstellung von Undine als Produkt männlicher Phantasie. Es zeigt, wie Bachmann die bestehenden Geschlechterrollen und die Machstrukturen in der Gesellschaft kritisiert.
Kapitel 3 befasst sich mit den Themen Utopie und Grenzüberschreitung. Es untersucht die Trennung von Hans und Undine und die Frage, ob Undines "Kommen" zur Menschenwelt eine Grenzüberschreitung darstellt.
Kapitel 4 beleuchtet die Verbindung zwischen Utopie und Poesie in der Erzählung und wie Bachmann die Sehnsucht nach Veränderung und die Suche nach einer besseren Welt thematisiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Ingeborg Bachmann, "Undine geht", Utopie, Grenzüberschreitung, Liebe, Existentialismus, Gesellschaftskritik, Geschlechterrollen, Dichotomie, Ordnung, Individuum, Selbstverwirklichung, Natur, Menschenwelt, Unterwasserwelt, Zyklus.
Häufig gestellte Fragen
Welche zentrale Kritik äußert Ingeborg Bachmann in „Undine geht“?
Bachmann kritisiert die bestehende Geschlechterordnung und die Missstände der Zivilisation, oft dargestellt durch die Unvereinbarkeit von individueller Freiheit und gesellschaftlicher Ordnung.
Was symbolisiert die Figur der Undine?
Undine steht für das utopische Element und die Natur, wird aber im Text auch als ein Produkt männlicher Phantasie dekonstruiert.
Welche Rolle spielt der Utopie-Begriff in der Erzählung?
Es herrscht eine Spannung zwischen dem Festhalten an einer Utopie und dem gleichzeitigen Wissen um deren Unmöglichkeit in der realen Gesellschaft.
Inwiefern ist die Erzählung existentialistisch geprägt?
Die zyklische Struktur und Undines Suche nach authentischer Liebe spiegeln existentialistische Themen wie Selbstverwirklichung und die Grenzen der Existenz wider.
Wie werden Dichotomien wie „aktiv – passiv“ im Text behandelt?
Die Arbeit analysiert, wie Bachmann klassische Gegensätze (Subjekt/Objekt, aktiv/passiv) nutzt, um Machtstrukturen im Geschlechterverhältnis aufzuzeigen.
- Quote paper
- M.A. Mario Paulus (Author), 2003, „Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen“: Liebe, Utopie und Grenzüberschreitung in Ingeborg Bachmanns Erzählung „Undine geht“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75431